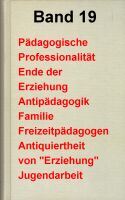 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke
Gesammelte Schriften
Band 19: 1986 - 1987© Hermann Giesecke
![]() Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Inhaltsverzeichnis
aller Bände
Zu dieser Edition
Dieser 19. Band meiner gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus den Jahren 1986 und 1987. In dieser Zeit war ich (seit 1967) als Professor für Pädagogik und Sozialpädagogik an der Pädagogischen Hochschule Göttingen, nach deren Integration 1978 am Fachbereich Erziehungswissenschaften der Universität Göttingen tätig. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner AutobiographieMein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.
Die Edition der Schriften in diesem Band bemüht sich um Vollständigkeit. Aufgenommen wurden nur bereits gedruckte Texte, keine selbständigen Monographien
Die Texte sind nach ihrem Erscheinungsjahr geordnet.
Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert. Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die jeweilige Textseite des Originals.
Die Beiträge werden von "1" an nummeriert, die vorangehenden Arbeiten befinden sich in den früheren Bänden.
Inhalt von Band 19
147. Was ist des Pädagogen Profession? (1986)
148. Jugendarbeit als Kulturpädagogik (1986)
149. Das Ende der Erziehung? (1986)
150. Die Grenzen der Antipädagogik und ihrer Kritiker (1986)
151. Was heißt hier Familie ... (1986)
152. Jugendarbeit in der massenmedialen Freizeitgesellschaft (1987)
153. Der Freizeitpädagoge (1987)
154. Zur Geschichte der außerschulischen politischen Jugendbildung (1987)
155. Über die Antiquiertheit des Begriffes "Erziehung" (1987)
147. Was ist des Pädagogen Profession? (1986)Ein Versuch über pädagogisches Handeln
Theodor Wilhelm zum 80. Geburtstag
(In: Neue Sammlung, H. 2/1986, S. 205-215)
Kaum eine vergleichbare, unmittelbar auf Menschen bezogene berufliche Tätigkeit ist sich ihrer Professionalität so unsicher wie die pädagogische. Ob Lehrer, Sozialpädagoge, Freizeitpädagoge oder Jugendbildungsdozent, kaum jemand scheint noch genau zu wissen, wofür er eigentlich bezahlt wird. Kein Zweifel, das Selbstverständnis der pädagogischen Profession steckt in einer tiefen Krise und die wirkt zurück auf die Ausbildungsstätten, auch auf die entsprechenden Fachbereiche der Universität. In einer solchen Situation ist viel Raum für ideologische Kompensationen, für allerlei Weltverbesserertum, das sich von den angeblich Schwachen her legitimiert - von den Kindern überhaupt, von den Arbeitslosen, den Armen und Ausgebeuteten; oder der Mangel an befriedigenden persönlichen Basisbeziehungen wird kompensiert durch forcierte "Beziehungsarbeit" im Beruf. Wie gut hatten es da die traditionellen Gymnasiallehrer, die ähnlich wie die Professoren ihre "Sache" lehrten (Latein, Geschichte, Mathematik usw.) und für die sich "Pädagogik" reduzierte auf die Geschicklichkeit des "Beibringens" und auf die Herstellung einer möglichst lockeren, unverkrampften Lernsituation. Gut hatten es da auch die nicht primär sach- , sondern kindzentrierten Reformpädagogen, die ihr professionelles Selbstverständnis noch darauf gründen konnten, daß sie die Experten für Kindheit und Jugendalter seien. Aber die Kinderexperten von heute sind, jedenfalls in den Augen der Öffentlichkeit, die Psychologen, und beim Jugendalter gesellen sich die Soziologen dazu. Die Kindlichkeit des Kindes und die Jugendlichkeit des Jugendlichen allein können den besonderen Beruf des Pädagogen nicht mehr fundieren. Was also bleibt?
Ich möchte im folgenden nicht über die Ursachen der professionellen Identitätskrise nachdenken, das habe ich zum Teil in dem Buch "Das Ende der Erziehung" (Stuttgart 1985) versucht. Vielmehr möchte ich eine Skizze vortragen, die allerdings lediglich ein Diskussionsbeitrag sein kann, wie ich mir eine Neuformulierung des pädagogischen Berufsverständnisses vorstellen könnte, und zwar für alle pädagogischen Berufe.
Dabei argumentiere ich "erfahrungsorientiert", das heißt, ich versuche das, was ich in der pädagogischen Realität vorzufinden meine und was deshalb der Erfahrung des Lesers nicht unbekannt ist, vom Standpunkt des pädagogischen Handelns aus zu ordnen. Die begrifflichen Fixierungen betrachte ich als vorläufig, und ich muß auch in Kauf nehmen, daß wichtige Aspekte nur angedeutet, aber nicht hinreichend geklärt werden können, es kommt mir jedoch darauf an, eine Reihe von Gesichtspunkten im Zusammenhang vorzustellen.
295
1. Ein Kind muß von seiner Geburt an, um in seine Gesellschaft hineinwachsen und in ihr befriedigend leben zu können, unendlich viel lernen. An dieser Stelle sprechen wir meist mit Kant von der "Erziehungsbedürftigkeit" des Menschen. Aber diese Behauptung ist mißverständlich, weil dabei traditionellerweise die Vorstellung mitschwingt, wir müßten das Kind erst zum Menschen "machen", ohne unsere erzieherischen Eingriffe könne nichts aus ihm werden. Meine Überzeugung - die ich jetzt nur als Prämisse setzen kann - ist jedoch, daß das Kind in Wahrheit vom ersten Tag seines Lebens an sich selbst "macht", seine Persönlichkeit im Umgang mit seiner Umwelt und in Auseinandersetzung mit ihr selbst entfaltet. Deshalb möchte ich auf den Begriff "Erziehung" in diesem Zusammenhang verzichten und bei der unbedingten Notwendigkeit des "Lernens" bleiben, denn die zumindest kann nicht strittig sein.
Was dabei des Kindes individuelles "Wesen" ist, das sich unbeeindruckt von den ihm entgegentretenden Reizen und Anforderungen durchsetzt, und was gerade Ergebnis der Umwelteindrücke ist, also auch des pädagogischen Handelns, ist unentscheidbar. Ob eine "gelungene Sozialisation" - was immer das heißen mag - trotz oder wegen einer "guten Erziehung" zustande gekommen ist, steht in jedem Einzelfall dahin. Der Begriff des "Lernens" hat also den Vorteil der pragmatischen Anschaulichkeit, er erkennt den Lernenden als Subjekt seines Lebens an, und er ist, was die Inhalte angeht, zunächst einmal wenig festgelegt.
Um zu lernen, braucht das Kind unter anderem Erwachsene, von und mit denen es dies kann, und diese bilden im allgemeinen zusammen mit ihm eine Familie (Ausnahmen lasse ich jetzt außer acht). Die Familie aber ist eine basale Lebensgemeinschaft und keine professionalisierbare pädagogische Institution (professionalisierbar sind nur die Ausnahmen, zum Beispiel Heimerziehung). Von Familie spreche ich im folgenden nicht mehr, aber ich möchte klarstellen, daß professionelles pädagogisches Handeln etwas ganz anderes ist als das Zusammenleben mit Kindern in einer Familie oder einer vergleichbaren Basisorganisation.
2. Je älter das Kind wird, um so mehr lernt es nicht nur im Umgang mit seinen Eltern und Geschwistern, sondern mit allen Menschen, auf die es trifft, und das gilt bis zum Tode. Das Leben selbst ist eine unendliche Kette von Lernprozessen, und zwar zunächst einmal ohne jeden professionellen Pädagogen. Auf professionelle Pädagogen trifft das Kind spätestens beim Schuleintritt, auf andere möglicherweise im Rahmen einer notwendig werdenden "Fürsorgeerziehung", auf wieder andere, wenn es in seiner Freizeit etwas lernen will, zum Beispiel im Rahmen der Jugendarbeit.
3. Professionelle pädagogische Tätigkeit ist also öffentliche Tätigkeit - von Privatlehrern abgesehen - und sie ist als "Lernhilfe" zu beschreiben. Professionelle Pädagogen sind Lernhelfer, und zwar solche, die ihr Handwerk planmäßig und zielorientiert auszuüben verstehen. Sie sind Menschen, von und mit denen man etwas lernen kann: sie wissen oder können etwas, was andere nicht wissen oder können, und sie sind in der Lage, mit diesen anderen eine produktive "Lerngemeinschaft" einzugehen; beides zusammen macht den Kern "pädagogischen Handelns" aus. Dem Wortsinn nach richtet sich pädagogisches Handeln lediglich auf Unmün-
206
dige; die Erfahrung lehrt uns aber, daß Lernen - auch in professionell organisierter Form - eine lebenslange Notwendigkeit geworden ist, die Altersstufen Kindheit und Jugend also zu Sonderfällen pädagogischen Handelns geworden sind. Ja, die "Pädagogisierung" - im positiven Sinne - ist weiter fortgeschritten. Hatte man früher Behinderte, Gebrechliche, Geisteskranke lediglich versorgt und gepflegt, so versucht man neuerdings, sie ebenfalls als - wenn auch begrenzt - lernfähig zu betrachten und ihnen wie allen anderen Menschen ein Höchstmaß an Entfaltung ihrer noch vorhandenen Fähigkeiten zu ermöglichen, damit auch sie ein möglichst selbstbestimmtes Leben führen können. Die Leitfrage aller pädagogischen Studien und Ausbildungsgänge müßte also sein: Was kann man von und mit dem Absolventen hinterher lernen?
Es muß also immer eine "Sache" geben, eine im weitesten Sinne "kulturelle Kompetenz", die der Pädagoge als Lernhelfer beherrscht - ein Handwerk, eine Kunst, eine Wissenschaft - , sonst ist von ihm als Profi nichts zu lernen. Planmäßiges Lernen "als solches" gibt es nicht, sondern immer nur in bezug auf eine Sache. Ich halte jede nicht rechtswidrige soziale und kulturelle Kompetenz für prinzipiell des Lernens würdig, was natürlich nicht bedeutet - und auch ganz unrealistisch wäre - , daß alle denkbaren Kompetenzen an einem Orte (z. B. in der Schule) gelernt werden sollten. Über sinnvolle Begrenzungen und damit auch Bewertungen - wie sie im Rahmen einer Bildungstheorie zu erörtern wären - kann hier nicht weiter entschieden werden, zumal sich diese Frage für Lernangebote auf dem Freizeitmarkt der außerschulischen Bildung anders stellt als für die Schule. Der Pädagoge benötigt also zwei Kompetenzen: eine kulturelle ("Sache") und eine kommunikative ("pädagogischer Bezug").
4. Nun verstehen sich aber auch therapeutische Berufe als "Lernhelfer". Pädagogisches Handeln kommt - in Abgrenzung dazu - dort an seine Grenze, wo Lernprozesse nicht mehr der rationalen Aufklärung zugänglich sind, wo sie nicht mehr argumentativ ins Bewußtsein genommen werden können, wo das Gesagte nicht mehr das Gemeinte ist. Pädagogisches Handeln ist also nur dort möglich, wo der wechselseitig verstehbare Austausch von sprachlich erschlossenen Erfahrungen möglich ist. Das allerdings ist der Normalfall im privaten wie öffentlichen Leben.
Ferner gibt es auch andere Berufe, die der Sache nach "Lernhelfer" sind (z.B. Fahrlehrer, Tennislehrer usw.), die sich aber nicht als Pädagogen bezeichnen. Das zeigt nur, daß eine Reihe von Lernbedürfnissen kommerziell befriedigt werden und daß die Berufsbezeichnung "Pädagoge" eine gewisse historische Zufälligkeit verrät. Ich behaupte, daß das, was ich hier über "pädagogisches Handeln" sage, mutatis mutandis auch für diese Berufe gilt.
5. "Lernhilfe" ist nun zwar das oberste Leitmotiv pädagogischen Handelns, aber der Beruf des Pädagogen verlangt von ihm noch andere Handlungsfähigkeiten. Ein Lehrer z.B. muß zumindest noch administrativ handeln, indem er etwa Noten erteilt. Administratives Handeln hat zum Ziel, vorgegebene allgemeine Normen oder Verfahrensweisen auf Einzelfälle anzuwenden, um dadurch das Einzelne, Einmalige, Individuelle als mit anderen Einzelnen usw. gleich zu definieren und zu behandeln. Ferner muß er zumindest in besonderen Fällen auch ökonomisch han-
207
deln können mit dem Ziel, mit möglichst geringen Kosten eine Absicht zu realisieren. Und nicht selten muß er auch politisch handeln, um nämlich die ihm von der Institution verliehene Macht zur Herstellung oder Wiederherstellung der für das gemeinsame Arbeiten oder Zusammenleben nötigen Ordnung anzuwenden. Im außerschulischen Bereich sind diese nicht-pädagogischen sozialen Handlungsformen noch bedeutsamer.
Die Notwendigkeit dazu resultiert daraus, daß es in der Öffentlichkeit keine "reinen" pädagogischen Handlungssituationen gibt; vielmehr sind pädagogische Handlungsfelder (Schule; Freizeitlager; Fürsorgeheim) gesellschaftlich verortet in Form von Institutionen, und deren allgemeine und besondere Erwartungen müssen die dort tätigen Pädagogen geltend machen. Konkreter: in jedem pädagogischen Handlungsfeld gelten rechtliche Rahmenbedingungen (Grundrechte; allgemeingültige Rechtsbestimmungen; besondere Rechtsbestimmungen, zum Beispiel Aufsichtspflicht gegenüber Minderjährigen) sowie Erwartungen des Trägers (z.B. Orientierung am Lehrplan in der Schule; "christlicher Geist" in einer kirchlichen Kinderfreizeit). Jeder Pädagoge muß die für sein Handlungsfeld gegebenen rechtlichen Rahmenbedingungen und Erwartungen des Trägers ermitteln, um erfolgreich handeln zu können. Ein Freizeitpädagoge in einem kommunalen Jugendhaus kann zum Beispiel per schlichter Dienstanweisung veranlaßt werden, dies zu tun oder jenes zu lassen.
Ein Pädagoge, der solche nicht-pädagogischen Aspekte seines beruflichen Handelns nicht akzeptiert, mißversteht den gesellschaftlichen Charakter seiner Profession und bewirkt bei seinen Partnern, wenn er dieses Mißverständnis an sie weitergibt, möglicherweise falsche politisch-gesellschaftliche Vorstellungen. Andererseits kann er solche nicht-pädagogischen Handlungen immer auch mit Lernangeboten verbinden, die Zugänge zu grundlegenden gesellschaftlichen Sachverhalten öffnen. Die Notengebung in der Schule impliziert zum Beispiel das Problem der Statusvergabe in einer demokratischen Gesellschaft, die Durchsetzung von Jugendschutzbestimmungen im Zeltlager kann verbunden werden mit der Erklärung von Sinn- und Zweckaspekten des Rechtes, zum Beispiel seiner Schutzfunktion. Solidarisiert und identifiziert sich der Pädagoge statt dessen naiv und sachlich undifferenziert einfach mit seinen Partnern, mit ihren "Bedürfnissen", als sei er ihr "Anwalt", dann handelt er nicht als Lernhelfer, sondern gerade gegen die Regeln seiner Profession.
6."Reine" pädagogische Situationen kann es aus einem weiteren Grund nicht geben: Wenn "Lernen ermöglichen" die zentrale Leitvorstellung pädagogischen Handelns ist, dann muß es die Menschen und deren sozialen Kontext - zum Beispiel die Schüler einer Klasse - partikular sehen. Keine Situation und keine Sozialität aber kann selbst bei höchstmöglicher Disziplin auf die Dauer voll auf eine bestimmte Lernaufgabe konzentriert werden, weil die Menschen immer auch andere Bedürfnisse haben als zu lernen. Erfahrene Lehrer wissen das und lassen zum Beispiel auf Phasen hoher Konzentration Phasen entspannter Kommunikation folgen. Anders ausgedrückt: es gibt keine per se "pädagogischen" Situationen und Handlungsfelder, sondern nur solche, in denen auch pädagogisches Handeln möglich ist. Oder: pädagogisches Handeln ist immer eine Intervention in einen vorgegebenen Lebenszusammenhang, der dadurch nicht konstituiert werden kann.
208
Die Partikularität pädagogischen Handelns fällt in der Schule insofern nicht weiter auf, als sie auf wenige Stunden am Tag begrenzt ist. Wo jedoch der Umgang mit Lernenden sich auf längere Zeit erstreckt (z.B. Internat, Schullandheim, Ferienlager, Tagung, Heim), da kann nicht unentwegt etwas gelernt werden, da muß der Pädagoge auch andere Formen des Handelns entwickeln, die ich hier als "Geselligkeit" zusammenfassend bezeichnen möchte und deren Maxime "Unterhaltung" oder einfach "Spaß" ist. Das wiederum soll nicht heißen, daß der Pädagoge den "Spaß" auch "veranstalten" muß, aber er muß sich am gemeinsamen Leben jenseits des pädagogischen Handelns in irgendeiner Weise beteiligen.
7 Pädagogisches Handeln ist eine Form des sozialen Handelns, also auf das Handeln anderer bezogen. Diese anderen (z. B. Schüler) können das pädagogische Handeln unterstützen, aber auch abwehren (z.B. "stören") oder aber konkurrierende Handlungen ins Spiel bringen (z.B. während des Unterrichts Comics lesen). Um Unterstützung des pädagogischen Handelns zu erreichen, kann man in manchen pädagogischen Feldern Druckmittel einsetzen (z.B. Zensuren in der Schule), in anderen (z.B. im außerschulischen Bereich) ist man weitgehend auf Verständigung über die Ziele und Verfahren eines Lernprozesses angewiesen, aber auch in der Schule wäre Verständigung die befriedigendere und solidere Basis für den Erfolg eines Lernprozesses.
"Verständigung" ist nicht nur eine Frage des guten Willens oder des persönlichen Einvernehmens, sondern auch das Ergebnis eines rationalen Diskurses, etwa unter folgenden Gesichtspunkten:
a) Was gelernt werden soll, ist nötig für die Entwicklung beziehungsweise Weiterentwicklung allgemeiner Fähigkeiten oder Fertigkeiten;
b) es ist nötig, damit man später weiterlernen kann;
c) es bereichert das gegenwärtige oder künftige Leben im ästhetisch-kulturellen Sinne;
d) es ist nötig, um eine bestimmte Berechtigung zu erwerben;
e) es ist nötig, um berufliche Chancen zu verbessern.
Wenn "Lernhilfe" soziales Handeln ist, dann folgt daraus auch, daß die Lernprozesse wechselseitig sind: Wer lehrt, lernt dabei selbst, wenn auch nicht unbedingt dasselbe wie seine Partner. Wer selbst nicht lernt, von dem ist auch auf die Dauer nichts zu lernen.
8. Sieht man auf die innere Struktur des pädagogischen Handelns als zielgerichteter, planmäßiger Lernhilfe, dann zeigt sich, daß sie formal der anderer Formen des sozialen Handelns entspricht. Es geht im wesentlichen um folgende Handlungsdimensionen:
a) Zielsetzung. Ziel ist das, was am Ende eines Lernprozesses herauskommen, sein Ergebnis sein soll. Da die Lernenden aber keine tote Materie sind, sondern selbst handeln, ist es unwahrscheinlich, daß gesetzte Ziele vollständig und ausschließlich erreicht werden (beim Schulunterricht würde das zum Beispiel voraussetzen, daß während des ganzen Lernprozesses das Handeln des Lehrers unterstützt wird und daß alle Schüler dem Unterricht zu folgen imstande sind). Ebenso unwahrscheinlich ist, daß nur die Ziele des Lehrers erreicht werden. Während eines jeden Lernprozesses ergeben sich für die Lernenden auch andere interessante Aspekte, denen sie
209
zumindest in ihrer Phantasie nachgehen können, deren Ergebnisse man "Nebenwirkungen" nennt.
Bedeutsamer aber ist, daß die wichtigsten pädagogischen Ziele weitreichende, strategische sind, die durch einzelne pädagogische Handlungen gar nicht erreicht, sondern nur "angepeilt" werden können. Man kann zwar einen begrenzten Stoff so unterrichten, daß er danach in einer Klassenarbeit reproduziert wird. Aber derart begrenzte Ziele sind für sich genommen sinnlos, wenn sie nicht in ein großes, eben strategisches Ziel eingebettet bleiben (hier z.B. Verständnis komplexer Zusammenhänge, von denen der Stoff nur ein Teil ist). Bei anderen Beispielen wird das deutlicher: Wenn zum Beispiel in einem Ferienlager ein pädagogisches Ziel darin besteht daß die Kinder lernen sollen, ihre Konflikte so auszutragen, daß sie dabei Kooperation und Kompromisse schließen lernen, dann kann dies niemals durch einzelne pädagogische Handlungen erreicht werden.
b) Diagnose der Situation, in die hinein gehandelt werden soll. In der Schule unter anderem: Wie ist der Kenntnisstand der Schüler? Wie ist ihre Lernfähigkeit einzuschätzen? Woran kann der neue Stoff anknüpfen? In einem Ferienlager: Wie ist die Gruppe zusammengesetzt? Wie groß sind die Altersunterschiede und die Bildungsunterschiede? Was erwarten die Teilnehmer?
Bei der Diagnose geht es um das Ermitteln der Bedingungen und Voraussetzungen, der Chancen und Grenzen der vorgegebenen Lernsituation. Die Reihenfolge - erst Zielsetzung, dann Diagnose - ist übrigens keineswegs zwingend. Bei Beratungen, in sozialpädagogischen Feldern und im freizeitpädagogischen Bereich kann sie auch umgekehrt sein: aus der Diagnose einer Situation entsteht eine Zielsetzung.
c) Antizipation. Antizipation ist die Vorwegnahme des gedachten Lernprozesses in der Phantasie. Welche Schwierigkeiten sind zu erwarten, welche Nebenwirkungen? Wie kann man vorsorglich solchen Problemen begegnen? Antizipation als vorgestellter Handlungsablauf wird verglichen mit dem tatsächlichen Ablauf, und die Differenz wird zur Korrektur des Lernprozesses benutzt.
d) Prüfung. Wenn pädagogisches Handeln planmäßig und zielorientiert sein soll, dann muß sein Ergebnis auch in irgendeiner Form überprüft werden. Das muß nicht unbedingt wie in der Schule in Form von Klassenarbeiten und Zensuren geschehen, sondern man kann auch zum Beispiel in einer Diskussion nach einem Referat feststellen, inwieweit der Vortrag verstanden wurde. Wenn die Lernenden selbstbewußt genug sind, übernehmen sie das Prüfen selbst, indem sie sich durch entsprechende Rückfragen vergewissern.
e) Korrektur. Je nach dem Ergebnis der Prüfung wird der Lernprozeß korrigiert. Ich halte die Fähigkeit, Lernprozesse ständig zu korrigieren beziehungsweise erneut in Gang zu bringen für viel wichtiger als die Fähigkeit zur perfekten Vorplanung.
9. Die Wissenschaft liebt die logische Reihenfolge, wie ich sie eben skizziert habe. Der pädagogisch Handelnde jedoch kann sich daran nicht halten. Für ihn stehen die eben genannten Dimensionen in einem gleichzeitigen Wechselverhältnis. Prüfung und Korrektur erfolgen ständig im Dialog mit den Lernenden, "Korrektur" kann auch heißen, das Ziel zu ändern oder es in Teilziele aufzulösen, oder die Diagnose zu revidieren. Jeder Faktor kann jeden anderen verändern.
210
Der Handelnde aber ist auf sich allein gestellt, Diagnose, Antizipation, Prüfung und Korrektur sind keine Gewißheiten, sondern reine Interpretationsleistungen von höchst ungewisser Genauigkeit. Deshalb ist der Pädagoge so sehr auf das unterstützende Mithandeln seiner Partner angewiesen, denn nur mit ihnen kann er seine Handlungsstruktur mit einigem Erfolg entfalten. Verweigerung der Mitarbeit stößt ihn dagegen ins Bodenlose.
Aus alldem ergibt sich eine wichtige Schlußfolgerung. Die Frage nach dem einzig möglich "richtigen" pädagogischen Handeln ist auch dann prinzipiell unentscheidbar, wenn man die Handlungsziele nicht in Frage stellt. Es gibt in einer bestimmten Situation immer einen Spielraum für vernünftiges pädagogisches Handeln, der nicht zuletzt durch das Handeln der Partner mitbestimmt ist.
10. Überblickt man die verschiedenen pädagogischen Berufe, die ja leider wegen der historisch entfalteten Arbeitsteilung und wegen der fortwährenden Festschreibung in unterschiedlichen Ausbildungsgängen, Institutionen und Berufsverbänden kaum etwas voneinander wissen, so fällt auf, daß die Pädagogen zwar alle "Lernhelfer" sind, daß sie ihren Beruf aber mit unterschiedlichen Handlungsformen ausfüllen, die gleichwohl aber in jedem pädagogischen Berufsfeld - wenn auch mit unterschiedlichem Akzent - eine Rolle spielen. Solche Grundformen der Lernhilfe sind Unterrichten, Informieren, Beraten, Arrangieren und Animieren.
a) Unterrichten. Diese Handlungsform kennen wir alle aus der Schule, und sie ist wohl am gründlichsten wissenschaftlich untersucht worden. Deshalb kann ich mich hier auf wenige Bemerkungen beschränken. Wissende versuchen, Unwissenden oder besser: weniger Wissenden ihr Wissen "beizubringen". Selbstverständlich spielt diese Handlungsform auch außerhalb der Schule eine Rolle, zum Beispiel in der außerschulischen Erwachsenen- und Jugendbildung, in der Fortbildung usw. Im Unterschied zum "Informieren" geht es beim Unterrichten immer um relativ komplexe Sachverhalte und Zusammenhänge.
b) Informieren. Informationen werden gebraucht, um sich in einer Situation richtig, angemessen oder wunschgemäß verhalten zu können. Informieren heißt, auf eine Frage zu antworten, die entweder tatsächlich gestellt wird oder von der man annehmen kann, daß Menschen sie in einer bestimmten Situation stellen werden. (Der Lehrer informiert über die geplante Klassenfahrt, der Leiter eines Zeltlagers über die Gefahren in der Umgebung, der Erwachsenenbildner über das Programm des nächsten Tages.) In allen pädagogischen Handlungsfeldern gibt es eine Fülle von Situationen, in denen präzise Informationen benötigt werden, und gelegentlich können sie lebenswichtig sein (z.B. bei Unternehmungen der "Kurzschulen" oder wenn Kinder vor Gefahren gewarnt werden müssen). Zumindest bei wichtigen Informationen empfiehlt es sich, die Handlungsdimensionen Diagnose (welche Information wird warum gebraucht?), Antizipation (welches Fehlverhalten kann eine Information verursachen?), Prüfung (ist die Information von allen richtig verstanden worden?) und Korrektur (wie kann man die Information verbindlicher beziehungsweise glaubwürdiger machen?) anzuwenden. Informationen werden um so notwendiger, je offener das pädagogische Feld strukturiert ist (z. B. im außerschulischen Bereich), je weniger also vorweg geregelt ist.
211
c) Beraten. Diese Handlungsform ist einerseits professionell spezialisiert und institutionalisiert (z.B. Erziehungsberatung), andererseits aber auch eine Variante pädagogischen Handelns in allen pädagogische Berufsfeldern. Das Grundmuster ist: ein Ratsuchender will etwas ihm für sein Verhalten Wichtiges lernen, weiß aber nicht wie (das "Lernziel" kann aber auch erst im Rahmen der Diagnose zum Vorschein kommen beziehungsweise präzisiert werden). Zum Begriff des Rates gehört, daß es dem Ratsuchenden freisteht, den Rat anzunehmen oder nicht. ("Ich rate Dir, dies nie wieder zu tun!" ist kein Rat, sondern eine Drohung oder Weisung.) Das "Lernziel" setzt also der Ratsuchende selbst. Von der Bedeutung der Diagnose war schon die Rede, antizipiert werden muß zum Beispiel, in welche Schwierigkeiten der Ratsuchende kommen kann, wenn er den Rat befolgen will, und das Kriterium für die Prüfung ist nicht, ob der Rat angenommen wurde, und auch nicht, ob das Problem objektiv gelöst wurde, sondern, ob der Ratsuchende subjektiv zufrieden ist. Ist er es nicht, wird der Beratungsprozeß entsprechend korrigiert.
d) Arrangieren. Arrangieren heißt, Lernsituationen, also Lernmöglichkeiten zu inszenieren. Dabei können Lernziele meist nur vage vorgegeben werden, die Lernenden setzen sie zum Teil selbst (die "Nebenwirkungen" können hier zur Hauptsache werden). Unsere Bildungsinstitutionen wie die Schule sind gleichsam "institutionalisierte Lernarrangements", über deren pädagogische Vernünftigkeit es daher auch ständig Diskussionen gibt. Diese sind zwar dem Lehrer vorgegeben, gleichwohl handelt auch er unentwegt in der Form des Arrangierens. Was wir "Unterrichtsmethodik" nennen, ist nichts weiter als eine Form des Arrangierens, hier allerdings in der Regel mit dem Ziel, bestimmte Unterrichtsergebnisse zu erreichen. Ein Zeltlager ist per se als Arrangement gedacht, d. h. mit der Erwartung bestimmter Lernchancen verbunden. Rousseau hielt das Arrangieren bekanntlich für eine besonders wichtige pädagogische Handlungsform, auch Makarenko lernte die Bedeutung von Arrangements für die Resozialisierung seiner Zöglinge kennen, und die Nazis knüpften große Hoffnungen an die von ihnen inszenierte "Lagererziehung" - was zeigt, daß Arrangieren auch eine gefährliche, weil "verführerische" Handlungsform sein kann. Wer in der außerschulischen Jugendarbeit oder in der Erwachsenenbildung Teilnehmer mit einem Referenten zusammenbringt, "organisiert" nicht nur, sondern er arrangiert eine Lernsituation und könnte sich damit sogar begnügen, etwa nach dem Motto: "Nun macht selbst was draus!" Nach meinem Eindruck ist Arrangieren außerhalb der Schule eine der wichtigsten und am weitesten verbreiteten pädagogischen Handlungsformen. Um so erstaunlicher ist es, daß sie von der Erziehungswissenschaft kaum beachtet wird. Es gibt unter Lehrern wie im außerschulischen Bereich Meister des Arrangierens, aber meist wird das als "Organisation" bezeichnet, als ob es hier nur um sozial-technische Aspekte ginge! Vielleicht hat das erziehungswissenschaftliche Desinteresse damit zu tun, daß außerhalb der Schule Arrangieren als zu wenig zielorientiert erscheint. Der Pädagoge scheint dabei das Heft aus der Hand zu geben, in seiner professionellen Bedeutung zurückzutreten. Aber wieso soll es nicht zur pädagogischen Profession gehören, für andere Situationen zu inszenieren, damit diese sich selbst vernünftige Lernziele setzen können, so daß der Pädagoge vielleicht nur beratend, informierend, animierend in
212
diesem Rahmen tätig wird? Es würde sich wirklich lohnen, sich mit dieser Handlungsform und der Fülle ihrer - nicht zuletzt übrigens auch ästhetischen! - Möglichkeiten einmal genauer zu befassen, hier geht es mir erst einmal darum, sie überhaupt "hoffähig" zu machen. Abgesehen von präzise zielorientierten Arrangements wie in der Schule ist auch hier - wie schon bei der Beratung - das Kriterium für die Prüfung des Ergebnisses die subjektive Zufriedenheit der Lernenden.
e) Animieren. Animieren ist der Versuch, andere dazu zu bewegen, in einer Situation mögliche Lernchancen auch zu nutzen. Der Begriff ist vor allem im Tourismus üblich und meint dort insbesondere das Bemühen, die Urlauber zu für sie neuen Erfahrungen und Erlebnissen in verschiedener Hinsicht zu ermutigen. Andererseits ist mit diesem Begriff auch verbunden, die Urlauber zu amüsieren, sie "bei Laune zu halten". Dieser Aspekt des "geselligen Handelns" interessiert aber an dieser Stelle nicht. Pädagogisch gesehen - also unter dem Aspekt der Lernhilfe - meint Animieren die Initiation von Lernprozessen, also deren Ingangsetzen. Er schließt also auch das mit ein, was gemeinhin "Motivieren" genannt wird, ist allerdings viel pragmatischer gemeint und deshalb für den Standpunkt des Handelns brauchbarer als der scheinbar wissenschaftliche, aber für die Situation des Handelnden dann doch eher unergiebige Begriff des "Motivierens". (Nach meiner Erfahrung kann man niemanden planmäßig motivieren.)
Ein Grundproblem im Verhältnis von wissenschaftlicher Theorie einerseits und pädagogischer Handlungssituation andererseits besteht ja darin, daß wissenschaftliche Theorien, selbst wenn sie in hohem Maße empirisch abgesichert sind, immer nur statistischen Wert haben können; der pädagogisch Handelnde hat es aber nicht mit statistischen Größen zu tun, sondern mit Individuen, die als solche - und nicht als statistische Repräsentanten - seine Partner sind. Aus demselben Grunde bleiben übrigens auch pädagogische Begründungen für bildungspolitische Entscheidungen problematisch.
Es kann keine Theorie über ein bestimmtes Individuum geben, selbst psychologische Konzepte sind statistische Generalisierungen von Merkmalen beziehungsweise Faktoren, die nur mit einer mehr oder weniger großen Wahrscheinlichkeit für den Einzelfall gelten. Diese Unsicherheit muß durch Handeln überbrückt werden. Das gilt auch für Motivations-Theorien. Ob und wodurch jemand in einer bestimmten Situation motiviert ist, läßt sich letzten Endes nur durch Handeln und durch die Rückmeldung des Gegenhandelns mit pragmatischer, d.h. brauchbarer Klarheit ermitteln.
Animieren als Ingangsetzen von Lernprozessen - sei es von präzise zielorientierten, sei es von "offenen", den Lernenden dann überlassenen - ist ebenfalls bedeutsam für alle pädagogischen Berufsfelder. Leider fehlen uns auch hier wie beim Arrangieren genauere Kenntnisse und Differenzierungsmöglichkeiten. Andererseits scheinen gerade diese beiden Handlungsformen sich einer exakten wissenschaftlichen Erforschung und Beschreibung weitgehend zu entziehen, weil sie sehr personen- und situationsgebunden sind. Zweckmäßig wäre aber immerhin, die verschiedenen Möglichkeiten einmal aufzulisten.
11. Bei näherem Zusehen zeigt sich also, daß pädagogisches Handeln als planmäßige
213
Lernhilfe in verschiedenen Formen erfolgt, die sich insbesondere im Hinblick auf die Zielkompetenz unterscheiden. Lediglich beim Unterrichten und Informieren liegt die Zielkompetenz zumindest überwiegend beim Pädagogen, bei den anderen Handlungsformen überwiegend bei den Partnern. Die Sachkompetenz dagegen muß in jedem Fall überwiegend beim professionellen Pädagogen liegen, sonst kann man von ihm nichts lernen. Sieht man die Sache vom einzelnen pädagogischen Beruf her, so stellt sich heraus, daß diese Handlungsformen keineswegs jeweils einem pädagogischen Teilberuf zuzuordnen sind, sondern daß sie alle in jedem pädagogischen Beruf von mehr oder weniger großer Bedeutung sind, gemeinsam also die pädagogische Profession fundieren.
12. Offensichtlich stehen wir erst am Anfang mit dem Versuch, pädagogische Professionalität hinreichend genau zu beschreiben. Das liegt wohl daran, daß unsere Wissenschaft das pädagogische Handeln, wenn sie sich überhaupt damit befaßt, als Gegenstand begreift. Insofern helfen entsprechende Erörterungen dem Handelnden nicht viel. Wir müssen (wieder) lernen, Handeln als Standpunkt zu betrachten, von dem aus sich die Wirklichkeit in besonderer Weise erschließt. Die Wissenschaft hat Tausende von Köpfen, ein Handelnder hat nur einen einzigen, und dessen Fassungsvermögen ist begrenzt. Er muß sich auf das konzentrieren, was er durch sein Handeln auch tatsächlich beeinflussen kann. Er "macht" nicht die "Bildungsgeschichte" eines Menschen und er kann auch nicht von seiner Profession her die Gesellschaft verändern. Die Reichweite seiner Interpretationen (Diagnose, Antizipation, Prüfung) und der Berücksichtigung von Bedingungsfaktoren ist begrenzt. Es ist zum Beispiel fraglich, ob diese, vom Standpunkt des Handelns entworfene Skizze noch sehr viel weiter differenziert werden kann, ohne ihren praktischen Nutzen zu verlieren - und dabei handelt es sich hier doch nur um erste Andeutungen! Der Pädagoge interveniert nur in begrenztem Umfang in Lebensgeschichten, über die er ansonsten nicht verfügt. Bescheidenheit, gerade auch hinsichtlich der Erwartung der Wissenschaft, ist eine durchaus gebotene Zier; dies auch deshalb, weil der Erfolg pädagogischen Handelns durchweg unsicher ist, weil er nur durch Interpretation zu ermitteln ist. Da ist es schon eine Entlastung, wenn bei einigen pädagogischen Handlungsformen das Erfolgskriterium die subjektive Zufriedenheit ist. Aber auch Unzufriedenheit müßte der Pädagoge sich nicht unbedingt zu Herzen nehmen; denn dort, wo die Menschen sich freiwillig auf Lernprozesse einlassen, wie im außerschulischen Bereich und auch auf der Universität, übernehmen sie auch selbst die Verantwortung für ihre Lernerfolge. Allerdings, wie schon gesagt: Pädagogisches Handeln ist nicht das einzige, was ein Pädagoge in seinem Beruf können muß. Die Menschen, mit denen er umgeht, können und wollen nicht ständig lernen, also sich verändern, sie wollen (und müssen) auch so bleiben können, wie sie sind, sich ihres Soseins erfreuen dürfen. Das Lernangebot des Pädagogen - der Kern seiner Professionalität - ist für das Leben der anderen nur von partikularer Bedeutung.
Die bisherige Charakterisierung der pädagogischen Profession mag manchen als zu nüchtern und daher unattraktiv erscheinen. Wo bleiben die großen Ideen der Aufklärung, der Emanzipation, wo bleiben Bildungstheorie und anthropologische
214
Besinnung? Wo bleiben die Maßstäbe für ein individuell wie sozial nur partitular zu verstehendes Lernen? Was soll warum und wozu gelernt werden? Faktisch entscheidet sich diese Frage im jeweils konkret vorliegenden Handlungsrahmen, der durch die Faktoren "gesetzliche Rahmenbedingungen", - "Erwartungen des Trägers", "Erwartungen der Partner" - bestimmt ist. In diesem jeweils vorliegenden Handlungsraum fallen die entsprechenden pädagogischen Entscheidungen.
Die Qualität dieser Entscheidungen hängt jedoch erheblich davon ab, welches "Repertoire" an Erfahrungen, Kenntnissen und systematischen Vorstellungen im Kopf des pädagogisch Handelnden dabei mobilisiert werden kann. Was er im Studium - und hoffentlich auch danach! - über Bildungstheorie, Anthropologie usw. lernt, dient nicht unmittelbar seinem späteren pädagogischen Handeln, sondern nur mittelbar, insofern es in sein Erfahrungs-Repertoire eingegangen ist. Nichts spricht also weiterhin gegen eine gründliche erziehungswissenschaftliche Ausbildung, allerdings wäre die Seite der "kulturellen Kompetenz" in Zukunft besser zu beachten.
Andererseits vermag die Beschränkung auf die Funktion des Lernhelfers der pädagogischen Profession eine neue Fundierung zu geben, die auch kritisch gegen die jeweiligen Berufsbedingungen eingesetzt werden kann. Wie sind die heute in der Schule oder im Jugendgefängnis vorhandenen Lernbedingungen zu beurteilen? "Kritische" Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft könnte von der inneren Logik des pädagogischen Berufsverständnisses ausgehen und wäre von daher viel wirksamer öffentlich zu vertreten, als wenn sie in Form von interpretatorischen Verallgemeinerungen dem jeweiligen pädagogischen Handeln faktisch vorgegeben werden. Der präzise Nachweis etwa, daß in unseren Jugendgefängnissen nicht gelernt werden kann, was dort eigentlich gelernt werden müßte, ist jedenfalls "kritischer" als zum Beispiel das allgemeine Räsonieren über die angebliche Kinder- und Jugendfeindlichkeit unserer Gesellschaft.
13. Unsere Skizze müßte eigentlich schließen mit Erörterungen über den "pädagogischen Bezug". Wie ist das professionelle "pädagogische Verhältnis" zu beschreiben? Angesichts der Beliebtheit der "Beziehungsarbeit" wäre eine Klarstellung sogar von besonders aktuellem Interesse, abgesehen davon, daß auch die erziehungswissenschaftliche Literatur dazu wenig Befriedigendes hergibt. Aber das würde den Rahmen vollends sprengen und muß einer anderen Gelegenheit vorbehalten bleiben. Deshalb hier nur soviel: Jede professionelle Beziehung zwischen Menschen ist eine partikulare und muß schon deshalb auf einer gewissen Distanz beruhen. Auch professionelle pädagogische Beziehungen - also Lernbeziehungen - muß man ohne allzu großen "menschlichen Verschleiß" eingehen und wieder verlassen können. Gerade die professionelle Distanz ermöglicht angenehme "menschliche Töne": Freundlichkeit, Humor, Charme, Aufmerksamkeit, Höflichkeit, Respekt. Wer sein berechtigtes Bedürfnis nach befriedigenden Basisbeziehungen auf die professionelle pädagogische Beziehung überträgt oder gar verlagert, wird beides nicht finden: keine befriedigenden Basisbeziehungen und keine befriedigenden beruflichen Beziehungen. Die Erwartung von "Nähe" am falschen sozialen Ort erhöht keineswegs die "Menschlichkeit" des Lebens.

148. Jugendarbeit als Kulturpädagogik (1986)
(In: deutsche jugend, H. 7-8/1986, S. 297-303)
Der folgende Text ist die leicht veränderte Fassung eines Vortrags, den der Verfasser am 1. 11. 1985 auf der Fachtagung "Kinder- und Jugendkultur" in München gehalten hat.
Jugendarbeit war von Anfang an, also seit dem Auftauchen des Wandervogels, ein Teil des Freizeitsystems der Gesellschaft und insofern des kulturellen Systems. Was immer man in der Jugendarbeit tat - ob wir nun die Jugendbewegungen oder die Jugendpflege im Blick haben - war also kulturelle Tätigkeit. Dies kann man nur dann leugnen, wenn man den Begriff "Kultur" eng faßt, elitär begrenzt, etwa im Sinne des traditionellen Bildungsbegriffs, um das damit Gemeinte abzusetzen von etwas, was man anders bewertet haben möchte und was man meist abschätzig "Zivilisation" nannte.
Heinrich Böll ja, Lore-Roman nein; Bach, Händel und Strawinsky ja, Elvis Presley und die Beatles nein; Schach ja, Skat nein. Hier deutet sich das Problem der ästhetischen Qualität an, das ich aber nicht aufgreifen möchte, zumal ich mich dafür nicht kompetent fühle. Pädagogisch bedeutsam war und ist dieses Problem der unterschiedlichen ästhetischen Qualität im Hinblick auf die Frage, ob man von der einen Ebene einen Zugang zur anderen finden kann: Führt ein Weg vom Lore-Roman zu Heinrich Böll? Von den Beatles zu Bach? Kann man da anknüpfen, etwa nach dem alten Grundsatz, man solle dort anfangen, wo der Jugendliche steht? Die mir bekannten pädagogischen Erfahrungen sprechen eher gegen diesen didaktischen Weg. Wer zum Lore-Roman greift und nicht gleich zur sogenannten seriösen Literatur, hat dafür seine Gründe. "Unterhaltung" ist eben eine subjektive Kategorie, abgesehen davon, daß es Menschen gibt, die beides gerne lesen.
Ich möchte hier also keinen elitären Begriff von "Kultur" zugrunde legen, vielmehr das, was früher wie heute in der Jugendarbeit geschieht, "kulturelle Tätigkeit" im Rahmen der gesamten Freizeitkultur nennen: "Kultur" im umfassenden Sinne der menschlichen Gestaltung der Wirklichkeit, als Gegenbegriff zur Natur. Kulturpädagogik ist dann der professionelle, also methodisch geplante Versuch, anderen dazu zu verhelfen, kulturelle Tätigkeiten und Fähigkeiten zu lernen.
Das Wort "Kulturarbeit" dagegen hat für mich einen problematischen Klang; da assoziiere ich Hitlerjugend oder die Grenzlandarbeit bündi-
297
scher Gruppen oder von Teilen der Jugendmusikbewegung. "Kulturarbeit" ist die Instrumentalisierung kultureller Tätigkeit, die Manipulation ihrer Themen und Gegenstände: gemeinsames Singen, weil es das Gemeinschaftsgefühl weckt oder stärkt oder weil es das Deutschtum erlebbar macht.
Und schon befinden wir uns mitten in pädagogischen Verwicklungen; denn gerade in der außerschulischen Pädagogik ist bis heute die Denk- und Handlungsfigur weit verbreitet: der andere soll "a" tun, damit dadurch das Ziel "b" erreicht wird. Ich erinnere mich sehr gut aus meiner aktiven Zeit in der Jugendarbeit daran, daß mir dies auf die Nerven ging: Man sollte zum Beispiel immer etwas tun, damit es den Gruppengeist stärkte; das kulturelle Interesse selbst, das Interesse an der Sache, war verdächtig. Beispielhaft dafür war und ist noch weitgehend der Umgang mit dem Film. Weder die Schulpädagogik noch die Jugendarbeit haben jemals den Film als ästhetisches Phänomen, als eine eigentümliche künstlerische Aussageform ernst genommen. In der Jugendarbeit war der Film, solange er Jugendliche interessierte, also vor der Verbreitung des Fernsehens, lediglich "Gruppenfutter". Hauptsache, die Leute redeten hinterher gemeinsam darüber.
Mag sein, daß der Begriff "Kulturarbeit" schwer durch einen anderen zu ersetzen ist, aber dann sollte man seine problematischen Implikationen im Gedächtnis behalten. Welche Art von Kultur also vertrat die Jugendarbeit und wie verhielt sie sich zu ihrer kulturellen Umwelt? Dazu einige knappe historische Skizzen, die aber nur für die normale, alltägliche Jugendarbeit gelten können, nicht für intellektuell und künstlerisch engagierte Minderheiten, die es auch gab.
Die verschwundene Teilkultur der Jugendbewegung:
Die bürgerliche Jugendbewegung schon vor dem Ersten Weltkrieg entwickelte bekanntlich eine eigentümliche Freizeitteilkultur, die dann von der Jugendpflege unter dem Stichwort "das Jugendgemäße" im Kern übernommen wurde.
Zentrum dieser Kultur war die Gemeinschaft Gleichaltriger - zunächst nach Geschlechtern getrennt - , also eine Freizeitgruppe. die sich regelmäßig am Heimatort traf und deren Erlebnishöhepunkt die Wanderfahrt war. Um dieses Erlebniszentrum herum gruppierten sich dann die eigentümlichen kulturellen Tätigkeiten: Liedgut, Tänze, Kleidung, Sprache usw.
Der Begriff des "Jugendgemäßen" ist nicht leicht zu definieren, weil er nicht nur rationale, sondern auch emotionale Elemente enthält. Die Vorstellung war, daß Jugendliche - biologisch-kulturell bedingt - noch kein Interesse daran haben, einfach an der Erwachsenenkultur teilzunehmen, sondern eine eigene, auf die Gleichaltrigen zentrierte kulturelle Umgebung benötigen bzw. wünschen, die etwa durch Nähe zur Natur, Distanz zur komplexen Zivilisation, die Suche nach ganzheitlichem Erleben in reduzierten Sozialformen (Kleingruppen) und sexuelle Enthaltsamkeit bestimmt war.
Im wesentlichen erhielt sich diese Teilkultur bis etwa Mitte der fünfziger Jahre, um dann sehr schnell in die Defensive zu geraten gegenüber den von den USA herüberkommenden. speziell für Jugendliche konzipierten Freizeitangeboten, repräsentiert etwa durch den Rock'n Roll, aber auch durch relativ preisgünstige jugendtouristische Urlaubsangebote. Inzwischen ist diese Teilkultur verschwunden - ein Schicksal, das sie mit allen traditionellen kulturellen Milieus oder Teilmilieus teilt, die von der universellen Kultur der Massenmedien aufgesogen worden sind, und daran ändert sich auch nichts, wenn nun ein neues Interesse für "Fahrt und Lager" und für entsprechende Formen des Erlebnisurlaubs entstehen sollte. Diese Kultur des "Jugendgemäßen" war nämlich gebunden an eine ganz bestimmte sozio-kulturelle Situation des deutschen Bürger- und Kleinbürgertums: an die tiefe Identitätskrise nach dem Zusammenbruch der Wilhelminischen Gesellschaft und dem verlorenen Ersten Weltkrieg. Es gab ja auch noch andere Bewegungen, die in diesen Zusammenhang gehören: die Lebensreformbewegungen, die reformpädagogische Bewegung, die Volksbildungsbewegung usw.
298
Bewußt inszenierte Teilkulturen sind immer der Versuch, durch Abgrenzung und damit durch das Ausschließen einer Fülle anderer Möglichkeiten Identität zu gewinnen. Der kulturelle und normative Pluralismus gerade nach dem Ersten Weltkrieg war dem Bürgertum ungewohnt und deshalb schwer erträglich. Daher war die teilkulturelle Abgrenzung der Jugendkultur auch für Erwachsene eine Möglichkeit. Komplexität zu reduzieren, sozusagen Ordnung in die Unordnung zu bringen, in der man sich - den Blick rückwärts gewandt - wieder zu Hause fühlen konnte. Heute, im Zeitalter der Massenmedien, sind solche teilkulturellen Abgrenzungen kaum mehr möglich, weil sie schnell publiziert und integriert werden. Punks und Skins sind bald nichts Besonderes mehr, sondern werden zum Beispiel von der Mode vereinnahmt. In dem Maße allerdings, wie solche Abgrenzungsmöglichkeiten entfallen, wird es auch schwieriger, Ordnung in die Unbegrenztheit von kulturellen und damit überhaupt von Lebensmöglichkeiten zu bringen. Man muß das wissen, wenn man jugendliche Teilkulturen, zum Beispiel Rocker, "verbürgerlichen" will.
Man versteht die gegenwärtigen Phänomene jugendlicher Teilkulturen nicht, wenn man sie nicht als kollektive, gruppenhafte Identifikationsversuche deutet. Wir alle brauchen die Fähigkeit, uns abzugrenzen angesichts der Fülle der Möglichkeiten. Niemand kann gesellschaftlich unmittelbar leben, dafür sind die gesellschaftlichen Horizonte zu unklar, zu beliebig. Die Entfremdung und Kälte im gesellschaftlichen Leben, über die heute so viel geklagt wird, hängt damit zusammen: Sie resultiert nicht - wie oft falsch behauptet wird - aus den Zwängen der Gesellschaft, sondern im Gegenteil aus ihrer Unbestimmtheit, Beliebigkeit, Unverbindlichkeit. Wem es nicht gelingt, in menschlich-verbindlichen Basisbeziehungen zu leben und das Reich der Optionen durch Abgrenzungsentscheidungen zu einem bearbeitungsfähigen Lebensfeld zu machen, der bleibt dieser Kälte und Entfremdung ausgesetzt. Die Hoffnung andererseits, die Gesellschaft im ganzen könne wie solche intimen Basisstrukturen organisiert werden, so daß sie im ganzen gleichsam warmherzig wird, ist nicht nur illusionär, sondern auch politisch reaktionär, weil diese Kälte und Entfremdung der notwendige Preis der Freiheit ist. Auch die Kulturpädagogik darf hier keine falschen Versprechungen machen.
In welchem Maße sind Jugendkulturen jugendlich?
Von den Jugendlichen getragen waren immer nur die unmittelbaren kulturellen Tätigkeiten in ihren Gruppen. Die Wortführer der Jugendkultur gegenüber der Öffentlichkeit aber waren Erwachsene, die schon auf dem Hohen Meißner das Sagen hatten und selbstverständlich auch die berühmt gewordene Formel erfanden. Wenn wir von der Kultur der Jugendarbeit sprechen, sprechen wir im Grunde über Erwachsene. Hans Breuer war schon Student, als er 1909 die Volksliedersammlung "Zupfgeigenhansl" herausgab und damit das alte Volkslied weit über die Jugendbewegung hinaus populär machte. Die Geschichte zumindest dieses Jahrhunderts lehrt uns, daß Jugend als Altersgruppe nicht selbst kulturschöpferisch ist, sondern nur einen besonderen - kommerziellen oder ideellen - Markt für Kulturambitionen Erwachsener darstellt. Ich sage dies, damit sich an dem Begriff der "Jugendkultur" keine falschen pädagogischen Hoffnungen festsetzen. Jugendkulturen sind Krücken der Identitätsfindung, keine für die Gesamtkultur schöpferischen Potentiale. Das schließt natürlich nicht aus, daß aus solchen Subkulturen schöpferische Persönlichkeiten hervorgehen können.
Die Jugendarbeit war immer eine Gegen-Kultur gegen die offizielle Kultur der Erwachsenen, und zwar sowohl gegen die Produkte des Freizeitmarktes (Schlager, Schund- und Schmutzliteratur, Film) wie gegen die Zeitströmungen von Literatur, Kunst und Musik. Jugendbewegung und Jugendarbeit haben kaum den Zugang zur zeitgenössischen Kunst, Musik und Literatur gesucht. Sie galt und gilt bis heute als Ausdruck jener Entfremdung und Disharmonie, der man ja gerade entgehen wollte.
Besonders interessant in diesem Zusammenhang ist die Rolle der schon erwähnten Jugend-
299
musikbewegung (1), deren führende Köpfe Fritz Jöde, Georg Götsch und Walter Hensel waren. Sie wandten sich ausdrücklich gegen den artifiziellen Konzertbetrieb, der hochspezialisierte Musiker vom Publikum trennt, und suchten gemeinschaftsstiftende Formen des Musizierens, die sie im Repertoire der vorbürgerlichen, vorklassischen Zeit zu finden glaubten, als die Musik angeblich noch an die Zwecke der Gemeinschaft gebunden war. Sie plädierten für eine Musik ohne Solistentum - außer in Gestalt des Vorsängers beziehungsweise Vorspielers, für ein Ernstnehmen der Texte, für den Vorrang des Chores, für die dienende und begleitende Funktion der Instrumente. Das Ganze war eine Gebrauchsmusik für soziale Anlässe, vor allem für die im Jahresverlauf anfallenden Feste. Auch die Eigenproduktionen der Jugendmusikbewegung blieben diesen Prinzipien verhaftet. Kein Wunder, daß die Nazis diese Entwicklung begierig aufgriffen und daß nicht zuletzt deswegen Adorno nach dem 2. Weltkrieg diese Bewegung, als sie sich noch einmal ausbreitete, bissig mit seiner "Kritik des Musikanten" anfeindete (2).
Bemerkenswert am Konzept der Jugendmusikbewegung war unter anderem, daß als "Volkslied" gerade das galt, was das Volk nicht mehr sang; und die Volksmusik, die es in der Weimarer Zeit gab, und die dabei besonders beliebten Instrumente wie Zither, Schifferklavier, Mandoline galten als nicht akzeptabel.
Neben der Jugendmusikbewegung wäre die Laienspielbewegung zu nennen (Rudolf Mirbt, Martin Luserke), die ebenfalls auf vorbürgerliche Formen des Spiels zurückgriff (Hans Sachs) und eine eigene Literatur schuf, deren Themen meist symbolisch oder parabelhaft von Gemeinschaftsereignissen, also von Bewährungssituationen von Gemeinschaften sowie von der Rolle des einzelnen in der Gemeinschaft handelten. Mit diesen "musischen" Bewegungen war ein eigener Markt entstanden, der seine Produzenten zu ernähren vermochte. Aber gegen Ende der fünfziger Jahre verebbten diese Bewegungen des Musischen - in dem Maße, wie die sie tragende Generation abtrat und keine so recht nachfolgte. Die "Musische Bildungsstätte Remscheid", 1968 in "Akademie Remscheid für musische Bildung und Medienerziehung" umbenannt, die ihre Gründung dieser Tradition verdankt, hat sich längst auch den gegenwärtigen Formen der Unterhaltungsmusik, des Films und des Video geöffnet, also die traditionelle Begrenzung des kulturellen Interesses aufgegeben.
Kulturelle Jugendarbeit: Gegen Instrumentalisierungen gefeit?
Der Hinweis auf diese Bewegungen zeigt schon, worum es dieser Jugendkultur ging: ums Selbermachen, Selbstsingen, Selbstspielen, Selbstbasteln, auch wenn die Produkte nicht im entferntesten an die entsprechenden professionellen Qualitäten heranreichen konnten. Der "Laie" wurde entdeckt und aufgewertet (Laienspiel, Laienorchester, Laien-Bildung usw.), nach dem 2. Weltkrieg nannte man das Hobby. Sieht man einmal ab von jener Fixierung auf die problematische Gemeinschaft, als Sehnsucht nach jener vormodernen "Volksgemeinschaft", die die Nazis ja dann so erfolgreich zu realisieren schienen, so kann man sagen, daß diese kulturellen Bewegungen dem menschlichen Gesellungsbedürfnis neue und interessante sachliche Anlässe gegeben haben. Ich habe gegen den sozialen Gebrauchswert von Kunst nichts einzuwenden. Erinnert man sich an den Literatur- und Kunstbetrieb vor der "musischen Bewegung" - zum Beispiel an die klavierspielende "höhere Tochter" - so kann man nicht leugnen, daß diese Bewegung durchaus einen Beitrag zur Demokratisierung der Kultur geleistet hat.
Allerdings brachte die Distanz zur zeitgenössischen Kunst, Literatur und Musik auch die Gefahr kultureller Selbstgenügsamkeit für ganze Generationen mit sich. Zu erinnern ist in diesem Zusammenhang an die Zeit des Nationalsozialismus, dessen höchster kultureller Maßstab das sogenannte "gesunde Volksempfinden" war, das auch nach 1945 gerade in der Jugendarbeit noch lange die Szene beherrschte. Die Phase der Jugendarbeit nach 1945 muß man überhaupt als kulturell borniert bezeichnen, wenn man sich klarmacht, was während der Nazizeit alles totgeschwiegen worden war, welcher Nachholbedarf
300
da herrschte. Die westlichen Besatzungsmächte, vor allem die Amerikaner, füllten diese Lücke zwar in den von ihnen eingerichteten Jugend- und Kulturhäusern, aber diese Impulse verschwanden wieder, sobald diese Einrichtungen in deutsche Hände übergingen.
Die kulturelle Vorstellungswelt der Jugendarbeit allgemein und keineswegs nur der HJ war instrumentell. Man ging nicht vom Interesse an einer Sache aus, sondern vom Gruppenerlebnis und suchte die dafür geeigneten Sachen. Dieses organisatorische Grundmodell, Gruppen "als solche" zu bilden und nicht etwa um gemeinsam interessierende Sachen herum, entsprang nicht in erster Linie einem Bedürfnis der Jugendlichen selbst, sondern dem Wunsch der erwachsenen Führer beziehungsweise Funktionäre, möglichst viele Jugendliche für die eigenen Reihen zu "erfassen".
Die frühen Wandervogelgruppen entstanden ja noch spontan: man fand sich zusammen im Grunde über eine gemeinsame Sache. Das änderte sich vor allem nach dem 1. Weltkrieg, von einem bestimmten Organisationsgrad an, also mit dem Aufstieg der Jugendpflege, die die Kultur der Wandervogelgruppen gleichsam "auf Serie legte". Nun erst wurden Gruppen "an und für sich" gebildet in der Hoffnung, daß das "Jugendgemäße" sie schon mit Leben füllen werde. Dieses Prinzip erschwerte natürlich die Realisierung anspruchsvoller, d.h. die Fähigkeiten der Jugendlichen wirklich herausfordernder kultureller Tätigkeiten. Die HJ zum Beispiel, die das Prinzip der Erfassung am konsequentesten bis zur Monopolisierung durchsetzte, mußte ständig "Sondereinheiten" erfinden, um die sachorientierten kulturellen Bedürfnisse von Jugendlichen und auch der HJ selbst befriedigen zu können. Das zeigt übrigens, daß die HJ entgegen ihrer Selbsteinschätzung eine unmoderne Jugendorganisation war, insofern sie das Problem der Freizeit als Bedingung kultureller Entfaltungsmöglichkeiten nicht begriffen hatte.
Die HJ zeigt eindrucksvoll, daß das Organisationsprinzip der möglichst totalen Erfassung immer nur auf Kosten des kulturellen Niveaus und der kulturellen Differenzierung durchzusetzen ist. Deshalb die notorische kulturelle Dürftigkeit der Heimabende und die schon damals vielfach als langweilig empfundene Marschiererei. Nur formalisierte Rituale können zu einer Sache für alle gemacht werden, was sich an jeder Armee studieren läßt.
Umgekehrt: Wer von Sachen beziehungsweise von sachorientierten Interessen ausgeht, kann keine weitreichende Erfassung anstreben. Dieses Problem besteht zum Beispiel für einen großen Teil der Jugendverbandsarbeit bis heute. Ursprünglich hatten die Jugendverbände ihre sachlichen Bezugspunkte, nämlich bestimmte politische oder religiöse Grundpositionen, für die sie Jugendliche warben. Aber schon in der Weimarer Zeit wurden die Verbände mehr oder weniger zu "Freizeitveranstaltern", und inzwischen ist die politische oder weltanschauliche "Sache" kaum mehr Grund für den Mitgliederzugang.
Das Rekrutierungsprinzip der Erfassung einer möglichst großen Zahl im Wettbewerb mit anderen scheint mir der wesentliche Grund dafür zu sein, daß die Jugendarbeit bis heute keinen nennenswerten Beitrag zur Freizeitkultur geleistet hat, wenn man von den Bildungsstätten absieht, ja, nach dem Ende des "Jugendgemäßen" eigentlich kulturell mit leeren Händen dasteht. Kulturelle Aktivitäten junger Menschen finden durchweg außerhalb der Jugendarbeit statt, was sie auch von deren Mitteln und Möglichkeiten abschneidet (Beispiel: Bands, die einen Übungsraum suchen). Erst die offene Jugendarbeit hat da neue Möglichkeiten geschaffen, weil sie von Sachen ausgehen muß, sie muß ja irgend etwas anbieten. Aber auch das geschieht eher halbherzig, wenn mein Eindruck richtig ist. Man weiß nicht so recht, was junge Leute interessieren könnte, und vor allem: unsere Sozialpädagogen sind für solche sachbezogene Arbeit nicht ausgebildet, man müßte auf Nebenamtliche zurückgreifen, und das kostet wieder zusätzlich Geld.
Perspektiven der kulturellen Arbeit
Versuchen wir, diese knappe historische Skizze auf die Gegenwart anzuwenden: Mir scheint,
301
daß der Gedanke des Selbermachens neue Anhänger gefunden hat, vor allem unter den Kollegen. die sich als Kulturpädagogen verstehen. Die Menschen sollen in ihrer Freizeit lernen können, ihre kreativen künstlerischen, handwerklichen und spielerischen Fähigkeiten zu entfalten. Das ist ein sehr guter Gedanke. Aber vielleicht sollte man aus der Geschichte der Jugendarbeit lernen, daß eine kulturelle Tätigkeit, die in ihrem eigenen Milieu verbleibt. die von vornherein sozusagen auf "Sozialhilfe-Niveau" bleibt, erstens bald langweilig wird und zweitens künstlerisch verbilden kann. Die menschlichen Fähigkeiten entfalten sich nur dann, wenn die Ansprüche entsprechend hoch sind. Kulturelle Arbeit mit Jugendlichen darf nicht zur Beschäftigungstherapie verkommen. Jugendliche selbst haben meist ein untrügliches Gefühl dafür. Wer anfängt, Schlagzeug zu spielen, hat dabei seine Vorbilder im Auge, obwohl er meist weiß, daß er sie nie erreichen wird. Er braucht das Vorbild als Lernmotivation, als Anregung zum Weitermachen, aber auch zur realistischen Einschätzung seiner Fähigkeiten. Das muß nicht heißen, daß der Kulturpädagoge entsprechende Forderungen stellen soll, schließlich handelt es sich um Freizeit; und Forderungen kann man hier nur stellen, wenn man einen entsprechenden "pädagogischen Bezug" zu den Partnern hat, daß diese zum Beispiel Forderungen geradezu erwarten. Normalerweise muß man sich wohl auf Anregung und Animation beschränken.
Ferner wäre wohl aus der Geschichte der Jugendarbeit zu lernen, daß kulturpädagogische Animation sich nicht aufs Selbermachen beschränken darf, sondern auch die Partizipation am allgemeinen kulturellen Leben zum Ziel haben, also helfen sollte, entsprechende Barrieren zu überwinden. Drittens schließlich wäre zu lernen, daß im nicht-professionellen Bereich, im Bereich der Laienkultur also, Sachbezogenheit und Geselligkeit nicht zu trennen sind. Erst wenn auch die dabei erlebte Geselligkeit als befriedigend empfunden wird, wird auch die Sache und deren Anspruch akzeptiert.
Zu prüfen wäre vielleicht noch, inwieweit die offene kulturelle Arbeit unbedingt jugendspezifisch bleiben muß und inwieweit sie generationsüberpreifend angeboten werden kann; denn die Separierung der Generationen im gesellschaftlichen Leben ist nicht unproblematisch, und man sollte sich überlegen, ob man sie durch pädagogische Maßnahmen noch verfestigen will.
Erfahrungen, die man mit den sogenannte "Kulturzentren" gemacht hat, zeigen allerdings daß - abgesehen von Arbeitslosen - die erwerbstätigen Generationen dort kaum zu finden sind, wohl aber Senioren. Ferner zeigt sich, wie ich der Untersuchung von Irene Hübner (3) entnehme daß sich generationsübergreifende Projekt kaum ergeben, sondern in der Regel die Alten und die Jungen ihre eigenen "Sachen" machen. Allerdings mag das einerseits an der meist unzulänglichen Ausstattung liegen, andererseits daran, daß solche Einrichtungen noch weitgehend unbekannt und ungewohnt sind, daß zum Beispiel Erwachsene, die dort auf eine größere Zahl von Jugendlichen treffen, sich deplaziert fühlen.
Kulturpädagogik: Weg von der Ideologie der Generationentrennung und hin zur Sachkunde
Unser kleiner historischer Rückblick macht deutlich, daß die Separierung der Generationen zumindest auch das Ergebnis einer institutionellen Verfestigung ist. Die Separierung jugendlicher Gruppen mochte so lange sinnvoll sein, wie deren eigentlicher Inhalt, nämlich "das Jugendgemäße", noch eine kulturell tragende Idee war. Seitdem davon nicht mehr die Rede sein kann, wird generationsspezifische Jugendarbeit zu einer Ideologie. Es gibt sie, weil die Jugendarbeit eben institutionell aufgrund jener Tradition so etabliert ist, für sachorientierte Angebote ist dagegen angeblich die Erwachsenenbildung zuständig.
Geht man von Sachen aus, gibt es keinen Grund mehr für generationsspezifische Angebote, es sei denn in einem sozialpädagogischen Sinne, also im Hinblick auf Randgruppen, die man als defizient definiert oder die sich selbst so verstehen. Defizient heißt hier: nicht in der Lage, an normalen sachbezogenen Tätigkeiten teilzunehmen. Beispiel: Ich kann eine Theatergruppe anbieten, an der unter anderem drogengefähr-
302
dete Jugendliche teilnehmen; das ist Kulturpädagogik beziehungsweise Jugendarbeit. Oder ich kann für drogengefährdete Jugendliche Theaterspielen anbieten, weil es ihnen vielleicht bei der Lösung ihres Suchtproblems hilft; dann betreibe ich Sozialpädagogik, weil hier die Sache zu therapeutischen Zwecken instrumentalisiert wird und der Teilnehmerkreis begrenzt wird nach Kriterien, die mit der Sache bzw. ihrer Zugänglichkeit nichts zu tun haben.
Es könnte sein, daß mit der vermehrten Freizeit, die wir zu erwarten haben, auch die Marktchancen für kultur-pädagogische Angebote steigen, für Lernangebote also. Das System der Massenmedien und der kommerziellen Freizeitangebote ist inzwischen so selbstverständlich geworden, daß es seinen Reiz gerade für jüngere Generationen auch zu verlieren beginnt. Die Chancen für kultur-pädagogische Angebote - ob im künstlerischen, handwerklichen oder spielerischen Bereich - könnten steigen, wenn folgendes zusammentrifft:
Eine Sache, die
1. ein Interesse findet, die
2. einen solch hohen Anspruch ausstrahlt, daß sie Selbstbewußtsein ermöglichen kann, also das Gefühl, wirklich etwas gelernt und geschafft zu haben, was sich vorzeigen läßt. Eine Sache, die
3. eine befriedigende Geselligkeit möglich macht. Eine Sache, die
4. auch ein Publikum findet; das können die jeweils anderen Mitglieder der Gruppe sein; besser noch, wenn das Publikumsinteresse darüber hinausreicht (zumindest Familie, Freunde, Bekannte); denn ohne Publikum, d.h. ohne Urteil und Anerkennung anderer kann kein Selbstbewußtsein entstehen.
Kulturpädagogik hat also die Aufgabe, Menschen kulturelle Fähigkeiten und Tätigkeiten in ihrer Freizeit lernen zu lassen und sie zur Partizipation am kulturellen Leben zu animieren und zu befähigen. Das Spektrum der Inhalte ist dabei grundsätzlich unbegrenzt; jedenfalls sehe ich keinen prinzipiellen Maßstab für irgendwelche Sortierungen, wie sie die bildungsbürgerliche Jugendbewegung und Jugendarbeit noch hatte. Tatsächlich werden die Interessen der Teilnehmer und die Fähigkeiten der Pädagogen die Grenzen setzen; denn die kulturellen Fähigkeiten und Kenntnisse dieser Pädagogen und ihrer ehren- und nebenamtlichen Kollegen, also ihre Sachkunde muß einen ganz anderen Stellenwert haben, als es in der traditionellen Jugendarbeit im allgemeinen üblich war. Es muß sich lohnen, mit und von diesen Menschen etwas zu lernen, sonst gebe ich der neuen Kulturpädagogik allenfalls eine Chance für die Betreuung von Randgruppen, was ja auch nicht unwichtig ist.
Die Kulturpädagogik darf nicht auch den Fehler machen, sich primär von der Beziehungsebene her zu verstehen und die sachbezogene Qualifikation als zweitrangig zu sehen. Wenn sie dieser Versuchung widersteht, wird sie die Erfahrung machen, daß gute menschliche Beziehungen anspruchsvolle gemeinsame Sachen zur Voraussetzung haben; sonst bleibt nur Geschwätz, das weder Selbstbewußtsein noch Selbstwertgefühl stärken kann. Im übrigen hat schon Friedrich Naumann (4) der Sache nach die drei wesentlichen pädagogischen Strategien der Kulturpädagogik als Freizeitpädagogik im Jahr 1890 formuliert (5).
1. Das, was die Menschen sowieso tun, zu verbessern helfen.
2. Das, was die Menschen nicht tun, aber vielleicht tun sollten, ihnen zeigen und vormachen.
3. Die kulturellen Fähigkeiten der Menschen aktiv werden lassen.
303
Anmerkungen:
(1) Vgl. Dorothea Kolland: Die Jugendmusikbewegung. Stuttgart 1979.
(2) Theodor W. Adorno: Kritik des Musikanten. In: Ders.: Dissonanzen. Göttingen 1956, S. 62ff.
(3) Irene Hübner: Kulturzentren. Weinheim 1981.
(4) Friedrich Naumann: Christliche Volkserholungen. Gotha 1890.
(5) Vgl. H. Giesecke: Leben nach der Arbeit. München 1983.
149. Das Ende der Erziehung? (1986)
Über das Verhältnis der Generationen im elektronischen Zeitalter
(In: H. Scarbath/V. Straub (Hrsg.): Die heimlichen Miterzieher. = Publikationen der Katholischen Akademie Hamburg Bd. 5, Hamburg (Katholische Akademie) 1986, S. 59-71)
In der Rede von den "heimlichen Miterziehern" klingt ein Ressentiment an: ein Gefühl der Bedrohung derjenigen, die "eigentlich" für die Erziehung zuständig sind (Eltern, Lehrer) und die in ihren guten Absichten behindert werden von irgendwelchen Mächten, die diesem hehren Ziele entgegenarbeiten. Dieses Ressentiment hat einen guten Grund. Die Massenmedien nämlich haben - mit der Erfindung des Kinos und des Rundfunks beginnend - die Autorität der persönlich verantwortlichen, jeweils zuständigen Erzieher Zug um Zug untergraben. Jedoch wäre es ein oft zu beklagender Fehler, ein Phänomen wie etwa das Fernsehen isoliert zu sehen. Seine Existenz wäre bedeutungslos, wenn die Menschen nicht die Zeit hätten, seine Sendungen zu sehen, und wenn sie nicht das Geld hätten, sich ein Gerät zu kaufen, ohne deshalb am Hungertuche nagen zu müssen. Die kulturelle Revolution, die uns das allmähliche Ende der Erziehung beschert, beruht auf drei Faktoren, die einander bedingen und sich gegenseitig verstärken: Freizeit, Geld und hochwertige Massentechnologie. Der Fehler, die Dinge isoliert zu sehen, wird meist auch im Hinblick auf die Freizeit begangen: Die Menschen haben eben nicht nur einfach Freizeit oder mehr Freizeit, sondern sie haben dabei immer auch eine bestimmte Geldmenge für den Konsum zur Verfügung und sie leben in einer sozialtechnischen Güter-Umwelt. Historisch gesehen bildeten diese drei Faktoren sich nicht unbedingt gleichzeitig heraus. Mit der Verkürzung der Wochenarbeitszeit und dem freien Sonntag und mit den
59
ersten Urlaubstagen begann es, das Freizeitbudget wuchs aber nur langsam an, und Kino und Rundfunk waren zunächst neben der Presse die einzigen massenkommunikativen Angebote. Zu einer "konzertierten Aktion" entwickelten sich die drei Faktoren mit mächtigem Auftrieb in den Jahren des Wirtschaftswunders und danach.
Inzwischen können wir über diesen historisch-kulturellen Prozeß eine für unser Thema interessante Bilanz ziehen.
1. Für die meisten Menschen hört die Arbeit auf, der Mittelpunkt ihres Lebens zu sein. Das gilt auch im moralischen Sinne. Dies hat nachhaltige Konsequenzen für die Erziehung. Wir wurden bisher ja erzogen zu den Tugenden, die für eine erfolgreiche Karriere in der Arbeitswelt gebraucht wurden: Unterordnung, Gehorsam, Sparsamkeit usw. Diese Tugenden galten auch für unser Privatleben ("Kraft durch Freude"). Das Leben in der Freizeit und unter dem Einfluß der Massenmedien ist von den fast gegenteiligen Tugenden bestimmt: Gleichrangigkeit statt Unterordnung; Verständigung statt Gehorsam; auf Kredit leben statt Sparsamkeit üben. Vor allem aber hat sich das gesellschaftliche Zeitverständnis geändert: Die Arbeitsgesellschaft war zukunftsorientiert, die mediale Freizeitgesellschaft ist gegenwartsorientiert. Zukunft aber war der Legitimationsgrund für Erziehung: Das Kind sollte ordentlich, fleißig und ein möglichst guter Schüler sein, damit es eine gute Zukunft hat. Diese Legitimation von Erziehung, im Sinne einer persönlichen Verantwortung von Eltern und Lehrern für die Zukunft des Kindes, woraus sich dann im einzelnen erzieherische Handlungen ergaben, wird immer unrealistischer. Das belegt auch die jüngste Shell-Jugendstudie. Pädagogik in der Familie reduziert sich auf den unmittelbaren, jeweils gegenwärtigen
60
Umgang zwischen den Generationen, nimmt also den Charakter von naturwüchsiger Sozialisation an
Sieht man sich den Umgang der Generationen in normalen Familien an, so ist der Druck auf die Schulleistungen der Kinder fast das einzige, was von Erziehung noch übriggeblieben ist. Die meisten Ärgernisse mit Kindern erwachsen schlicht aus dem Zusammenleben - falls wir nicht "Erziehung'' nennen wollen, wenn die Erwachsenen ihre eigenen Beziehungsprobleme als sogenannte "erzieherische Maßnahmen" auf die Kinder abwälzen, was bekanntlich bis zur regelmäßigen Kindesmißhandlung gehen kann. Mit dem "Entschwinden der Arbeitsgesellschaft" (Dahrendorf) entschwindet auch "Zukunft" als leitende Zeitperspektive und damit die überlieferte Legitimation von Erziehung.
2. Die Freizeit der arbeitenden Bevölkerung ermöglichte ihr erst die Erfahrung von politischem und normativem Pluralismus. Diese Erfahrung, daß man die Grundfragen des Lebens sehr unterschiedlich interpretieren und sein Verhalten entsprechend regulieren kann, zerstörte die Selbstverständlichkeit des jeweils eigenen kulturellen Milieus (Bildungsbürgertum, Katholizismus, Protestantismus mit seinen Variationen, sozialistische Arbeiterbewegung). Es ist eindrucksvoll zu sehen, wie zum Beispiel das katholische Milieu in der Weimarer Zeit versuchte, durch eigene Bibliotheken und durch ein sehr differenziertes Publikationswesen die eigenen Schäflein bei der Stange zu halten. Aber die Erfindung des Kinos und des Rundfunks waren milieuübergreifend, um nicht zu sagen: an jedem besonderen Milieu desinteressiert. In der Freizeit und durch die modernen Medien transportiert vollzieht sich die Fundamentaldemokratisierung der Gesellschaft. Die Zerstörung der Milieus aber nimmt der Erziehung jene
61
normativen Horizonte, die sie notwendigerweise braucht. Was übrigbleibt, sind Legitimationsstreitigkeiten. Mit welchem Recht will man die Kinder nicht sein lassen, wie sie sind? Die Kämpfer für die Konfessionsschule hatten ihre Gründe, aber die Konfessionsschule wurde nicht im politischen Kampf abgeschafft, obwohl es ihn jahrzehntelang gegeben hat, sie hörte irgendwann einfach auf zu existieren.
Der im Alltag erfahrbare normative Pluralismus, der vom Fernsehen täglich in jede Wohnstube transportiert wurde, hatte sie einfach gegenstandslos gemacht. Mit dem Ende der Konfessionsschule war übrigens auch das Ende der staatlichen Erziehungsschule überhaupt gekommen, nur wissen das unsere Kultusminister offensichtlich noch nicht. Was sie in ihren Erlassen Erziehung nennen, ist nichts weiter als die Hoffnung, daß die Schüler bestimmte, ihnen, den Politikern, genehme Einsichten haben werden, aber die Gedanken sind bekanntlich frei und das abendliche Fernsehen bringt ohnehin die Alternativen. Was das Verhalten der Schüler angeht, so darf der Staat nur das für die Realisierung von Unterricht nötige Verhalten (zum Beispiel Disziplin) erwarten, alles andere geht ihn nichts an. Die Zensuren für Fleiß, Ordnung, Betragen sind längst abgeschafft, ebenso Auflagen der Schule für das Benehmen in der Freizeit. Ich gestehe, daß ich diesen Prozeß begrüße, weil ich ihn für ein überfälliges Stück der Demokratisierung halte. Demokratische Institutionen dürfen immer nur partikulare Ansprüche an die Bürger stellen. "Erziehung" aber ist unstreitig kein partikularer, sondern ein ganzheitlicher Anspruch, und hat als solcher in keiner öffentlichen Institution etwas zu suchen, es sei denn, man kann sie wie im Falle einer Konfessionsschule wählen. Dieses Problem ist so lange nicht aufgefallen, wie die staatliche Administration die Schule als pädagogischen
62
Schonraum schützte, in das pädagogische Handeln aber nicht weiter eingriff, diesem vielmehr seine eigene Dignität gestattete. In dem Maße jedoch, wie dieser Schonraum verrechtlicht und somit zerstört wurde, muß sich die Administration nun an das Prinzip der Partikularität halten, das übrigens nur an Unterricht gebunden werden kann und zum Beispiel nicht an irgendwelche "sozialen Lernziele", die nicht notwendigerweise aus dem Unterricht sich ergeben.
3. Erziehung setzt Zeit voraus. Die Arbeiterklasse bekam diese Zeit erst in dem Maße, wie sie Freizeit erhielt, also relativ spät. Freizeit ermöglicht also erst Erziehung, aber sie schafft sie auch in dem Maße ab, wie der in ihr wirkende Marktmechanismus der Freizeitindustrie und der durchs Fernsehen verbreitete Pluralismus die alten Erziehungsmächte entmachtete (Familie, Schule, Kirche). Erziehung setzt immer voraus, daß die persönlich zuständigen Erzieher sich der Rückendeckung der anderen Sozialisationsfaktoren sicher sein konnten. Der Markt jedoch, der im Freizeitbereich entstand und für den hier das Beispiel des Films stehen mag, gehorchte ganz anderen Regeln als denen der Erziehung. Zwar hat man schon in der Weimarer Zeit versucht, die Einflüsse des Freizeitmarktes auf Heranwachsende durch Jugendschutz zu begrenzen. Aber für einen damaligen Arbeiterjugendlichen muß es eine wahre Wohltat gewesen sein, seiner autoritären Familie, Schule oder seinem Lehrmeister mit der Freundin ins Kino zu entrinnen, egal, was für ein "Schmarren" dort lief. Der Freizeitmarkt und wieder vor allem das Fernsehen als dessen Vermittler haben den Lehrern und Pfarrern ihr Informationsmonopol entrissen, und das hat bis heute tiefe Kränkungen und Ressentiments hinterlassen. Was ist schon eine didaktisch akrobatisch und wichtigtuerisch
63
aufgeputzte Politikunterrichtsstunde gegen einen einzigen Magazinbeitrag von Monitor oder Panorama zum selben Thema? Wäre es nicht die wichtigste Aufgabe des politischen Unterrichts - jedenfalls für die Sekundarstufe I -, solche politische Publizistik verstehen zu lernen? Muß das zum Beispiel für Hauptschüler wirklich über das gedruckte Wort gehen? Kann man nicht wenigstens mal versuchen, den politischen Unterricht mit solchen Sendungen zu bestreiten? Ein anderes Beispiel: Erich Weniger hat noch nach dem Zweiten Weltkrieg den Geschichtsunterricht in der Schule damit begründet, daß hier der Staat seine Ansprüche an die junge Generation formuliere; die Jungen sollen durch Vergegenwärtigung der Vergangenheit des Volkes die Perspektiven ihrer künftigen politischen Verantwortung entdecken. Heute erscheinen unser Kanzler und andere führende Repräsentanten des Staates jeden Abend auf dem Bildschirm und teilen uns mit, welche Probleme unser Volk hat und wie sie sie zu lösen gedenken, und dazu braucht man offensichtlich nur Machtchancen, aber kaum historisches Bewußtsein. Diese Beispiele zeigen, daß unsere Schulpädagogik nie versucht hat, bei der Festsetzung der Schulziele die übrigen Sozialisationsfaktoren zu berücksichtigen; sie ging einfach davon aus, daß die Schule der einzig nennenswerte öffentliche Erziehungsfaktor sei, alles andere behindere nur die schulische Arbeit ("Miterzieher").
4. Fernsehen und Freizeitmarkt haben alle überlieferten Bildungsprivilegien zerstört oder zumindest erheblich relativiert. Daher rührt die jahrzehntelange Kritik des Bildungsbürgertums am Freizeitleben der Menschen und an ihrem Umgang mit den Massenmedien. Solange Bildung in den Schulen monopolisiert wurde, schuf sie Privilegien. Das Fernsehen und auch die anderen Massenmedien ha-
64
ben nicht nur die Informationsmonopole gebrochen, ohne die propagierende Wirkung des Fernsehens wäre die Bildungsreform der 70er Jahre gar nicht möglich gewesen. Die Kritiker des Fernsehens, die durch Postmans neues Buch erneut Auftrieb bekommen haben, vergessen zu leicht, daß das am geschriebenen Wort orientierte Bildungsbürgertum immer eine Minderheit war. Das Fernsehen hat die Chance vergrößert, zu dieser Minderheit zu stoßen, aber man kann ihm nicht anlasten, daß nun nicht alle Jugendlichen studierfähig werden. Nicht zuletzt das Fernsehen hat eine jedermann zugängliche Informationslage geschaffen, so daß jeder nach Lage seiner Fähigkeiten und Möglichkeiten seinen gesellschaftlichen Status selbst schaffen muß. Wer in meinem Alter ist und zudem wie ich aus dem Arbeitermilieu kommt und noch als junger Erwachsener das Fernsehen nicht kannte, der möge einmal den Informationsstand seiner Kinder mit dem seiner eigenen Jugend vergleichen! Gerade die Menschen aus den unteren Schichten haben heute in allen sie betreffenden Alltagsfragen (Politik, Konsum, Erziehung) einen Informationsstand erreicht, der für die Generation unserer Eltern noch undenkbar war. Diese Hebung des allgemeinen Niveaus fällt uns nur im Alltag nicht mehr auf.
Allerdings spreche ich vom Fernsehen so wie wir es bisher hatten. Postman hat aus den USA wohl andere Erfahrungen, und ich halte es schon für sehr wichtig, daß wir der Kommerzialisierung der Informationsmedien kritisch gegenüberstehen. Dennoch bleibe ich dabei, daß das Fernsehen und die anderen neuen Technologien nichts als eine Möglichkeit sind, die wir so oder so nützen können, zur Bildung, zur Unterhaltung oder auch zur Kompensation oder gar als Sucht. Und ich sehe nicht ein, wieso meine Menschlichkeit darunter leiden soll, wenn ich demnächst vieles vom häuslichen Computer aus erledigen kann, wo-
65
zu ich heute noch viele Wege gehe und deshalb Zeit opfern muß. Dieser Optimismus gilt allerdings nur unter zwei Voraussetzungen, von denen eine mit den neuen Medien zu tun hat, die andere nicht.
Jeder Mensch braucht erstens eine befriedigende Tätigkeit, was nicht unbedingt Arbeit im herkömmlichen Sinne heißen muß, und jeder Mensch braucht zweitens verläßliche und befriedigende menschliche Basisbeziehungen, also eine verläßliche Basissozialität. Die radikalen Selbstverwirklicher dürfen sich nicht wundern, wenn sie die Wärme, die sie an ihrer Lebensbasis nicht suchen wollen und nicht finden können, in der kalten Mediengesellschaft auch nicht finden. Unsere Gremien in Schulen und Hochschulen sind inzwischen voll von Menschen, die den Eindruck erwecken, als ob zu Hause niemand ihnen zuhören wolle, und die mit diesem Mangel jede Sachlichkeit behindern. Ich habe die Vermutung, daß das, was ich in meinem Buch "Das Ende der Erziehung" als "Pädagogisierung" der Gesamtgesellschaft kritisiert habe, im wesentlichen von Menschen getragen wird, die zwischen Privatheit und Öffentlichkeit nicht mehr unterscheiden wollen oder können.
Aber kehren wir zurück zum Problem der Erziehung: Ich habe bisher die pädagogische Bedeutung der modernen Medien im Rahmen der Freizeit- und Konsumgesellschaft eher positiv gedeutet. Aber man muß auch die Preise dafür sehen. Die Prozesse, die ich beschrieben habe - Entschwinden der Arbeit und damit der Zeitkategorie Zukunft; die Durchsetzung des normativen Pluralismus und damit die Zerstörung der alten kulturellen Milieus; die Entmachtung der Erziehungsmächte und die Zerstörung von Bildungsprivilegien - haben eine eigentümliche Leere, nämlich soziale Desorientierung hinterlassen. Das Fehlen von sozialen Bindungen, die Möglichkeit, ihnen ständig
66
auszuweichen, haben ein befriedigendes Heranwachsen zusätzlich problematisch gemacht. Soziale Bindungslosigkeit ist der Ursprung von Verwahrlosung, und die Jugendgefährdung geht heute nicht vom Fernsehen und nicht vom Gewalt-Video, sondern von den Gleichaltrigengruppen aus, die den Zugang zu Drogen, zum Neofaschismus, zur Jugendsekte usw. an sozial wenig kontrollierten Orten eröffnen. Die Anforderungen, die heute an die Selbstverantwortungsfähigkeit von Jugendlichen gestellt werden, sind eben wegen des Fehlens kultureller Selbstverständlichkeiten und Vorgaben enorm hoch geworden. Und nicht wenige suchen diesem Druck durch Flucht in eine Szene, ja sogar durch Unterwerfung unter ein Gruppenkollektiv zu entfliehen. Aber gerade bei diesem Problem haben die Massenmedien eine wichtige Funktion, indem sie nämlich Identitätskrücken anbieten - Identifikationen mit bestimmter Musik, mit bestimmten Stars, gelegentlich auch mit bestimmten Politikern, und wir Erwachsenen sollten mit solchen Versuchen sehr behutsam umgehen. Wenn wir ehrlich sind, identifizieren wir uns auch mit Gesichtern aus dem Fernsehen, und zwar aus ähnlichen Gründen wie die Jugendlichen. Mich interessieren zum Beispiel die großen Journalisten des Fernsehens, deren Texte ich natürlich auch lese, aber die auf dem Bildschirm ganz anders wirken. Und von der Didaktik des Journalismus, die es eigentlich gar nicht gibt, jedenfalls nicht als offizielle Theorie, können unsere Schuldidaktiker viel lernen.
Nach meinen Beobachtungen selektieren die Menschen je nach Alter und Bildungsstand sich das aus dem Fernsehen was sie brauchen. Was in ihrer alltäglichen Sozialität nicht kommunizierbar ist, womit man sich also den anderen gegenüber nicht präsentieren kann, meiden sie. Dies zeigt doch aber nur, daß die unmittelbaren Sozialitäten, in de-
67
nen die Menschen leben, ihnen wichtiger sind, als das Programmangebot des Fernsehens im ganzen. Und wer sich dabei über das Niveau lustig macht, müßte begreifen, daß er sich damit auch über die wie immer zerbrechliche Identität dieser Menschen lustig macht. Kein Mensch tut das, was er tut, ohne einen wichtigen Grund. Und die Vielseher unter den Jugendlichen - und übrigens auch unter den Senioren - hat das Fernsehen nicht verursacht, es bietet sich lediglich als Kompensation an, und da gibt es wirklich schlimmere.
Was bleibt also von Erziehung? Abgesehen von den ersten Lebensjahren werden die Chancen für Erziehung immer geringer, wenn man darunter versteht, Kinder in Verantwortung für deren Zukunft zu einem bestimmten Denken und Verhalten zu bewegen. Was wir heute Erziehung nennen, ist in Wahrheit meist Sozialisation, erwächst zum Beispiel aus dem Zusammenleben in der Familie. Haben wir bisher geglaubt, Erziehung sei deshalb so wichtig, weil sonst aus dem Neugeborenen kein richtiger Mensch werden könne, so müssen wir nun einsehen, daß das Kind sich selbst zum Menschen macht, daß es dafür aber unendlich viel lernen muß, und daß es viele Menschen braucht, von und mit denen es lernen kann. Das "Ende der Erziehung" eröffnet neue Chancen des Umgangs zwischen den Generationen, weil die verkrampfte Verantwortlichkeit für die Zukunft des Kindes sich erheblich reduziert hat. Versäumte Schulabschlüsse kann man heute müheloser nachholen als je zuvor, und die neuen Medien werden das weiter vereinfachen. Die Familie kann die Gegenwärtigkeit des Zusammenlebens mit Kindern viel ernster nehmen als früher und damit viel lebendiger werden, denn Leben ist ja zunächst einmal Gegenwart. Anteilnahme am Leben der Kinder, Ermutigung, Unterstützung, aber auch Grenzen setzen - Grundsätze, die einem aufgeklär-
68
ten Begriff von Erziehung schon immer eigen waren - können nun zur Geltung kommen, ohne allzu sehr mit Sanktionen im Namen der Zukunft belastet werden zu müssen. Wir können unsere Kinder immer mehr so behandeln, wie wir unseren erwachsenen Partner sinngemäß auch behandeln; die alte, durch die Notwendigkeit von Erziehung geschaffene Differenz zwischen den Generationen verschwindet allmählich. Die Verantwortung aber - und das ist das neue, ja zentrale pädagogische Problem - , die früher die zuständigen Erwachsenen für die Zukunft der Kinder übernahmen, ist nun nicht etwa verschwunden, sondern fällt - wenn auch abgestuft - den Kindern frühzeitig selbst zu. Dies von ihnen im konkreten, gegenwärtigen Alltag zu verlangen, aber auch ihnen dabei zu helfen, ist die zentrale pädagogische Aufgabe heute und morgen.
Nicht die neuen Medien gefährden das Heranwachsen unserer Kinder, sondern ihre Pädagogisierung in Familie und Schule, die sie viel zu lange daran hindert, ihr Leben und ihre Zukunft selbst zu verantworten.
Spätestens an dieser Stelle wird der Vorwurf laut, man wolle sich vor der Verantwortung drücken und sie den Kindern aufhalsen. Verantwortung hat man aber nur insofern, als man durch sein Handeln auch etwas bewirken kann. Im Hinblick auf die Zukunft der Kinder können wir argumentieren, ermutigen, auch kritisieren und je nach Alter auch stellvertretende Entscheidungen auf Probe treffen ("Du gehst jetzt aufs Gymnasium, und dann sehen wir weiter"), aber da wir den Kindern keinen abgeschirmten Schonraum mehr arrangieren können, den wir nach pädagogischen Gesichtspunkten einrichten, befinden wir uns mit unserer Verantwortung immer in Konkurrenz mit anderen Sozialisationsfaktoren, vor allem mit den Gleichaltrigen und mit den Massenmedien. Die Verantwortung
69
für das Ergebnis können wir also gar nicht übernehmen, wir können nur versuchen, Einfluß zu nehmen.
Anders steht es mit der Verantwortung, wenn wir an die jeweilige Gegenwart denken. Wir sind verantwortlich für einen anderen Menschen, insofern dieser - aus welchen Gründen auch immer - die Verantwortung für sich selbst augenblicklich nicht übernehmen kann. Der Betrunkene, der sich ans Steuer setzen will, der Verletzte oder Erkrankte, der nicht selbst den Arzt rufen kann, das Kind, das eine unmittelbare Gefahr nicht zu erkennen vermag, sind Beispiele. Aber dieser Begriff von Verantwortung ist erstens wechselseitig und zweitens nicht auf den Umgang mit Kindern begrenzt. In einer Familie zum Beispiel sind nicht nur die Eltern dafür verantwortlich, daß es den Kindern gut geht, sondern umgekehrt sind die Kinder je nach Alter und ihren Fähigkeiten dafür verantwortlich, daß die Eltern sich wohlfühlen können. Wer hier pädagogisiert, gibt die Wechselseitigkeit auf. Entsprechende Forderungen an Kinder nenne ich trotzdem nicht Erziehung, sondern Sozialisation, weil die Rechtfertigung dafür nicht aus der Zukunft der Kinder erwächst, sondern aus der Qualität des jeweiligen gegenwärtigen Zusammenlebens. Nur so, im Hinblick auf die Qualität des Zusammenlebens, kann man dem Kind solche Forderungen begründen. Ähnlich verhält es sich mit einer anderen Forderung: daß das Kind das, was es schon kann, auch selbst tun muß. Das Kind muß für lange Zeit von anderer Leute Arbeit leben. Das ist Teil des sogenannten "Generationsvertrages" und insoweit in Ordnung. Aber auch dieser Vertrag ist wechselseitig. Indem das Kind - zum Beispiel in der Schule - seine Fähigkeiten entwickelt, qualifiziert es sich dafür, in angemessener Zeit seinen Lebensunterhalt selbst zu beschaffen (deshalb ist übrigens Jugendarbeitslosigkeit so schlimm. weil sie die jungen Leute außerstande setzt, ih-
70
ren Part des Generationsvertrages zu erfüllen). Auch die Durchsetzung dieser Forderung würde ich nicht Erziehung nennen, weil damit kein konkreter Vorgriff auf die Zukunft des Kindes verbunden ist. Das Kind kann diese Forderung zum Beispiel dadurch erfüllen, daß es eine klassische bürgerliche Berufskarriere anstrebt oder später beschließt, auf Sperrmüll-Niveau zu leben, zum Beispiel weil es so durch Einkommensverzicht mehr Zeit für seine kulturellen Interessen hat.
Ich plädiere also dafür, Kinder wie kleine, aber jeden Tag größer werdende Erwachsene zu behandeln, uns nichts besonderes, Kindspezifisches für den Umgang mit ihnen auszudenken, sie also in diesem Sinne nicht zu pädagogisieren. Für die pädagogischen Berufe ergibt sich, wenn meine Beschreibung des kulturellen Prozesses zutrifft, eine wichtige Konsequenz: sie können sich nicht mehr auf die Kindlichkeit des Kindes beziehungsweise die Jugendlichkeit des Jugendlichen gründen - als seien sie Fachleute für diese Altersstufen - sondern nur noch darauf, was Kinder und Jugendliche von ihnen und mit ihnen lernen können. Die Erzieherberufe sind Lernhelferberufe geworden, beziehungsweise müssen es noch werden.
Literaturhinweis: Hermann Giesecke: Das Ende der Erziehung. Neue Chancen für Familie und Schule. Stuttgart 1985.

150. Die Grenzen der Antipädagogik und ihrer Kritiker (1986)
Eine Replik auf Wolfgang Hintes Engagement für die Antipädagogik (päd.extra 2/86) und auf seinen Kritiker Michael Winkler
(In: päd.extra, H. 6/1986, S. 41-42)
Als vor gut zehn Jahren die ersten antipädagogischen Stellungnahmen erschienen, konnte man sie noch als "Spinnerei" abtun. Schließlich stand die als Sozialwissenschaft modernisierte Erziehungswissenschaft in prächtiger Blüte, die von ihr inspirierten Reformen vor allem des Schulwesens hatten weitgehend öffentliche Unterstützung und Anerkennung gefunden.
Die neuen Richtlinien hatten gerade den Erziehungsauftrag der Schule wieder betont (die Schüler sollten nicht nur Latein lernen, sondern auch kooperative und solidarische Menschen werden). Die pädagogische Terminologie hatte sich endlich so gemausert, daß sie von Nicht-Profis nicht mehr verstanden werden konnte. Die Didaktik war professorabel geworden und rückte den Fachwissenschaften gleichberechtigt an die Seite. Pädagogik war "in" und Antipädagogik nicht mehr als eine Skurrilität.
Das hat sich geändert. Die Erziehungswissenschaft (wäre sie doch bloß bei ihrem früheren Namen "Pädagogik" geblieben!) in Theorie und Praxis hat enorm an öffentlichem Ansehen verloren, und das liegt nicht nur an der "Wende" und an den zurückgegangenen Schülerzahlen, sie ist vielmehr auch in der Form an ihrem Ende angelangt und nicht mehr weiter entwicklungsfähig, die sie als Sozialwissenschaft in den 70er Jahren gefunden hat.
Was sie produziert, nützt der Praxis kaum noch, wird sozusagen für andere Produzenten hergestellt, nicht mehr für die Konsumenten, die Lehrer, Eltern, Sozialpädagogen. Das Versprechen, durch Reformen die pädagogische Praxis humaner zu machen, hat sie nicht einlösen können, im Gegenteil: gerade sie hat zum Beispiel die innere Bürokratisierung des Bildungswesens teils gefördert, teils als notwendige Rückwirkung provoziert.
In dieser Lage trifft eine Kritik, die "Erziehung" als historisch oder moralisch für überholt erklärt, ins Herz: denn wie immer man "Erziehung" verstehen mag, sie bezeichnet in jedem Falle das, was Erwachsene - Laien wie Profis - tun bzw. tun sollten im Umgang mit Unerwachsenen.
Es scheint so, als ob diese Kritik die pädagogische Professionalität von Grund auf in Frage stellt. Daher die Empfindlichkeit, aber auch das Mißverständnis in der Kontroverse, das im wesentlichen darin besteht, daß man nicht genau ermittelt, was der andere eigentlich meint, wenn er "Erziehung" sagt. Dieses Mißverständnis zeigt sich auch in den Beiträgen von Wolfgang Hinte (päd.extra 2/86) und Michael Winkler (4/86). Ich hoffe, daß ich das zeigen kann.
"Null Bock" auf Dauer ist " Vertragsbruch "
Zunächst muß man feststellen, daß die Antipädagogen überhaupt keine generelle erziehungswissenschaftliche oder pädagogische Theorie vorgelegt haben. Sie interessieren sich nur für eines: für den unmittelbaren Umgang von Erwachsenen und Kindern. Antipädagogik ist nichts weiter als eine spezifische Theorie des "pädagogischen Bezugs". Alles andere interessiert sie nicht, weder historische Veränderungen noch gesellschaftliche Faktoren.
Das ist ihre Chance, aber auch ihre Grenze. Ihre Chance insofern, als sie viel für die Aufklärung und für alternative Gestaltungsmöglichkeiten dieses unmittelbaren Umgangs bewirkt hat - bis in wichtigen Einzelheiten hinein.
Ihre Grenze liegt darin, daß sie diese - zunächst einmal akzeptable - Selbstbeschränkung nicht mehr reflektieren kann. Folgerichtig können die Antipädagogen ihre These nur moralistisch begründen, und daraus resultiert dann das gelegentliche Eiferertum und die Versuchung, Pädagogik zu einer "Gesinnungsfrage" zu machen. (Charakteristisch dafür ist W. Hinte's Rezension meines Buches "Das Ende der Erziehung" in dieser Zeitschrift: die historischen Begründungszu-
41
sammenhänge interessieren ihn gar nicht, wichtig war ihm nur, inwieweit des Autors Gesinnung mit der seinen übereinstimmt).
Die zweite Folge ist, daß der "pädagogische Bezug" in sich nicht differenziert werden kann, z.B im Hinblick auf den Unterschied von Familie und Schule. Die Thesen der Antipädagogik sind "familistisch" und für den Umgang in der Familie am ehesten plausibel. Aber sie können so nicht für die Schule gelten, weil die Schule eine öffentliche, professionell gestaltete Einrichtung ist, in der unter anderem die Regeln von Sachen gelten. Die Funktion von Schule für das Aufwachsen von Kindern ist eine fundamental andere als die der Familie. (Wie man diese Funktion antipädagogisch mißverstehen kann, hat H. v. Schoenebeck in seinem Erfahrungsbericht "Der Versuch, ein kinderfreundlicher Lehrer zu sein", Frankfurt 1980, selbst geschildert).
Die Begrenztheit des Blickes auf die Unmittelbarkeit der Beziehung hat - drittens - zur Folge, daß die gesellschaftliche Bedeutung des Generationsverhältnisses unverstanden bleibt. Das Kind ist kein "König" (v. Braunmühl), das selbst zu bestimmen hat, wann es was lernen will. Das ist eine völlige Verkennung der gesellschaftlichen Tatsache der Generationenfolge:
Der "Service", der dem Kind als Hilfe zum Aufwachsen eingeräumt wird, ist eine Art von Kredit, den es seinerseits, erwachsen geworden, an die dann nachfolgende Generation zurückzahlen muß und es hat die Pflicht, sich durch Ausbildung usw. dafür in Stand zu setzen. "Nullbock" als Dauereinstellung ist eine Art von Vertragsbruch.
Macht man sich diese Begrenztheit des Ansatzes klar, der zugleich seine Popularität erklärt, dann wird deutlich, daß jede grundsätzliche allgemeine erziehungswissenschaftliche Kritik, wie sie auch M. Winkler versucht, ins Leere gehen muß. Das, was M. Winkler in diesem Sinne unter Punkt zwei seines Beitrags sagt ("Erziehung ist eine unvermeidliche Antwort"), leugnen die Antipädagogen gar nicht, oder besser: Solche allgemeinen Argumentationen interessieren sie gar nicht bzw. höchstens dann, wenn daraus für den konkreten Umgang mit Kindern Schlußfolgerungen abgeleitet werden, die ihren Prinzipien widersprechen.
Die Diskussion mit den Antipädagogen ist überhaupt nur dann "treffend" im Sinne ihres eigenen Ansatzes und darüber hinaus auch wirklich wissenschaftlich ergiebig, wenn sie auf der Ebene der alltäglichen Konkretisierung stattfindet.
Das ist bisher - wenn ich richtig sehe - nicht geschehen. Darin sehe ich aber einen großen Mangel seitens unserer "Zunft", ja, vielleicht sogar die Unfähigkeit, die allgemeine, abstrakte Rechthaberei zu verlassen und sich auf solche Konkretionen einzulassen. Dafür ist allerdings der Beitrag von W. Hinte wenig geeignet, weil er ebenfalls allgemein bleibt und insofern auch erheblich anfechtbar. Aber zum Beispiel in dem Buch von E. v. Braunmühl "Zeit für Kinder" (Frankfurt 1978) finden sich eine Reihe von Beispielen und auf den Alltag bezogener Thesen, die einer genauen Prüfung wirklich wert sind. Aber das steht - wie gesagt - noch aus.
Der springende Punkt ist, daß die Antipädagogen genauso wenig wie ich aus dem, was M. Winkler generell zur Begründung der Pädagogik sagt, die Notwendigkeit von "Erziehung" ableiten, sondern nur die Notwendigkeit eines "besonderen Umgangs" mit Unmündigen. (Im Unterschied zu den Antipädagogen ist meine Begründung eine historische, wie ich sie in dem genannten Buch dargestellt habe und hier nicht wiederholen kann).
Der Verzicht auf den Erziehungsbegriff wird sofort plausibel, wenn man in Anlehnung an Brezinka Erziehung definiert als das planmäßige und absichtsvolle Bemühen, auf Unmündige so einzuwirken, daß sich bei diesen langfristig und dauerhaft erwünschte Dispositionen, Einstellungen, Verhaltensweisen usw. herausbilden.
Nimmt man diese Definition ernst, dann darf die Familie gar nicht "erziehen", weil das die Substanz ihrer Sozialität angreifen würde (Das wäre ja ein schöner neurotischer Zirkus, wenn da ständig etwas "absichtsvoll" und "planmäßig" "auf Dauer gestellt" werden soll). Die Familie kann die Kinder nur "sozialisieren" im Rahmen ihres Zusammenlebens und durch die Art und Weise, wie die Kinder darin mit Rechten und Pflichten einbezogen werden.
Die Schule andererseits kann gar nicht mehr in diesem Sinne "erziehen", weil sie als staatsmonopolistische dazu gar keine Macht mehr hat und weil die "Dispositionen, Einstellungen usw." der Kinder von ganz anderen Faktoren bestimmt werden.
Historisch gesehen ist Pädagogik also zurückgedrängt worden auf die Funktion, eine unabhängig von ihr ablaufende Sozialisation zu begleiten, zu kommentieren, zu interpretieren und partiell in sie einzugreifen. Dies einzusehen und daraus die entsprechenden Schlußfolgerungen zu ziehen, fällt uns offenbar sehr schwer.
Die " Erziehungswissenschaft " ist aufgebläht
"Erziehung" ist eben keine "unvermeidbare Antwort" mehr, und das Beharren darauf, daß man nicht nicht-erziehen könne - richtig ist doch nur, daß man nicht nicht mit Kindern umgehen, kommunizieren kann - verdeckt nur den enormen Bedeutungsverlust, den die Pädagogik in ihrem bisherigen Selbstverständnis hat hinnehmen müssen.
Schuld daran ist nicht zuletzt die abstrakte Allgemeinheit der erziehungswissenschaftlichen Diskussion, die damit sozusagen auf eine nutzlose Weise Recht behält, die aber so folgerichtig die konkrete Alltagspädagogik den Mystikern und Beziehungs-Aposteln überläßt. Dafür noch ein Beispiel:
Die "Subjektivität des Subjekts", dessen normative Bedeutung M. Winkler zurecht hervorhebt, wollen angeblich alle. Aber die einen meinen damit jenen parasitären Subjektivismus - parasitär deshalb, weil er von anderer Leute Arbeit lebt - wie er sich bei einem seinen unmittelbaren Befindlichkeiten und Bedürfnissen überlassenen Kind notwendig ausbildet, während die anderen darauf bestehen, daß Subjektivität nur im Rahmen von Arbeit, Anstrengung, Auseinandersetzung; Forderungen, Konflikten und Krisen sich herausbilden kann, also keineswegs dem Inneren der kindlichen Seele entspringt.
Solche "Zauberformeln", wie sie auch M. Winkler hier verwendet, verdecken nur, daß sich daraus einander ausschließende pädagogische Konsequenzen und Konzeptionen ergeben können. Deshalb wären die Antipädagogen nicht schlecht beraten, wenn sie bei dem blieben, was sie wirklich interessiert, nämlich beim unmittelbaren Umgang mit Kindern.
Mein persönliches Fazit aus dieser jahrelangen Diskussion ist: Wir müssen wieder ganz von vorne anfangen. Mit der Fortschreibung der aufgeblähten "Erziehungswissenschaft", vor allem in ihrer sozialwissenschaftlich und psychoanalytisch entfremdeten Form kommen wir nicht weiter. Wir müssen uns wieder unvoreingenommen die Menschen ansehen zwischen Geburt und Tod, wie sie wirklich leben, was sie wirklich prägt und bewegt.
Dann wird die erste Entdeckung sein, daß ein Neugeborenes zwar viel lernen muß, um am Leben seiner Gesellschaft befriedigend teilnehmen zu können, und daß dafür der teils innige, teils distanzierte Umgang mit Erwachsenen unentbehrlich ist, daß aber die Notwendigkeit von Erziehung im vorhin definierten Sinne daraus keineswegs erwächst.
Vielleicht können sich die "verfeindeten" Positionen wenigstens darauf einigen: sich unvoreingenommen das wirkliche Leben wieder anzusehen, es unter pädagogischen Gesichtspunkten (für mich: unter dem Gesichtspunkt des Lernens) zu beschreiben und daraus dann pädagogische Interventionen abzuleiten.
42

151. Was heißt hier Familie ... (1986)
(In: Deutsche Allgemeines Sonntagsblatt Nr. 45-50/1986)
(Es handelt sich hier um eine Artikelserie für diese Zeitung in sechs aufeinander folgenden Ausgaben; die in solchen Fällen üblichen redaktionellen Zusätze wurden weggelassen, die von der Redaktion festgelegten Überschriften und Zwischenüberschriften jedoch beibehalten, H. G.).
1. Immer wieder nach Hause kommen ...
Einer meiner Großväter, der als Ungelernter aus Schlesien in den Ruhrbergbau "geworben" worden war, versprach seinem Freund, der mit 21 Jahre an der damals weitverbreiteten Arme-Leute-Krankheit, der Tuberkulose, starb, am Totenbett, daß er "sich kümmern werde" um die Frau und die beiden Kinder Er hielt das Versprechen, indem er die Frau heiratete - eine andere Möglichkeit gab es damals kaum, unter diesen Bedingungen ein solches Versprechen einzulösen. Vermutlich wäre in diesem Milieu die Frage ganz abwegig gewesen, ob sich die beiden denn auch genug "liebten" für einen solchen Schritt. Was immer Liebe sonst sein mochte, hier war sie nichts weiter als Funktion sozialer Zuverlässigkeit und Verantwortung: mehr konnte man sich einfach nicht leisten.
Diese Geschichte hat nichts von einer Idylle an sich; denn erstens geht es um eine Ausnahme, und zweitens war im allgemeinen damals das Familienleben wegen der Not eher mörderisch als harmonisch. Aber die Spannweite dessen, was man unter Familie verstehen kann, wird deutlich. wenn wir den Blick in die Gegenwart richten.
Fast jede dritte Ehe wird bei uns heute geschieden - etwa 120 000 pro Jahr; amerikanische Experten sagen voraus, daß es bald jede zweite Ehe sein wird. Zurück bleiben jährlich rund 100 000 "Scheidungskinder", für die in der Regel die Mutter das Sorgerecht erhält. Ein Psychologe erklärte mir dazu: "Liebe, wie wir sie heute verstehen, ist eigentlich ein Luxus; Man muß dafür Zeit und Geld haben. Als wir nach dem Kriege immer wohlhabender wurden, konzentrierten wir unsere Sinne zunächst auf gutes Essen, dann aufs Auto, dann auf die Ferienreis und schließlich auf uns selbst. Nun nehmen wir unsere inneren Gefühle und Bedürfnisse ernst und achten darauf, daß wir m Umgang mit anderen auch ja auf unsere Kosten kommen." Und wenn die Balance von Geben und Nehmen nicht mehr stimmt, so ist hinzuzufügen, geht man auseinander und versucht es mit einem anderen Partner.
Offenbar hat ein Sinneswandel stattgefunden vom sozialen zum psychologischen Verständnis der Familie. Noch zu Beginn dieses Jahrhunderts wurde Familie nicht nur bei armen Leuten, sondern auch im Bürgertum als eine notwendige Basissozialität, als eine Lebensgemeinschaft verstanden. Heute wird sie als psychologische Tatsache genommen, als eine Summe individueller Beziehungen zwischen den einzelnen Familienmitgliedern.
Das Idealbild der bürgerlichen Familie war allerdings gegründet auf eine klare Rollenteilung: Der Mann muß hinaus, die Familie verlassen, um deren Lebensunterhalt zu verdienen; er erfährt dabei, worauf es im Leben ankommt, und er gibt diese Erfahrungen als Erzieher nicht selten mit Härte an seine Kinder weiter. Die Mutter dagegen führt das Haus und ist für Wärme und Geborgenheit zuständig, ohne die auch der Mann die beruflichen Belastungen nicht ertragen könnte. Die Kinder bereiten sich durch möglichst gute schulische Leistungen auf ihre Karriere als Mann oder Frau vor.
Dieses Idealbild zerbrach, als die Frau ebenfalls aus der Familie herausdrängte, um berufstätig zu werden. Jahrzehntelang hat es darüber Auseinandersetzungen gegeben, auch pädagogische: Die Kinder würden vernachlässigt und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt. (Die letzte große öffentliche Fehde gab es über die "Tagesmütter"; berufstätige Frauen sollten mit öffentlicher Unterstützung die Möglichkeit erhalten, ihr Kleinkind während der Arbeitszeit durch eine Tagesmutter, eine geeignete Nachbarin etwa, versorgen und betreuen zu lassen. Die Kritiker verwiesen darauf, daß ein Kleinkind nicht mehrere Bezugspersonen haben dürfe, ohne in seiner Entwicklung Schaden zu nehmen. Aber das ist wissenschaftlich genausowenig beweisbar wie das Gegenteil.)
Zweifellos hat die Emanzipation der Frau zwei Seiten gehabt: Einmal konnte sie dabei ihre individuellen Rechte als Persönlichkeit durchsetzen, andererseits aber wurde dadurch die alte SozialitätFamilie mit ihrer klaren Rollenaufteilung zerstört. Die Kosten dieses Prozesses haben alle bezahlen müssen: die Frauen mit ihrer Doppelbelastung in Beruf und Familie, die Männer durch die Verunsicherung ihres Status und durch den Verlust der selbstverständlichen häuslichen Geborgenheit und die Kinder durch die ständige Gefährdung der sozialen Zuverlässigkeit ihres Lebensraumes Familie; die hohen Scheidungszahlen sind dafür nur ein wichtiger Indikator.
Die Psychologisierung der Familie, wie sie sich als herrschende Meinung nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den Medien in den letzten 20 Jahren durchgesetzt hat, rechtfertigte diesen Emanzipationsprozeß: die Gleichberechtigung der Bedürfnisse und Gefühle aller Familienmitglieder, auch der Kinder, war das neue Leitbild.
Auch dieser Fortschritt aber hatte seinen Preis. Die Familie als gemeinsamer sozialer Ort löste sich auf in eine Summe von "Beziehungskisten" der Erwachsenen miteinander, mit den Kindern und der Kinder untereinander. Es schien so, als sei die Familie eine Art von Gefühls- und Bedürfnismarkt, dessen Ziel das Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage sei. Daß da etwas nicht stimmt, bringen uns die Kinder bei, denn die sind konservativer, als wir gemeinhin annehmen. Scheidungskinder zum Beispiel leiden - entgegen unserer Erwachseneneitelkeit - nicht so sehr darunter, daß sie nun mit einem Elternteil keine tägliche Beziehung mehr haben, sondern viel mehr darunter, daß die soziale Basis Familie zusammenbricht und daß das selbstverständliche soziale Umfeld (Schule, Freunde, vertraute Umgebung) gestört oder gar entzogen wird, wenn zum Beispiel nach der Scheidung ein Umzug erforderlich wird. Sie wünschen sich möglichst bald wieder eine "stinknormale" Familie. Dieser Wunsch geht so weit, daß Kinder vor allem zwischen sechs und zehn Jahren ihre Mutter regelrecht mit jedem Mann "verkuppeln" wollen, der ihnen halbwegs gefällt: Zu einer "normalen" Familie gehört eben ein Mann, wie bei den anderen Kindern auch. Man will nicht auffallen und nicht anders sein.
Kinder brauchen eine Familie offensichtlich weniger, um unentwegt emotional angesprochen zu werden - das geht ihnen eher auf die Nerven; vielmehr brauchen sie sie als einen "sozialen Heimathafen", der Zuverlässigkeit ausstrahlt: Man kann ihn verlassen und wird immer wieder mit Freude zurückerwartet; und morgen wird alles so sein, wie es gestern auch war. Kinder haben ein untrügliches Gespür dafür, daß bloße Gefühle gleichsam freischwebend bleiben, wenn sie nicht in eine verbindliche Sozialität gebunden und produktiv gemacht werden.
Wir tun gut daran, von den Kindern zu lernen, indem wir die einseitige psychologische Betrachtung der Familie überwinden und statt dessen ihre soziale Bedeutung wieder in den Blick nehmen. Dann, so wird sich zeigen, entdecken wir auch neue Maßstäbe für den Umgang mit unseren Kindern, für deren "Erziehung" in der Familie.
Für den Trend zur Neuentdeckung der Familie als Sozialität gibt es weitere Anzeichen. So mehren sich in den Heiratsspalten der Zeitungen die Wünsche nach einer Partnerin mit Kindern. Noch vor wenigen Jahren war das anders, da fand sich allenfalls gelegentlich der gönnerhafte Hinweis: "Kind kein Hindernis", während die Frauen demütig nach einem "lieben Mann" suchten, der sie einschließlich ihres "süßen Kleinkindes" nehmen sollte. Diese Tendenz mag mehrere Motive haben, aber eins davon ist offensichtlich: wegzukommen aus "Beziehungen", die keinen anderen Sinn als sich selbst haben, in denen es keine gemeinsame Sache und keine gemeinsame Aufgabe gibt.
Die neue Sozialität der Familie beruht allerdings auf ganz anderen Voraussetzungen als bei der alten "bürgerlicher" Familie. Mann und Frau sind nun prinzipiell mit gleichen Rechten nach außen gewendet, beruflich und möglicherweise auch politisch engagiert, die Kinder sind ebenfalls weitgehend nach außen orientiert, an den Gleichaltrigen und an ihren Freizeitinteressen. Der "soziale Heimathafen" ist offener geworden als früher, weniger von oben nach unten geordnet. Das "Zu-Hause-Sein", die gefühlsmäßige Fixierung der Mitglieder aufeinander, hat an Bedeutung verloren, wichtiger ist das immer wieder befriedigende "Nach-Hause-Kommen".
Aber damit tauchen auch neue Fragen auf. Was verlangt die Sozialität Familie ihren Mitgliedern ab? Dürfen Kinder bloß "Nutznießer" sein? Was kann die Familie eigentlich noch für die "Erziehung" der Kinder tun angesichts der Einflüsse der Gleichaltrigengruppen und der Massenmedien? Davon handeln die nächsten Folgen dieser Serie.
2. Mami macht's schon
Barbara B. ist geschieden und lebt mit ihrem zehnjährigen Sohn in einer sogenannten "Alleinerzieher-Familie". Da sie voll berufstätig ist, war sie in der ersten Zeit nach ihrer Scheidung stolz auf ihren Jungen, weil er sich so "männlich" verhielt und teilweise die Verantwortung für den Haushalt übernahm. Er kümmerte sich ums Einkaufen, griff regelmäßig zum Staubsauger und hielt von sich aus sein Zimmer in Ordnung. "Wenn ich mithelfe, haben wir beide mehr Zeit füreinander", sagte er.
Aber auf die Dauer nahm die Mutter diese Hilfe immer weniger in Anspruch. Sie kritisierte, er mache die Hausarbeit "nicht gut genug", so daß der Junge die Lust verlor. "Ich schämte mich", erklärte sie, "als ich merkte, daß der Junge der einzige unter seinen Freunden ist, der überhaupt Hausarbeit leistet. Die anderen haben ihn damit geneckt und ihn als 'Hausmann' bezeichnet. Wegen der Scheidung habe ich ohnehin ein schlechtes Gewissen ihm gegenüber, und er soll es doch nun nicht schlechter haben als andere Kinder."
Mit ihrer Meinung steht diese Mutter nicht allein. Anneke Napp-Peters hat in einer umfangreichen Untersuchung von "Einelternteilfamilien" festgestellt: "Obwohl die überwiegende Mehrheit der alleinerziehenden Eltern berufstätig ist, brauchen die meisten Schulkinder (52 Prozent) nicht im Haushalt zu helfen und sind auch sonst von Familienpflichten weitgehend freigestellt. Bei einigen Eltern resultiert die Verwöhnung ihrer Kinder offensichtlich aus Schuldgefühlen; man möchte ausgleichen, was man dem Kind an Ehekonflikten nicht ersparen konnte."
Die Autorin spricht von "Verwöhnung". In der Tat muß man sich fragen, was für eine soziale Gemeinschaft eine Familie eigentlich sein soll, in der die einen die Nutztiere und die anderen die bloßen Nutznießer sind beziehungsweise dazu gemacht werden. Auch unter den sogenannten "normalen" Familien, vor allem der Mittelschicht, ist die materielle Verwöhnung ("Es den Kindern vorne und hinten reinstopfen") und die soziale Verwöhnung ("Geh ruhig spielen, Mami macht das schon!") weit verbreitet. Die Kinder scheinen hier Statussymbole zu sein, mit und an denen man seinen Wohlstand demonstriert - ähnlich wie früher Männer ihre pelz- und perlenbesetzten Frauen vorführten, um dadurch ihr eigenes Image zu pflegen.
Dabei wollen Kinder einen solchen Status von sich aus gar nicht. Schon kleine Kinder, so läßt sich immer wieder beobachten, wollen Mutter oder Vater "helfen" bei der Arbeit; die guten Pädagogen unter den Eltern sind jene, die ein solches Ansinnen ernsthaft aufgreifen, auch wenn es Zeit kostet und manchmal "nervt". Kinder haben nämlich eine Nase dafür, daß man in der Familie nur dann eine ernsthafte soziale Position haben kann. wenn man etwas für die anderen tut. Wenn Eltern ihren Kindern dies verwehren beziehungsweise nicht von ihnen in angemessenem Maße fordern, zerstören sie die soziale Basis ihrer Familie; sie gliedern dann ihre Kinder gleichsam aus der sozialen Gemeinschaft aus - ganz abgesehen davon, daß die Kinder auf Weise unselbständig bleiben und unfähig, Verantwortung für andere zu übernehmen.
Kinder haben Anspruch auf Rücksichtnahme gegenüber ihrer "Kleinheit". Aber sie werden ständig größer, und in gleichem Maße müssen sie lernen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen. In diesem Prozeß steckt der ganze Sinn von "Erziehung".
Welche Ursachen und Gründe hat diese auffällige Verwöhnung? Neben dem Motiv des "schlechten Gewissens" (das immer ein schlechter pädagogischer Ratgeber ist, weil die Kinder nichts Gutes davon haben) hört man immer wieder: "Ich mußte als Kind viel zu Hause mitarbeiten, weil wir arm waren; das hat mich zwar früh selbständig gemacht, mir aber auch vieles verwehrt, was für andere Kinder selbstverständlich war. Meine Kinder sollen es besser haben!" Aber die heutigen Kinder wachsen nicht in Armut, sondern in (relativem) Wohlstand auf!
"Von den Kindern wird heute so viel in der Schule verlangt, daß man sie zu Hause entlasten muß. Zu Hause sollen sie es gut haben, damit sie in der Schule und später im Leben gut vorankommen". Nach aller Erfahrung ist es ein Irrtum, anzunehmen, die ersparte Zeit käme den Schularbeiten zugute; sie vermehrt nur die Freizeit.
"Durch die technischen Möglichkeiten ist der Haushalt so erleichtert worden, daß die Arbeit nicht einmal einen einzigen Menschen ausfüllen kann. Wozu soll man da die Arbeit noch aufteilen?" Das ist das gefährliche Argument von Müttern, die sich zu Hause die Zügel nicht aus der Hand nehmen lassen wollen. Gerade die moderne Haushaltstechnologie erleichtert den Kindern die Mitwirkung. Die Bedienung einer Waschmaschine überfordert Kinder ebensowenig wie die eines Staubsaugers. Und jede erledigte Arbeit schafft Zeit, mit der man einzeln oder gemeinsam etwas anfangen kann.
Gewiß: die Maxime "Was Kinder schon selbst können, müssen sie auch selbst tun", muß eingeschränkt werden. Nicht nur in der Schule, sondern auch in ihrer Freizeit müssen Kinder die Möglichkeit erhalten, ihre Fähigkeiten zu entwickeln, und das kostet Zeit, Aufmerksamkeit und Konzentration. Viele Jahrzehnte hat es gedauert, bis die Kinderarbeit abgeschafft war, die den Kindern eben diese Entwicklungschancen vorenthielt. Aber was zunächst ein Segen war, wird langsam zum pädagogischen Fluch. Wir hindern unsere Kinder daran, ihre Fähigkeiten und Kenntnisse zum Wohle ihrer für viele Jahre wichtigsten sozialen Gemeinschaft - der Familie - einzusetzen; wir verweisen sie statt dessen auf eine unbestimmte Zukunft: Wenn sie erwachsen sind, sollen sie gleichsam über Nacht wissen, was Verantwortung für sich und andere bedeutet und wie man sie wahrnimmt.
Schlimmer noch: Verwöhnung ist entweder Gleichgültigkeit oder eine subtile Form von Erpressung. Wer verwöhnt, handelt nur scheinbar unegoistisch, er erwartet, wenn nicht heute, so doch später, eine emotionale Gegenleistung, und das kann, wenn die Kinder groß werden und aus dem Haus streben, zu ungeahnten Konflikten zwischen den Generationen führen.
An kaum einem anderen Punkte wird so deutlich wie beim Stichwort .,Verwöhnung', wie sehr der soziale Charakter der Familie aus dem Bewußtsein entschwunden ist. Es gibt inzwischen Berge von Literatur, die den Eltern rät, wie sie sich verhalten, worauf sie achten und was sie in Konfliktfällen tun sollen. Aber der pädagogische Sinn der Familie besteht in erster Linie darin, daß die Kinder Teil dieser Lebensgemeinschaft und deshalb für deren Wohlergehen nach ihren Kräften mitverantwortlich sind. Die damit verbundenen sozialen Erfahrungen darf man Kindern nicht vorenthalten. Ökonomisch gesehen ist die Familie ein "Haushalt". Für das Einkommen sind die Eltern zuständig, aber für die Pflege der Sachen sind alle verantwortlich. Was einem Kinde zur Verfügung steht - von den Spielsachen bis zur Kleidung - ist nicht "vom Himmel gefallen", sondern das Ergebnis von Arbeit. Insofern ist "schlampiger'` Umgang mit Sachen ein Mangel an Respekt vor der Arbeit anderer Leute. Betrachten wir unsere Kinder also wieder als echte Mitarbeiter unserer Familie, mit Rechten und Pflichten!
Jeder normale Familienhaushalt hat keine Reichtümer, sondern Mangel zu verteilen: Die Bedürfnisse der Erwachsenen wie der Kinder sind immer größer, als sich bezahlen läßt, alle müssen sich nach der Decke strecken. Aber oft werden auch die größeren Kinder nicht in die Erörterung finanzieller Probleme einbezogen. Das fördert keineswegs nur ihre Unbeschwertheit, sondern auch ihre Abhängigkeit und Unselbständigkeit. Wie aber können Kinder lernen, selbständig zu wirtschaften?
Eine Möglichkeit ist, älteren Kindern etwa ab 14 Jahren, also etwa beginnend mit der Konfirmation, das "Taschengeld" zu einem "Wirtschaftsgeld" so zu erhöhen, daß sie außer Essen und Wohnen alles damit bestreiten müssen, was sie brauchen beziehungsweise sich wünschen - also Kleidung, Reisen, Moped, Führerschein und anderes. Der Heranwachsende muß auf diese Weise nicht nur seine Bedürfnisse mit seinen finanziellen Möglichkeiten in Einklang bringen, sondern er muß auch für größere Projekte sparen und überhaupt vorausdenken lernen: Seine Wünsche für Geburtstag und Weihnachten werden realistischer. Allerdings sollten die Eltern die Führung dieses "Wirtschaftskontos" zunächst beratend überwachen. Schließlich sollen die Kinder etwas lernen dabei. Aber dieses Beispiel wie das ganze Thema zeigen, daß die "Erziehungsfunktion" - ich spreche lieber von "Lernmöglichkeiten" - der Familie keineswegs verschwunden ist. Man muß nur die in der Familie enthaltenen Möglichkeiten und Notwendigkeiten unter diesem Gesichtspunkt wieder entdecken.
3. Im Gestrüpp der Gefühle
Wie viele Kinder meiner Generation war ich in den Kriegsjahren evakuiert und mußte während der Schulzeit bei fremden Leuten wohnen, um das Gymnasium besuchen zu können. Ich habe mich damals schon gefragt, warum diese Menschen sich eigentlich mit mir, einem fremden Kind abgaben. Gewiß, sie bekamen dafür Geld vom Staat, aber die Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Toleranz - zum Beispiel gegenüber meinem religiösen Bekenntnis - waren damals damit sicherlich nicht bezahlt.
Gegenwärtig gibt es als Folge der hohen Scheidungsrate viele "Stieffamilien". Warum, so kann man auch hier fragen, übernehmen Stiefväter - sie sind gegenüber Stiefmüttern in der Überzahl - die Zeit, Geld und Nerven kostende Verpflichtung, für das Aufwachsen von Kindern zu sorgen, die nicht die ihren sind? Unabhängig von den jeweils individuellen Motiven und Gründen verweisen beide Beispiele auf eine gesellschaftliche Grundtatsache, die jenseits aller individuellen Absichten und Meinungen gilt und die man als Generationenvertrag bezeichnet hat. Kein Erwachsener würde wohl ernsthaft abstreiten, daß er in irgendeiner Form für ein befriedigendes Aufwachsen der Kinder mitverantwortlich ist, und sei es nur insofern, als er höhere Steuern zahlt, wenn er selbst keine Kinder aufzieht, und daß wir alle Steuern dafür zahlen, daß Kinder in sozialpädagogischen Einrichtungen - zum Beispiel in einem SOS-Kinderdorf - groß werden können, wenn eine Familie ihnen nicht zur Verfügung steht.
Die Grundidee des Generationenvertrages ist: Kinder haben Anspruch auf eine Art von Kredit, den ihnen die Erwachsenen einräumen. Mit diesem Kredit bezahlen sie gleichsam ihr Aufwachsen, nicht zuletzt ihre schulische und berufliche Qualifikation, und wenn sie erwachsen sind, müssen sie diesen Kredit an die nachfolgende Generation zurückzahlen. Auf dieser Idee basiert nicht nur das Familienleben, sondern zum Beispiel auch die Rentenversicherung. Die Renten werden im Grunde nicht von denen aufgebracht, die arbeiten und dadurch Beiträge zahlen, sondern in erster Linie von denen, die Kinder aufziehen, die später für die heute Arbeitenden aufkommen können. An diesem Punkt ist das Familienleben mit dem Leben der ganzen Gesellschaft aufs engste verknüpft. Auch der Staat ist verpflichtet, zum Beispiel in seiner Sozialpolitik eine gerechte Balance des "Generationenvertrages" zu garantieren.
Daß er genau dies nicht tut, werfen ihm viele Fachleute vor. Alfred Rollinger zum Beispiel, Vizepräsident des Sozialgerichtes in Trier, sieht im gegenwärtigen Rentensystem "eine gigantische Umverteilung zugunsten der Kinderlosen". Sie könnten sich eine höhere Rente erwerben und würden allgemein durch gesetzliche Bestimmungen begünstigt. "Auf eine Kurzform gebracht kann man sagen, daß wir heute zum erstenmal in der Weltgeschichte Verhältnisse haben, die so gestaltet sind, daß die Verweigerung von Kindern die Alterssicherung wesentlich verbessert, daß Aufziehen von Kindern für die Alterssicherung in hohem Maße schädlich ist." Gegenüber einem kinderlosen, doppelverdienenden Ehepaar entstehe einem Paar mit zwei Kindern im Laufe des Lebens ein Nachteil von fast 500 000 Mark. Die Unterhaltsleistungen für Kinder würden zu etwa 87 Prozent von den Eltern allein getragen und nur zu etwa 13 Prozent von der Gemeinschaft der Eltern und Kinderlosen. Wollte man Gerechtigkeit herstellen, so müßten zum Beispiel die Kinderlosen statt 18,5 Prozent etwa 30 Prozent ihres Verdienstes bei der Rentenversicherung einzahlen. Rollinger nennt unsere Zeit "das Zeitalter der Ausbeutung der Eltern mit Kindern durch die Kinderlosen".
Auf der politischen Ebene also ist der Generationenvertrag "heute verfälscht", wie Rollinger schreibt. Wie sieht es aber damit innerhalb der Familie aus? Die heute immer noch herrschende psychologisch orientierte Ratgeberliteratur weiß davon wenig. Sie kann nur die Unmittelbarkeit der menschlichen Beziehung in den Blick nehmen und propagiert, daß die Eltern sich mit ihren Kindern "verständigen" sollten bei Konflikten. Aber was sollen die Eltern einem Kind sagen, das zum Beispiel ständig "Null Bock" hat und auf Grund seiner Erfahrung - zur Hausarbeit wird es gar nicht erst herangezogen - auch gar nicht einsehen kann, warum es sich für irgend etwas anstrengen soll, wenn es ihm auch ohne Anstrengung gutgeht? Es führt also nicht weit, wenn die Eltern sich nur "verständigen" wollen, solange sie zur Sache nichts zu sagen haben, was über den Augenblick hinausweist. Wer sich auf die Dauer aus einer Null-Bock-Haltung heraus weigert, seine Fähigkeiten nach Kräften und Möglichkeiten zu entwickeln - in der Schule, in der Berufsausbildung, aber teilweise auch in der Freizeit - der bricht einen ungeschriebenen, ideellen Vertrag. Niemand kann zum Nulltarif leben; wer das ernsthaft will, lebt auf Kosten anderer Leute Arbeit.
Damit ist keineswegs ausgeschlossen, die Probleme der Kinder ernst zu nehmen, die zu ihrem Verhalten führen. Aber Probleme können auch eingeredet sein, als Ausrede und Rechtfertigung dienen. Schon Schulkinder beherrschen heute das von den Medien verbreitete psychoanalytische Vokabular ("Frust"), um Unlust zu begründen. Es ist eine reine Definitionsfrage, ob ich meine Unlust als "Faulheit" oder "Frustration" oder als "Mangel an Geliebtwerden" kennzeichne. Es ist ein Unterschied, ob ich ein Problem wie "Null Bock" in der Innerlichkeit der kindlichen Seele festmache oder im Rahmen seines sozialen Zusammenhangs. Wenn ich Kinder dazu verleite, bei irgendwelchen Problemen in ihre Innerlichkeit zu schauen, dann mache ich sie nur orientierungsloser, weil ich sie ins Gestrüpp ihrer Gefühle fallen lasse. Nur im Rahmen des sozialen Zusammenhangs, also der konkreten Rechte, Pflichten, Aufgaben und Verantwortlichkeiten sind Probleme von und mit Kindern diskutierbar und lösbar.
Eine der schlimmsten Folgen der Psychologisierung der Familie ist die Versuchung, das Gesagte nicht als das Gemeinte zu nehmen, das tatsächliche Verhalten des anderen als ein bloßes Symptom zu deuten, hinter dem man das "Eigentliche" (zum Beispiel einen unbewußten Konflikt) vermuten müsse. Auf diese Weise geht jede verbindliche Sozialität kaputt, und der Einbruch psychoanalytischer Deutungsmuster in die mittelständische Familie hat viel zu ihrer Verunsicherung beigetragen. Gerade in der Familie können wir uns nur am offensichtlichen Verhalten und Sprechen des anderen orientieren; was er nicht zur Sprache bringen kann oder will, bleibt sein Geheimnis, geht die anderen nichts an und verlangt deren Respekt.
Die Idee des Generationenvertrages weist über die unmittelbare Beziehung der Familienmitglieder hinaus, stellt die Kinder in die Generationenfolge. Diese Erfahrung ist für sie ungemein wichtig, denn nur indem sie die Gleichzeitigkeit der lebenden Generationen erfahren - von den Großeltern, eventuell sogar Urgroßeltern bis zu sich selbst - , können sie auch die sinnliche, vitale Erfahrung vom Leben als einem zeitlichen Prozeß machen, in dem Menschen sich entwickeln und reifen können. Dies ist aber eine notwendige Voraussetzung für ein historisches Verstehen über die lebenden Generationen hinaus.
Wie jeder Vertrag, so bindet auch der Generationenvertrag beide Seiten, auch die Eltern. Er macht den Erwachsenen klar, daß die Kinder nicht ihr Eigentum sind, daß sie zum Beispiel in die Zukunft der Kinder nicht mehr als unvermeidlich eingreifen dürfen. Das gilt zum Beispiel für ein besonders heikles Problem, nämlich für den Umgang der Scheidungskinder mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil - und das sind überwiegend die Väter. Hier zeigt sich oft die Kehrseite der "Verwöhnung", nämlich ein ungenierter Besitzanspruch und eine Instrumentalisierung des Kindes gegen den anderen (ehemaligen) Partner. Wer mit welchen Tricks auch immer dem Kind den Zugang zu Vater beziehungsweise Mutter verwehrt, verstößt ebenfalls gegen die Idee des Generationenvertrages und sollte zur Not mit dem Entzug des Sorgerechts bedroht werden. Niemand kann heute wissen, welche Bedeutung der abwesende Elternteil in Zukunft für das Kind haben wird.
Es ist zwar richtig, daß Erwachsene wie Kinder immer nur in einer Familie verbindlich aufwachsen beziehungsweise leben können, und diese Entscheidung muß in jedem Scheidungsfalle für die Kinder getroffen werden. Aber der Besuch der Kinder bei ihrem Vater beziehungsweise bei ihrer Mutter gefährdet normalerweise die Stabilität der Familie ebensowenig wie andere Verwandtenbesuche auch. Die seelischen Scheidungsfolgen könnten für Kinder erheblich gemildert werden, wenn in dieser Frage mit der gebührenden Gelassenheit verfahren würde. Ein Kind kann auch reifen an der Erfahrung, daß seine Eltern miteinander zwar kein befriedigendes Leben führen konnten, daß sie aber zum Beispiel mit einem neuen Partner dennoch glücklich werden können - oder aber auch nicht. Das viel zitierte "Wohl des Kindes" wird verfehlt, wenn die zuständigen Erwachsenen es für ihre eigenen emotionalen Interessen oder für ihre Partnerkonflikte instrumentalisieren.
4. Ein bißchen mehr als Liebe
Wenn wir heute von Familie sprechen, übersehen wir meist, daß wir es mit mindestens drei verschiedenen Typen zu tun haben: mit der Normalfamilie (Eltern ziehen die eigenen Kinder groß), der Alleinerzieher-Familie (Mutter oder Vater leben allein mit ihren Kindern zusammen) und der Stieffamilie (ein verwitweter oder geschiedener Elternteil lebt mit einem neuen Partner zusammen, der für die Kinder "Stiefelternteil" ist). Die Alleinerzieher-Familie kann wiederum viele Formen haben: Der Erwachsene lebt ganz ohne Partner, oder er hat einen festen Partner, der auch als "Gast" der Familie den Kindern bekannt ist, oder er hat einen Partner, der aus dem Familienleben herausgehalten wird.
Bisher galt die Normalfamilie als Leitbild, woran gemessen die anderen Formen nur als mehr oder weniger tolerierbare "Ersatzlösungen" galten. Gerade die Wissenschaft hat hier zur Vorurteilsbildung beigetragen, indem sie zum Beispiel ungeniert die Alleinerzieher-Familie - das sind überwiegend Mutter-Familien - als "unvollständig" oder "zerrüttet" bezeichnete und so nicht nur gesellschaftliche Vorurteile stärkte, sondern auch das Selbstbild der Eltern schädigte. Heute gibt es keinen vernünftigen Grund mehr, irgendeine normative Rangordnung herzustellen.
Jede Familienform hat ihre spezifischen Probleme: Die Normalfamilie - falls sie nicht ohnehin schon zerrüttet ist und nur noch durch die Kinder zusammengehalten wird, was diesen keineswegs unbedingt guttut - ist vielfach eine Brutstätte emotionaler Fixierung und ein Ort der Verwöhnung für die Kinder. Die Alleinerzieher-Familie sowohl der Väter wie der Mütter leidet vor allem an ihrer durchweg miserablen finanziellen Situation und an den unzureichenden öffentlichen Angeboten zur Kinderbetreuung. Zwar schießt der Staat neuerdings für Kinder bis sechs Jahre säumige Unterhaltszahlungen der Väter vor (als ob die Kinder danach nichts mehr bräuchten), das ändert freilich nichts an der Tatsache, daß im großen und ganzen die Zahlungsmoral der geschiedenen Väter schlecht ist. Die Stieffamilie leidet vor allem dadurch, daß sie sich allzu leicht an der Normalfamilie orientiert beziehungsweise daran gemessen wird. Diese Familien wollen es oft "besonders gut machen", nicht wenige Stiefväter zum Beispiel wünschen den Platz des abwesenden Vaters einzunehmen, was im allgemeinen zu Konflikten mit den Kindern führen muß. Vom Standpunkt der Kinder aus ist der Familientyp, in dem sie leben, ihre Familie, und sie haben nichts davon, wenn ihre Situation an anderen gemessen wird. Deshalb lohnt es sich zu überlegen, was Kinder wirklich brauchen, um in der Gemeinschaft Familie - gleich, welchen Typs - befriedigend aufwachsen zu können.
Da denkt man zunächst an "Liebe". Aber was immer das im Umgang mit Kindern sein mag: Gefühle gegenüber anderen Menschen lassen sich weder planen noch pädagogisch herstellen. Sicherlich muß man die Kinder schon mögen, mit denen man zusammen lebt, aber im übrigen sollte der Grundsatz gelten: Nicht heucheln, was nicht vorhanden ist. Erfahrungen gerade in Stieffamilien zeigen, daß eine auf Wohlwollen gegründete emotionale Distanz für die Kinder sehr angenehm und förderlich sein kann. "Liebe" im Sinne einer überstrapazierten und besitzergreifenden Emotionalität ist eine Erfindung der Erwachsenen, nicht der Kinder.
Was Kinder brauchen und was die Erwachsenen ihnen verschaffen können, ohne dabei falsche Gefühle zu zeigen, ist verhältnismäßig einfach zu sagen:
1. Das Kind braucht die schon mehrfach erwähnte soziale Zuverlässigkeit seiner Familie. Diese erfährt es anschaulich dadurch, daß die Eltern liebevoll miteinander umgehen (was gelegentliche Konflikte nicht ausschließt). Die meisten "Erziehungsprobleme" in der Familie beruhen darauf, daß die Eltern nicht miteinander harmonieren und daß die Kinder dies völlig richtig als Gefahr für die Gemeinschaft erleben und entsprechend auf ihre Weise reagieren.
2. Das Kind braucht einen autonomen Handlungsspielraum, in den andere nur in Notfällen hineinregieren. Man könnte das Größerwerden der Kinder als eine ständige Vergrößerung dieses Handlungsraumes bezeichnen: von der kleinen Spielecke bis zur vollen Freizeitautonomie des Herangewachsenen.
3. Das Kind braucht Grenzen, unter Umständen auch harte Auseinandersetzungen. Je größer der Freiheitsspielraum des Kindes wird, um so mehr werden die Grenzen zurückgenommen - aber nicht kampflos, sondern nach dem Grundsatz: Keine neue Freiheit ohne neue Verantwortung. Das Kind muß sein Größerwerden als eine Kette von Erfolgen, ja, als kleine Siege feiern können. Kampflose Gewinne erlebt es zu Recht als Desinteresse an seinem Leben. Dabei sind auch Rückschläge möglich: Wer zum Beispiel schon ein Moped fahren darf und dabei im alkoholisierten Zustand erwischt wird, der sollte eben einen Monat lang wieder zu Fuß gehen, damit er diesen Zusammenhang von neuer Freiheit und neuer Verantwortung begreift.
4. Das Kind braucht Aufmerksamkeit und Anteilnahme an dem, was es tut. Es reicht nicht zu warten, bis es Fragen stellt oder "Probleme" zur Sprache bringt. Es braucht und wünscht auch die wohlwollende Einmischung in sein Leben, daß man Interesse zeigt an seinen Plänen, Wünschen, Erfahrungen und Mißerfolgen.
5. Es braucht Aufgaben, an denen es seine Kräfte messen und seine Fähigkeiten entfaIten kann. Von den Aufgaben in der Familie war schon die Rede. Aber natürlich spielt auch die Schule hier eine bedeutende Rolle. Nach dem Gesetz des Generationenvertrages ist das Kind verpflichtet, seine Fähigkeiten zu entfalten. Aber dazu braucht es Ermutigung und Unterstützung seitens der Eltern. Über Schulpolitik ("Gesamtschule ja oder ein?") geht der Streit immer noch weiter. Vom Standpunkt des Kindes aus betrachtet sind diese Streitigkeiten ziemlich belanglos. Es braucht den Schultyp, der seinen Interessen und Fähigkeiten am ehesten entspricht - das kann in einem Falle eine Gesamtschule sein, im anderen Falle ein altmodisches Gymnasium. Wichtig ist, daß die geistigen und sozialen Fähigkeiten des Kindes ausgereizt werden, daß es entsprechend gefördert, aber auch gefordert wird. Auch in dieser Hinsicht sind die Kinder relativ konservativ: Sie wollen Lehrer, die etwas können, die das auch beibringen können und die im übrigen "nett" sind.
6. Das Kind braucht Respekt vor seinen Gefühlen wie vor seiner Persönlichkeit überhaupt. Es ist respektlos, wenn der Stiefvater unbedingt "Vater" genannt werden will; wenn ein Kleinkind gegen seinen erkennbaren Willen "abgeknutscht" wird; wenn man sich über den Freund der Tochter beziehungsweise die Freundin des Sohnes lustig macht; wenn man Kinder drängt, ihre Gefühle zu äußern und so fort. Respektlos ist auch, Kinder zu bestrafen - außer im Sinne der Wiedergutmachung. Strafe ist eine öffentliche Kategorie; in der Familie würde sie zu einem Zwei-Klassen-Recht führen; die einen dürfen bestraft werden, die anderen (die Erwachsenen) nicht. Respekt vor Kindern ist bei uns immer noch wenig verbreitet und kaum ein Maßstab für den Umgang mit ihnen.
7. Kinder brauchen Erwachsene zum Anfassen - keine Eltern, die mit dem Ratgeber in der Hand ihre Kinder "behandeln", sondern solche, die ehrlich bleiben, auch wenn sie im Unrecht sind - und die auch meinen, was sie sagen. Nur auf eine solche Offenheit können Kinder sich mit gleichen Chancen einlassen; pädagogisches Getue können sie zunächst nicht durchschauen, und wenn sie es dann irgendwann durchschaut haben, droht das Vertrauen zu schwinden.
Diese Verhaltensweisen kann grundsätzlich jeder Erwachsene Kindern gegenüber an den Tag legen, und zwar deshalb, weil sie auch für den Umgang zwischen den Erwachsenen eine zentrale Bedeutung haben. Kinder brauchen, abgesehen von der besonderen Rücksichtnahme auf ihre "Kleinheit", nichts anderes, als was der erwachsene Partner auch braucht. Ein primär soziales Verständnis der Familie ermöglicht also einigermaßen mühelos, die Rolle eines Stiefvaters oder einer Stiefmutter zu übernehmen, wenn man sich klarmacht, daß es sich da nicht um Vater- oder Mutter"ersatz" handeln muß, sondern daß da eine Beziehung mit eigener Würde entstehen kann, die auf ihre Weise ein befriedigendes Aufwachsen von Kindern erst möglich machen kann.
Indem wir den Kindern diese Verhaltensweisen entgegenbringen, ermöglichen wir ihnen, diese ebenfalls zu lernen. Und zwar als Folge eigener, positiver Erfahrungen. Umgekehrt lernen die Erwachsenen, daß die Kinder im Grunde denselben Umgang brauchen und damit die gleichen Bedürfnisse haben wie sie selbst. Insofern läßt sich die Familie verstehen als eine soziale Lerngemeinschaft, die wie ihre einzelnen Mitglieder auch als Gemeinschaft reifer werden kann.
5. Die bösen "Miterzieher"
Ich habe noch erlebt, was man eine "behütete" Kindheit nennt - mitten im "Dritten Reich" und im Zweiten Weltkrieg. Das soll heißen: Die für mich zuständigen Erwachsenen behielten das moralische Interpretationsmonopol. Was "gut" und "richtig" ist, wurde zu Hause entschieden und von uns Kindern selbstverständlich akzeptiert. Daran prallte sogar die Nazi-Propaganda ab; sie war zu Hause, abgesehen von den Kriegsberichten, einfach kein Thema. Obwohl zum Beispiel der Rundfunk ständig von der "Vergewaltigung" deutscher Frauen im Osten berichtete, hatte ich bis zum Kriegsende keine genaue Vorstellung davon, was damit eigentlich gemeint war; ich stellte mir darunter so etwas wie "grausame Ermordung" vor.
Wahrscheinlich war meine "behütete Kindheit" auch für meinen Jahrgang eine Ausnahme, aber sie ist im Grunde immer noch das pädagogische Ideal: Kinder sollen unter der Aufsicht von Erwachsenen heranwachsen, und diese bestimmen deren "Lebensraum"; sie lassen nichts an das Kind heran, was seiner Entwicklung schaden könnte. Kommt das Kind in die Schule, gehen die Lehrer ein entsprechendes Bündnis mit den Eltern ein.
Dieses pädagogische Ideal hat allerdings zur Voraussetzung, daß auch das öffentliche Leben, sofern es Kindern zugänglich ist, keine erziehungsfeindlichen Wirkungen ausstrahlt. Der kindliche Erfahrungsraum ist von dem der Erwachsenen streng zu trennen. Was kindgemäß ist und was nicht, darüber gibt es einen Konsens aller Erwachsenen; in alten Filmen findet sich dieses Leitbild zuhauf.
Spätestens seit der Verbreitung des Fernsehens ist diese Idylle zerbrochen. Die Welt der Erwachsenen mit ihren Problemen und ihrem Wertpluralismus drängt über den Bildschirm in jede Familie hinein und zerstört unaufhaltsam das Interpretationsmonopol der für das Kind zu ständigen Erwachsenen. Was eine Vergewaltigung ist, können Kinder mehr oder weniger detailgetreu am Fernsehen kennenlernen. Kein Wunder, daß die Pädagogen diesen bösen Miterzieher anklagen.
Es wäre jedoch einseitig, das Fernsehen nur als Zerstörer des kindlichen Lebensraumes zu sehen. Es hat andererseits auch einen unschätzbaren Wert für die Demokratisierung unserer Gesellschaft, gerade weil es die lokalen Informations- und Wissensmonopole der Pfarrer und Lehrer erschüttert und sie gezwungen hat, ihre Kenntnisse und Standpunkte im Wettbewerb mit anderen zu vertreten. Zudem hat das Fernsehen das Informationsniveau breiter Bevölkerungsschichten zu allen den Alltag betreffenden Fragen bedeutend angehoben.
Das frühere Interpretationsmonopol der Eltern ist aber auch durch die Vermarktung des kindlichen Lebensraumes ausgehöhlt worden; sie begann nach dem Ersten Weltkrieg und hat uns schon damals einerseits die Jugendschutzgesetze gebracht (die immer bedeutungsloser geworden sind), andererseits tiefsitzende pädagogische Ressentiments gegen die Massenmedien und gegen die Konsumgesellschaft.
In der Tat richtet sich der Markt nicht nach pädagogischen Grundsätzen ("Was ist gut für Kinder?"), sondern nach ökonomischen ("Was kann ich an oder über Kinder verkaufen?"). Jedoch hat der Markt auch die Kinder teilweise emanzipiert von ihren Eltern und Lehrern. Der modische Geschmack zum Beispiel, den die Mutter gern ihrer Tochter vermitteln möchte, kann in Widerspruch geraten zum Gruppengeschmack der Gleichaltrigen, nicht wenige Konflikte sind hier vorprogrammiert.
Die Gleichaltrigen sind ebenfalls ein neues Phänomen. Sie sind nicht nur der Freundeskreis, den es immer schon gab; sie sind darüber hinaus eine Instanz geworden, in der viele praktische wie auch normative Fragen entschieden werden, oft genug gegen die Ansichten der Eltern. Außerhalb der Familie sind es auch nicht mehr böse Erwachsene, die Jugendliche zur Sexualität, zu Alkohol oder Drogen "verführen", wie die Jugendschutzgesetze immer noch unterstellen; vielmehr verführen sich Jugendliche in ihren Gruppen heute selbst zu "abweichendem Verhalten" - natürlich nur in Ausnahmefällen, aber niemand kann wissen, ob und wann sein Kind zu diesen Ausnahmen gehören wird.
Andererseits können die Eltern nicht generell die Beziehungen zu den Gleichaltrigen verbieten, weil die Kinder lernen müssen, sich in solchen Gruppen zu bewegen, Verführungen rechtzeitig zu erkennen und zu vermeiden. Oft bieten solche Gruppen auch eine Art von Geborgenheit, die zu Hause vermißt wird.
Massenmedien, Konsummarkt und die Gruppen der Gleichaltrigen sind also zu Miterziehern geworden, deren Einfluß die Eltern nicht mehr in der Hand habe. Wie sollen sie sich dazu verhalten?
Es wäre ein Fehler, diese Miterzieher lediglich negativ zu sehen, nur weil sie das pädagogische Monopol gebrochen haben. Vielmehr wird durch sie das Kind schon früh in das gesellschaftliche Leben außerhalb der Familie einbezogen. Im Unterschied zu meiner Kindheit sind Kinder heute viel aufgeklärter, welterfahrener und informierter. Sie sind zum Beispiel nicht nur Konsumkinder, die unbedingt das haben müssen, was die anderen Kinder auch haben, sie verstehen auch eine Menge von den Dingen.
Das Interpretationsmonopol der Eltern ist zwar gebrochen, aber das heißt noch lange nicht, daß sie nun keine Bedeutung mehr hätten für das moralische Bewußtsein der Kinder. Etwa bis zu den ersten Grundschuljahren bleiben die Eltern immer noch die wichtigsten Bezugspersonen für die Kinder. Und es ist keineswegs "unmodern", wenn sie in dieser Zeit den Lebensraum des Kindes auch kontrollieren, zum Beispiel im Hinblick auf den Fernsehkonsum. In dieser Zeit brauchen die Kinder die moralische Übereinstimmung mit ihren Eltern, normative Pluralität wie sie das Fernsehen ausstrahlt, können sie noch nicht verarbeiten. Zusammen mit den Kindern regelmäßig eine Kinderserie zu sehen (Kinder sind "Serien-Fans") und darüber zu sprechen, kann zu einem der wohltuenden Familienrituale werden, wie Kinder sie gern haben (das "Immer-Wieder").
Beginnend mit dem Schuleintritt nehmen die Einflüsse der Miterzieher ständig zu. Jetzt wird entscheidend, wieviel Aufmerksamkeit und Anteilnahme die Eltern am außerfamiliären Leben der Kinder aufbringen; denn normalerweise legen die Kinder weiterhin großen Wert darauf zu erfahren, wie die Eltern das beurteilen, was sie tun und denken. Früher, als die Eltern noch die Macht hatten, zu entscheiden, "wo es langgeht", waren sie auch wenig flexibel, mehr oder weniger unfähig, etwas dazuzulernen und ihre Standpunkte zu revidieren. In diesem Sinne waren sie schon früh alt. Erwachsensein war geradezu dadurch definiert, daß man nichts mehr lernen mußte, sondern ein fertiger Mensch war.
Heute dagegen haben Eltern die Chance, von ihren Kindern zu lernen, auch von deren Erfahrungen, Erlebnissen, Plänen, Hoffnungen und Enttäuschungen; auf diese Weise bleiben sie jünger als früher. Andererseits haben die Kinder von einem solchen Erfahrungsaustausch mit den Eltern nur dann etwas, wenn die Eltern dabei auch ihre wirklichen Standpunkte und Überzeugungen, also ihre eigene Lebenserfahrung, einsetzen - ohne Anbiederung, ohne erhobenen Zeigefinger und sonstiges pädagogisches Getue.
Aus dem früheren Interpretationsmonopol der Eltern ist die Interpretationsgemeinschaft der Familie geworden: Das Leben und die Erfahrungen aller Familienmitglieder werden zu Hause besprochen, und aus diesen Gesprächen erwachsen meist ohne jede Absicht Ratschläge, bei diesen Gelegenheiten wird ermutigt, unterstützt, aber auch kritisiert. Je älter die Kinder werden, um so wichtiger sind ihre Erfahrungen und Deutungen auch für die Eltern. Aber auch jüngere Kinder sind nicht selten kleine Philosophen, deren Fragen und Meinungen gerade wegen ihrer Unbefangenheit Erwachsene durchaus zum Nachdenken bringen können. Erfahrungen sind ja nichts anderes als die Quintessenz des bisher gelebten Lebens, und insofern sind alle Erfahrungen grundsätzlich gleichberechtigt. Die pädagogische Qualität der Familie erweist sich nicht darin, daß die Eltern irgend etwas planmäßig pädagogisch veranstalten, sondern darin, daß zwischen Eltern und Kindern ein ständiger Erfahrungsaustausch stattfindet - in einem Klima von Gelassenheit und Angstfreiheit. Nur so können die Eltern im Wettbewerb mit den "Miterziehern" auf dem aktuellen Stand bleiben.
Im übrigen sollte im Blick bleiben, daß es der pädagogische Sinn des Kindes- und Jugendalters ist, seine Fähigkeiten auf den verschiedensten Gebieten zu entwickeln. Angesichts der erwähnten möglichen Gefährdung durch die Gleichaltrigen-Gruppen (Zugang zu "abweichenden Subkulturen") sollten die Eltern ihre Kinder zu sachbezogenen Freizeittätigkeiten ermuntern (Sport, Musik, Hobbys) - auch dann, wenn durch ein solches Engagement die Schulleistungen etwas leiden sollten; denn was heute nur Hobby ist, kann morgen zur Grundlage eines Berufes werden, und dabei kommt es nicht nur auf die Schulleistungen an. Gefährdet sind vor allem solche Gruppen von Gleichaltrigen, die keine "gemeinsame Sache" haben, sondern sich nur nur selbst zum Thema machen können.
6. Jedes Jahr ein Stückchen mehr
Peter W. ist 21 Jahre alt, hat mit siebzehn "die Schule geschmissen", sich seitdem nicht um Arbeit bemüht und lebt mit seiner Freundin in einer kleinen Wohnung, die seine Mutter für ihn gemietet hat. Einmal die Woche putzt die Mutter die Wohnung. "Es ist ja meine Wohnung", sagt sie.
Vor einiger Zeit war in einer Illustrierten (Stern 1/85) eine Reportage zu lesen über "die neuen Paschas". Gemeint waren damit herangewachsene Söhne und Töchter, die zum sozialen Nulltarif weiterhin zu Hause wohnen, sich aber "von vorne bis hinten bedienen lassen" - natürlich vor allem von der Mutter. Die Mütter, die dabei zu Worte kamen, ließen sich diese Ausnützung unter anderem deshalb gefallen, weil sie ein schlechtes Gewissen hatten. Sie fürchteten, ihre Kinder könnten seelischen Schaden nehmen, wenn man ihren Erwartungen nicht entspräche. Viele schon erwachsene Kinder erliegen der Versuchung, die Verantwortung für ihr Leben gar nicht erst selbst zu übernehmen, weil sie es besser als bei Mutter gar nicht haben könnten. Inzwischen soll es für solche Mütter schon "Selbsthilfegruppen" geben.
Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Manchmal verlassen Kinder schon vor der Volljährigkeit ihre Familie, um sich meist gemeinsam mit Gleichaltrigen oder als Paar eine eigene Wohnung zu nehmen. Wenn die Kinder studieren, ist es ohnehin meist unvermeidlich, daß sie wenigstens zeitweise zu Hause ausziehen.
Schließlich gibt es diejenigen, die gerne zu Hause ausziehen und ihr täglich Brot selbst verdienen möchten, die aber keine Arbeit finden.
Der Auszug der Kinder als sichtbares Zeichen, daß sie nun erwachsen geworden sind, ist immer ein wenig heikel. Manche Ehe bricht nun endgültig auseinander, weil nur noch die gemeinsamen Kinder sie zusammengehalten hat. Aus diesem Grunde wird andererseits nicht selten der Auszug der Kinder hinausgezögert. Psychoanalytiker sagen uns, daß die Ablösung der Kinder vom Elternhaus notwendigerweise zu einer Krise zwischen den Generationen führe. Aber daß es oft so ist, heißt nicht, daß es so sein muß. Psychoanalytiker gewinnen ja ihre Erkenntnisse aus Krankengeschichten, die sie dann leicht verallgemeinern; oder sie konstruieren ein Bild vom schönen Aufwachsen, von "guter Kindheit", aus dem alles verbannt ist, was seelisch krank machen könnte - ein unerreichbares Ideal.
Ein gewisses Maß an Wehmut und Traurigkeit ist sicher normal, wenn die Kinder ihre Familie verlassen und in Zukunft nur noch "zu Besuch kommen" werden. Aber was darüber hinausgeht und zum Beispiel zu schweren Konflikten führt, ist ein Indiz dafür, daß Selbstverantwortung und Selbständigkeit der Kinder nicht genügend gefördert und gefordert worden sind. Schon bei der Geburt eines Kindes muß klar sein: Die familiäre Lebensgemeinschaft mit diesem Kind ist auf ihre Auflösung angelegt, unauflöslich ist - wenigstens der Idee nach - nur die Ehe der Eltern.
"Ich werde meine Kinder immer mehr lieben als meinen Mann", kann man oft von alleinerziehenden Frauen hören, die wieder eine Partnerschaft mit einem Mann eingehen wollen. Ein solcher Satz ist, streng genommen, natürlich falsch, weil da zwei verschiedene "Lieben" miteinander verrechnet werden.
Solange die Kinder klein sind, muß sich das Leben der Eltern mehr oder weniger um sie herum gruppieren, das bedeutet auch Verzichte auf manche gemeinsame Tätigkeit (zum Beispiel Urlaubsreisen oder abendlichen Ausgang). Aber in dem Maße, wie die Kinder selbständiger und selbstverantwortlicher werden, haben die Eltern nicht nur das Recht, sondern geradezu auch die Pflicht, ihre "gemeinsamen Sachen" zu betreiben, auch wenn die Kinder daran keinen Anteil haben; denn die soziale Zuverlässigkeit der Familie, die Kinder so sehr brauchen, kann nur erhalten bleiben, wenn auch die Eltern ein befriedigendes Leben miteinander fuhren können. Aus diesem Grunde braucht auch eine alleinerziehende Mutter gegenüber ihren Kindern kein "schlechtes Gewissen" zu bekommen, wenn sie nach einer befriedigenden Partnerschaft Ausschau hält. Wenn sie nämlich damit Erfolg hat, kann das ihren Kindern nur zugute kommen.
Schlimm für Eltern wie Kinder ist vielmehr, wenn auf die Dauer die Kinder die einzige Gemeinsamkeit der Eltern werden; den Kindern wird damit der nötige Autonomiespielraum genommen, und die Eltern leben sich auseinander. Es ist keineswegs lieblos, den Kindern zu sagen, daß man sich auch deshalb über ihr Größerwerden freut, weil damit die Eltern einen größeren Spielraum für ihre Gemeinsamkeiten finden; die Freizeitinteressen der beiden Generationen gehen ohnehin schon früh auseinander
Der ständige Blick auf die Unmittelbarkeit der Beziehungen in der Familie hat unser Bewußtsein davon getrübt, daß die Familie für die Kinder nur ein Durchgangsstadium ist. Die Kinder verlassen ihre Familie nicht erst zum Zeitpunkt der Volljährigkeit, sondern vom Tag ihrer Geburt an - jeden Tag und jedes Jahr ein Stück mehr. Und nur wenn wir von diesem Ende her denken, gewinnen wir eine Perspektive, eine Zukunftsorientierung für den Alltag des Familienlebens. Und nur dann gewinnen wir eine zutreffende Vorstellung davon, was Erziehung in der Familie eigentlich heißt.
Bei seiner Geburt ist das Kind ein hilfloses Wesen, das ohne die Hilfe Erwachsener zugrunde gehen müßte. Von der Erfahrung dieser Hilflosigkeit her glauben wir leicht, daß das Kind ohne unser Eingreifen, ohne daß wir "etwas aus ihm machen", niemals groß werden könnte. Tatsächlich aber macht das Kind sich selbst zum Menschen und zwar dadurch, daß es unendlich viel lernt. Die Erwachsenen - die Eltern, aber auch pädagogische Profis wie die Lehrer - sind dazu da, ihm beim Lernen zu helfen. Aber mit dem, was das Kind lernt, emanzipiert es sich ein Stück von den Erwachsenen: wenn es laufen kann, kann es selbständig größere Räume erobern; wenn es lesen kann, kann es im Prinzip alles lesen, was gedruckt ist, und muß sich nicht mit der Auswahl begnügen, die die Eltern vorlesen.
Der Sinn des Aufwachsens von Kindern kann also nur sein, daß sie lernen, Zug um Zug ihr Leben selbst in die Hand zu nehmen. Dazu brauchen sie die soziale Zuverlässigkeit der Familie. Wie mühselig das Großwerden ist, kann man zum Beispiel nach einer Scheidung sehen, also wenn die soziale Zuverlässigkeit der Familie zunächst einmal zusammengebrochen ist. Dann sinken oft die Schulleistungen ab, einfach weil alles zusammen nun zuviel Kraft kostet.
Das Größerwerden des Kindes trifft nun aber oft auf gegenteilige Interessen der Erwachsenen. Von der im Grunde erpresserischen Versuchung der Verwöhnung war schon in einer früheren Folge dieser Serie die Rede, und die an der Mutter hängenden "neuen Paschas" sind nur ein sichtbarer Ausdruck dafür. darüber hinaus dient die Kleinheit des Kindes oft als Identitäts-Krücke für Erwachsene, die sich aus eigener Kraft zu schwach fühlen, um genügend Selbstbewußtsein zu entwickeln. Dieser Versuchung erliegen nicht wenige alleinerziehende Mütter, wobei eine wichtige Rolle der besondere Druck spielen dürfte, der auf ihnen lastet: Man muß alle Probleme ohne Partner lösen, und die Umwelt glaubt ohnehin, "daß aus solchen Kindern nichts werden könne".
Gelegentlich wird diese Schwäche als Triumph verkündet; in manchen Kreisen gilt es als "schick", ein Kind zu bekommen und ohne Mann aufzuziehen. Nicht zu vergessen die "Bündnispolitik", die viele Erwachsene mit den Kindern gegen den Partner - meistens den Vater - betreiben. Überhaupt scheint es so, daß nicht mehr die "autoritären Väter" das pädagogische Problem sind, die frühere Kindergenerationen in Angst und Schrecken versetzt haben.
Inzwischen sind eher Mütter das Problem - vor allem auch solche, die keine außerfamiliäre berufliche oder sonstige Aufgabe haben und ihre ganze Energie auf Haushalt und Kinder werfen können. Das Großwerden der Kinder behindern sie "mit sanfter Gewalt", nämlich durch emotionale Besetzung. Sie sind wohl auch das Hauptpublikum für die zahlreichen psychologischen Beziehungsapostel. Zu diesem Publikum gehören aber auch jene Eltern, die das Familienleben unermüdlich pädagogisieren, um ihr Kind besser wettbewerbsfähig mit anderen Kindern zu machen.
Demgegenüber wollte diese Serie zeigen: Die pädagogische Qualität der Familie liegt nicht darin, daß die Eltern wie Lehrer oder Therapeuten mit ihren Kindern umgehen, sondern in der Güte des familiären Gemeinschaftslebens selbst. Wenn die Kinder daran mit Rechten und Pflichten beteiligt sind; wenn die Eltern dabei Selbständigkeit, Selbstbewußtsein und Selbstverantwortung fordern und fördern, wenn die Kinder dabei so behandelt werden, wie die Erwachsenen sinngemäß auch von ihrem Partner behandelt werden wollen - dann kann die Familie den Auszug der Kinder als Ergebnis eines langen, von Eltern und Kindern gewollten, beiderseitigen Emanzipationsprozesses und somit als Erfolg der Gemeinschaft verbuchen.

152. Jugendarbeit in der massenmedialen Freizeitgesellschaft (1987)
(In: Jugendforum, H. 7/1987, S. 3-6)
Wir haben uns angewöhnt, von den "heimlichen Miterziehern" zu sprechen, wenn wir die Sozialisationswirkungen der modernen Massenmedien meinen. Darin drückt sich ein Ressentiment aus, ein Gefühl der Bedrohung derjenigen, die "eigentlich" für die Erziehung zuständig sind (Eltern, Lehrer, Sozialpädagogen) und die sich in ihren guten Absichten behindert fühlen durch diese Konkurrenz. Dieses Ressentiment hat einen guten Grund! Die Massenmedien nämlich haben - mit der Erfindung des Kinos und des Rundfunks beginnend - die Autorität der persönlich Verantwortlichen, jeweils zuständigen Erziehe Zug um Zug untergraben. Sie sind in erster Linie mitverantwortlich dafür, daß der überlieferte Begriff der Erziehung immer weniger die Wirklichkeit der Heranwachsenden trifft. Unter Erziehung im überlieferten Sinne verstehen wir ja das Bemühen bestimmter Erwachsener, auf bestimmte Minderjährige derart einzuwirken, daß diese dauerhaft bestimmte Einstellungen und Verhaltensweisen erwerben, die wir, die Erzieher, für richtig halten. Solche Absichten setzen aber voraus, daß Kinder und Jugendliche in einem gesellschaftlichen "Schonraum" aufwachsen können, der von den Pädagogen kontrolliert werden kann gerade auch hinsichtlich der Einflüsse, die von außen darauf einwirken. Das aber ist nur noch für die ersten Kindheitsjahre im Schoße der Familie möglich. Die Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, haben diesen Schonraum beseitigt einfach dadurch, daß sie allen Menschen dieselben Botschaften verkünden, den Jungen wie den Alten, den Kindern wie ihren Erziehern, den Männern wie den Frauen. Damit werden alle Grenzen verwischt, die die Menschen früher kulturell voneinander getrennt haben (1). Es gibt im Prinzip kein Wissens- und Informationsmonopol der einen über die anderen mehr, auch nicht der Erzieher gegenüber den Minderjährigen.
Es wäre jedoch falsch, die Massenmedien isoliert zu sehen, so groß ihre Bedeutung auch ist. Für sich genommen wäre zum Beispiel die Existenz des Fernsehens bedeutungslos, wenn die Menschen nicht die Zeit hätten, seine Sendungen zu sehen, und wenn sie nicht das Geld hätten, sich ein Gerät zu kaufen, ohne deshalb am Hungertuche nagen zu müssen. Die kulturelle Revolution, in der wir uns befinden, und die uns zwingt, über das Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen neu nachzudenken, beruht auf drei Faktoren, die einander bedingen und sich gegenseitig verstärken: Freizeit, Geld und hochwertige Massentechnologie. Die Menschen haben eben nicht nur mehr Freizeit bekommen, sondern sie haben auch mehr Geld zur Verfügung, das sie in der Freizeit ausgeben können, und sie leben in einer bestimmten sozial-technischen Güter-Umwelt (vom Auto bis zum Videorecorder). Dieser Prozeß begann allmählich gegen Ende des vorigen Jahrhunderts mit der Einführung des arbeitsfreien Sonntags und dem Kampf um die 48-Stunden-Woche sowie mit den zaghaften Anfängen tariflicher Urlaubsregelungen, um dann seit den 60er Jahren sich sprunghaft zu entfalten. Es lohnt sich, diesen Prozeß etwas genauer zu betrachten.
1. Für immer mehr Menschen hört die Arbeit auf, der Mittelpunkt ihres Lebens zu sein. Gegenwärtig wird ernsthaft diskutiert, Menschen dafür zu bezahlen, daß sie nicht arbeiten bzw. Arbeit suchen, der Kampf um Arbeitszeitverkürzung gehört zum täglichen Brot der Gewerkschaften, und das Ziel ist, die vorhandene Arbeit möglichst breit zu verteilen.
Diese Entwicklung ist für unser Erziehungsverständnis von nicht zu überschätzender Bedeutung. Die Arbeit war nämlich bisher auch der moralische Mittelpunkt unseres Lebens, von dem aus alle anderen Lebenstätigkeiten ihren Sinn erhielten. Bisher wurden wir erzogen zu den Tugenden, die für eine erfolgreiche Karriere in der Arbeitswelt gebraucht wurden, wie Unterordnung, Gehorsam, Sparsamkeit usw. Diese Tugenden galten auch für unser Privatleben, "Erholung" wurde verstanden als eine Art von Belohnung für freudiges Schaffen, wie es in dem Nazi-Slogan "Kraft durch Freude" sinnfällig zum Ausdruck kommt. Das Leben in der massenmedial bestimmten Freizeit ist von fast den gegenteiligen Tugenden bestimmt: Gleichrangigkeit statt Unterordnung; Verständigkeit statt Gehorsam; auf Kredit leben statt Sparsamkeit. Ganz allmählich hat sich im Rahmen dieser Entwicklung auch das gesellschaftliche Zeitverständnis geändert: Die Arbeitsgesellschaft war zukunftsorientiert, die Gegenwart galt als Durchgangsstadium, das für eine bessere Zukunft geopfert werden müsse; die mediale Freizeitgesellschaft dagegen ist gegenwartsorientiert. Die Erfahrungen, die wir in ihr machen, widersprechen den alten Arbeitstugenden und werden immer mehr auch gegen die Ansprüche der Arbeitswelt bzw. der Schule gewendet. Das ist im Grunde gemeint, wenn heute immer wieder vom "Wertewandel" gesprochen wird. Zukunft aber war der Legitimationsgrund der bisherigen Erziehung: das Kind sollte jetzt zu Ordnung, Fleiß und Sparsamkeit erzogen werden, damit es eine gute Zukunft hat. Aber gerade diese Legitimation von Erziehung, im Sinne einer persönlichen Verantwortung von Eltern und anderen
3
Pädagogen für die Zukunft des Kindes, woraus sich dann im einzelnen erzieherische Handlungen ergaben, wird immer unrealistischer. Das belegt auch die jüngste Shell-Jugendstudie (2). Pädagogik in der Familie z.B. reduziert sich auf den unmittelbaren, jeweils gegenwärtigen Umgang zwischen den Generationen, nimmt also den Charakter von naturwüchsiger Sozialisation an. Sieht man sich den Umgang der Generationen in normalen Familien an, so ist der Druck auf die Schulleistungen der Kinder fast das einzige, was von Erziehung noch übrig geblieben ist. Die meisten Ärgernisse mit Kindern erwachsen schlicht aus dem alltäglichen Zusammenleben, nicht aus darüber hinausgehenden pädagogischen Intentionen. Mit dem "Entschwinden der Arbeitsgesellschaft" (Dahrendorf) (3) entschwindet auch "Zukunft" als leitende Zeitperspektive und damit die überlieferte Legitimation von Erziehung.
2. Erst mit zunehmender Freizeit konnte die Masse der Bevölkerung die Erfahrung von politischem und normativem Pluralismusmachen. Diese Erfahrung, daß man nämlich die Grundfragen des Lebens sehr unterschiedlich deuten und sein Verhalten entsprechend regulieren kann, daß man also Weltanschauungen bzw. Normen bis zu einem gewissen Grade wählen kann, zerstörte die Selbstverständlichkeit des jeweils eigenen kulturellen Milieus (z. B. Bildungsbürgertum; Katholizismus; Protestantismus mit seinen Variationen; sozialistische Arbeiterbewegung). Für diese Entwicklung gibt es historisch eindrucksvolle Beispiele (4). So gingen z.B. die Arbeiter, je mehr Freizeit sie bekamen, auf Distanz zur Politik bzw. zur Arbeiterbewegung, entgegen allen Voraussagen bzw. Hoffnungen oder Befürchtungen. Oder das katholische Milieu in der Weimarer Zeit versuchte, durch eigene Bibliotheken und durch ein sehr differenziertes Publikationswesen die Gemeinde zusammenzuhalten, also vom normativen Pluralismus abzuschirmen. Aber die Erfindung des Kinos und des Rundfunks waren milieuübergreifend um nicht zu sagen: an jedem besonderen Milieu desinteressiert. Die Botschaften dieser modernen Medien waren eben nicht spezifisch für ein bestimmtes Milieu formuliert, sondern im Prinzip an jedermann adressiert. Darin lag ihre "zersetzende" Wirkung, wie die Nazis richtig gesehen hatten. Die Gesinnungskontrolle, die die Nazis noch durchsetzen konnten durch die "Gleichschaltung" der Medien, beruhte lediglich auf einem technischen Mangel: Die Radioempfänger waren z.B. noch nicht entwickelt für einen weltweiten Empfang bzw. solche Geräte waren für die Masse der Menschen zu teuer. In der DDR hat man lange versucht, Westfernsehen zumindest zu diskriminieren; davon ist längst keine Rede mehr, eben weil es keine Möglichkeit gibt, auf Dauer gegen die technische Verfügbarkeit durch Gesinnungskontrolle anzugehen. In der Freizeit und durch die modernen Medien transportiert vollzog sich also eine Art von Fundamentaldemokratisierung der Gesellschaft. Die Zerstörung der Milieus aber nimmt der Erziehung jene normativen Horizonte, die sie notwendigerweise braucht. Ein Perspektivenwechsel setzt ein: Das Kind wandelt sich vom Erziehungsobjekt zum Lernsubjekt. Immer mehr geht es darum, in Schule, Berufsausbildung und Freizeit seine Fähigkeiten sich entfalten zu lassen. Dieser Wandel hat auch die Schule erfaßt. Zwar sprechen unsere Kultusminister in ihren Erlassen immer noch von "Erziehung", aber die Wirklichkeit in den Schulen sieht anders aus. Die zunehmende Verrechtlichung und damit die zunehmenden administrativen Eingriffe haben die Stellung des Kindes bzw. seiner Erziehungsberechtigten verstärkt und die pädagogischen Eingriffe auf partikulare Lernleistungen begrenzt. Die Zensuren für Fleiß, Ordnung, Betragen sind längst abgeschafft, ebenso Auflagen der Schule für das Benehmen in der Freizeit, die es nach dem Zweiten Weltkrieg in den Schulordnungen noch gab. Hier zeichnet sich eine Entwicklung ab, in der der überlieferte Anspruch von "Erziehung" als ganzheitlicher, auf die ganze Person gerichteter abgeblockt wird zugunsten rein partikularer Lernerwartungen. Die staatlich monopolisierte Schule ist keine Erziehungsschule mehr, solche Schulen müßte man vielmehr als weltanschauliche wählen können, und möglicherweise geht die Bildungspolitik auf Dauer in diese Richtung.
3. Erziehung im modernen Sinne setzt Zeit voraus. Die Arbeiterklasse bekam diese Zeit erst in dem Maße, wie sie Freizeit erhielt, also relativ spät. Freizeit ermöglicht also erst Erziehung, aber sie schafft sie auch in dem Maße ab, wie der in ihr wirkende Marktmechanismus der Freizeitindustrie und der durch die Massenmedien verbreitete Pluralismus die alten Erziehungsmächte (Familie, Schule, Kirche) entmachtete. Erziehung im überlieferten Sinne setzte immer voraus, daß die persönlich zuständigen Erzieher sich der Rückendeckung der anderen Sozialisationsfaktoren sicher sein konnten. In der Freizeit jedoch erwuchs den Erziehern nicht nur ein tatsächlicher, sondern auch ein normativer Konkurrent. Ist die pädagogische Leitfrage, was gut für die Entwicklung von Kindern ist, so fragt der Markt danach, was man an Kinder bzw. über sie verkaufen kann. Freizeit war nie nur das einfache Vorhandensein von Zeit, sondern ein gesellschaftliches System, das den Regeln des Marktes gehorchte. Der Einbruch des Marktes in die Lebenswelt von Kindern und Jugendlichen hat sehr wesentlich neben den Massenmedien zur Entmachtung der Erzieher beigetragen. Die Idee des Marktes war vom Beginn der bürgerlichen Gesellschaft an auf Expansion angelegt, d.h., keine markffreien Räume zu dulden, auch nicht in Gestalt von Schonräumen für Kinder und Jugendliche. Zwar hat man schon in der Weimarer Zeit versucht, die Einflüsse des Freizeitmarktes auf Heranwachsende durch Jugendschutz zu begrenzen, aber der Freizeitmarkt und die Massenmedien als dessen Vermittler haben den Lehrern und Pfarrern ihr Informationsmonopol entrissen, und das hat bis heute tiefe Kränkungen und Ressentiments hinterlassen.
4. Fernsehen und Freizeitmarkt haben die überlieferten Bildungsprivilegien zerstört oder zumindest erheblich relativiert. Daher rührt die jahrzehntelange Kritik des Bildungsbürgertums am Freizeitleben der Menschen und an ihrem Umgang mit den Massenmedien. Solange Bildung in der Schule monopolisiert war, schuf sie Privilegien. Das Fernsehen und die anderen Massenmedien haben die Verbreitung des Wissens demokratisiert, und die Kritiker der Massenmedien vergessen zu leicht, daß das am geschriebenen Wort orientierte Bildungsbürgertum immer eine Minderheit war. Vor allem das Fernsehen hat die Chance vergrößert, zu dieser Minderheit zu stoßen, aber man kann ihm nicht anlasten, daß nun nicht alle Jugendlichen studierfähig werden. Gerade die Menschen aus den unteren sozialen Schichten haben heute in allen sie betreffenden Alltagsfragen (Politik, Konsum, Erziehung) einen Informations-
4
stand erreicht, der für frühere Generationen undenkbar war. Diese Hebung des allgemeinen Niveaus fällt uns nur im Alltag nicht mehr auf.
5. In dem Maße, wie das Jugendalter sich von den Erziehungsmächten emanzipierte oder besser: emanzipiert wurde, und die kulturellen Milieus ihre Bindekraft verloren, separierten sich die Generationen, wurden die jugendlichen Gleichaltrigen zur teilkulturellen Szene. Diese Entwicklung setzte etwa Mitte der 50er Jahre mit dem Aufkommen der Rock'n Roll Musik ein, von da an begann die Gleichaltrigen-Szene sich auszubreiten an öffentlichen, aber sozial relativ wenig kontrollierten Orten (z.B. Diskothek). Es gibt kaum noch selbstverständliche öffentliche Kontakte zwischen den Generationen, Erwachsene treten den Jugendlichen nur noch als Funktionäre gegenüber, z.B. als Lehrer und Sozialpädagogen, oder als Verkäufer. Die Gleichaltrigen-Szene öffnet auch den Weg zu abweichenden Subkulturen - von Drogen bis Neo-Nazismus. "Jugendgefährdung" geht heute kaum noch vom Leben der Erwachsenen aus - wie die Jugendschutzgesetze immer noch unterstellen - sondern von Gleichaltrigen und deren sozialen Orten.
Die geschilderten Entwicklungen machen nicht nur den überlieferten Begriff "Erziehung" fragwürdig (5), sondern fordern auch zur Neubesinnung auf die pädagogischen Chancen von Familie (6), Schule und Jugendarbeit heraus. In der Jugendarbeit war übrigens der Erziehungsbegriff immer schon umstritten, die Jugendbewegung sprach immer von "Selbsterziehung", und der Jugendpflege ist es - vielleicht abgesehen von der Zeit der Hitler-Jugend - nie gelungen, Erziehungsansprüche in dem Maße durchzusetzen, wie dies lange Zeit in Familie und Schule möglich war. Die Konsequenzen für die Jugendarbeit möchte ich abschließend in einigen Thesen formulieren:
1. In der Jugendarbeit (wie in anderen professionellen pädagogischen Arbeitsfeldern auch) müssen wir Abschied nehmen von der Vorstellung, daß die Pädagogen wissen, was gut und richtig für die Entwicklung ihrer Partner ist. Pädagogen sollten sich vielmehr heute als "Lernhelfer" (7) verstehen, von und mit denen man etwas lernen kann, und die dafür geeignete Lernsituationen zu arrangieren imstande sind. Früher als alle pädagogischen Felder mußte die Jugendarbeit entdecken, daß sie sich auf ein partnerschaftliches Verhältnis zu den Jugendlichen einlassen muß, weil die sonst "mit den Füßen abstimmen" können.
2. Jugendarbeit war von Anfang an ein (subventionierter) Teil des Freizeitsystems im allgemeinen; sie wird von den Jugendlichen auch so beurteilt und ihre Angebote stehen im Wettbewerb mit anderen, gerade auch kommerziellen Freizeitangeboten. Diesem Wettbewerb muß sich die Jugendarbeit in dem Sinne stellen, daß sie sich auf die Bedürfnisse der Teilnehmer einläßt, um sie wirbt und herauszufinden versucht, welche Bedürfnisse von den kommerziellen Anbietern nichtoder nicht hinreichendbefriedigt werden können. Früher hatte die Jugendarbeit mit der vom Wandervogel erfundenen Idee des "Jugendgemäßen" (Jugend "als solche" will in einfachen Gruppenstrukturen unter Gleichaltrigen sein; sie wünscht Naturnähe und damit Distanz zur komplexen Zivilisation; sie braucht eine Teilkultur mit eigenen Symbolen, Moden und Ritualen; sie lebt sexuell enthaltsam) eine eigentümliche kulturelle Position im Freizeitsystem; aber auch diese Idee ging verloren mit dem Niedergang des bildungsbürgerlichen Milieus, dem sie entstammte. Jugendarbeit muß also wie die anderen Anbieter auch "auf den Markt gehen".
3. Jugendarbeit kann den normativen Pluralismus, in dem Kinder und Jugendliche aufwachsen, in mehrfacher Hinsicht produktiv aufgreifen: Einmal z.B. dadurch, daß sie diesen Pluralismus in ihren Feldern aufklärt und damit zu leben lehrt (z.B. in der "offenen Jugendarbeit"), zum anderen dadurch, daß sie in Gestalt der Jugendverbände soziale Bindungsangebote für unterschiedliche gesellschaftliche Positionen und weltanschauliche Richtungen macht.
4. Jugendarbeit war nie oder auch nur überwiegend eine pädagogischeVeranstaltung, wo ständig etwas gelernt werden sollte. Mindestens ebenso bedeutsam war und ist ihr geselligerCharakter, also eine Form befriedigenden Zusammenlebens, das seinen Sinn in sich selbst trägt. Dieser Gesichtspunkt ist durch die in letzter Zeit erfolgte Professionalisierung der Jugendarbeit etwas in den Hintergrund getreten, weil die "Profis" leicht dazu neigen, ein solches in sich selbst sinnvolles Zusammenleben als "Leerlauf" zu betrachten, für den sie nicht bezahlt würden, und leider denken die Anstellungsträger dies auch oft.
5. Hier macht sich ein Widerspruch bemerkbar, der vor allem in der offenen Jugendarbeit zu finden ist: Was für die jugendlichen Partner Freizeit ist, ist für die Pädagogen bezahlte Arbeit. Wenn aber Jugendarbeit ein Teil des Freizeitsystems ist, dann ist gemeinsames, unbezahltes Engagement von Jugendlichen und Erwachsenen, sofern dafür eine "gemeinsame Sache" gefunden werden kann, von großer Bedeutung. Eine wichtige Funktion der Hauptamtlichen wäre also, solche ehrenamtliche Mitarbeit zu ermöglichen und zu ermuntern, zumal Ehrenamtlichkeit auch unabhängiger von den Trägern und der Administration macht.
6. Insofern die Jugendarbeit Teil des Freizeitsystems ist, können die Angebote inhaltlich prinzipiell genau so offen sein wie das kommerzielle Angebot auch. Allerdings gibt es ein Grundproblem des jugendlichen Heranwachsens heute, um das herum sich die Angebote der Jugendarbeit fürs erste sinnvoll gruppieren ließen. Die kulturellen Prozesse, die ich beschrieben habe - Entschwinden der Arbeit und damit der Zeitkategorie Zukunft; die Durchsetzung des normativen Pluralismus und damit die Zerstörung der alten kulturellen Milieus; die Entmachtung der Erziehungsmächte und die Zerstörung von Bildungsprivilegien - haben eine eigentümliche Leere, nämlich soziale Desorientierung hinterlassen. Das Fehlen von sozialen Bindungen, die Möglichkeit, ihnen ständig auszuweichen, haben ein befriedigendes Heranwachsen zusätzlich problematisch gemacht. Soziale Bindungslosigkeit ist aber bekanntlich der Ursprung von Verwahrlosung, jedenfalls ein erhebliches Hindernis für die Identitätsfindung. Die Anforderungen, die heute an die Selbstverantwortungsfähigkeit von Jugendlichen gestellt werden, sind eben wegen des Fehlens kultureller Selbstverständlichkeiten und Vorgaben enorm hoch geworden.
Und nicht wenige suchen diesem Druck durch Flucht in eine Szene, ja, sogar durch Unterwerfung unter ein Gruppenkollektiv zu entfliehen. Die Massenmedien, vor allem auch die kommerziellen Jugendzeitschriften, bieten hier gleich-
5
sam "ldentitäts-Krücken" an, indem sie Identifikationen mit bestimmter Musik und mit bestimmten Stars nahelegen. Nach einigen Jahren sind solche Identifikationen meistens überwunden.
Auch die Jugendarbeit kann hier Identitätshilfen anbieten in den Gruppen Gleichaltriger und im Meinungs- und Erfahrungsaustausch mit Erwachsenen, manchmal sogar in Form regelrechter Bildungsarbeit. Jugendliche wachsen heute heran im Rahmen eines komplizierten Sozialisationssystems von Familie, Schule, Berufsausbildung, Massenmedien, Gleichaltrigengruppe und Freizeitsystem. In diesem Prozeß des Aufwachsens machen sie zum Teil höchst unterschiedliche, ja normativ durchaus auch widersprüchliche Erfahrungen. Aber vielen - wahrscheinlich den meisten - reicht das, was sie dabei lernen, um ein hinreichendes Maß an Identität zu finden. Noch nie waren alle Jugendlichen für die Jugendarbeit zu gewinnen. Aber für Minderheiten waren und sind die Angebote der Jugendarbeit eine wichtige Lernhilfe, und zwar vor allem für diejenigen,
1. die eine soziale Geborgenheit suchen, die sie sonst außerhalb der Familie nicht finden können, um ein hinreichendes Maß an Identität zu finden;
2. die eine zum üblichen kommerziellen Freizeitangebot alternative, vielleicht auch nur billigere Freizeitgestaltung suchen, z.B. weil sie sich zu Hause wegen zu enger Wohnverhältnisse nicht mit ihren Freunden treffen können;
3. die eine ernsthafte Aufgabe suchen, die sie herauszuführen vermag aus ihrem teils pädagogisierten, teils konsumorientierten Leben, eine Aufgabe, die ihnen Engagement, Erfolgserlebnisse und Selbstbewußtsein ermöglicht.
Hier sehe ich den vielleicht wichtigsten Gesichtspunkt, daß die Jugendarbeit nämlich Realerfahrungen ermöglichen kann, indem sie z.B. ernsthafte Aufgaben im sozialen und ökologischen Bereich angeht, für die professionelle Tätigkeit nicht bezahlt werden kann oder für die rein professionelle Tätigkeit aus menschlichen Gründen auch gar nicht wünschenswert wäre.
Alles in allem jedoch ist die Jugendarbeit durch die skizzierte Entwicklung weit weniger betroffen als andere pädagogische Felder wie Schule und Sozialpädagogik; denn sie mußte sich immer schon im Wettbewerb des Freizeitmarktes behaupten und hat dies bisher auch mit Höhen und Tiefen überstanden.
6
Anmerkungen:
(1) Vgl. N Postman: Das Verschwinden der Kindheit. Frankfurt 1983.
(2) Vgl. Jugendwerk des Deutschen Shell (Hrsg.): Jugendliche und Erwachsene '85. Generationen im Vergleich. 5 Bde. Leverkusen 1985, hier vor allem Bd. 2.
(3) Vgl. R. Dahrendorf: Im Entschwinden der Arbeitsgesellschaft. in: Merkur H. 8/1980, S. 749-760
(4) Vgl. dazu: H Giesecke: Leben nach der Arbeit. Ursprünge und Perspektiven der Freizeitpädagogik. München 1983.
(5) Vgl. dazu: H Giesecke: Das Ende der Erziehung. Stuttgart 1985.
(6) Dazu ausführlicher H. Giesecke: Die Zweitfamilie. Stuttgart 1987
(7) Dazu ausführlicher H Giesecke: Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns. Weinheim-München 1987

153. Der Freizeitpädagoge (1987)
Über Kompetenzen und Berufschancen von "Lernhelfern" in der Freizeit
(In: Animation, Sept./Okt. 1987, S. 224-227)
Die moderne Gesellschaft hat zwei pädagogische Berufsgruppen hervorgebracht: die Lehrer (von der Grundschule bis zur Hochschule) und die Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiter. Während das Berufsbild des Lehrers einigermaßen klar ist (er soll durch Unterricht Menschen etwas beibringen, was er selbst weiß bzw. kann), ist das des Sozialpädagogen bzw. Sozialarbeiters schon komplexer. Er ist im Grunde eine Art von "Selbsthilfe - Helfer", soll also Menschen, die aus der sozialen "Normalität" herausgefallen sind, helfen, sich wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Das gilt zum Beispiel für Arme, Kriminelle und überhaupt Randständige. Sozialpädagogen sind - auch wenn der Träger ein "freier Wohlfahrtsverband" ist - bei uns fest in die öffentliche Verwaltung integriert und fungieren als "Feuerwehr", die eingesetzt wird, wo es "sozial brennt". Gegenwärtige Beispiele sind etwa Jugendarbeitslosigkeit, Drogenabhängigkeit, Integration ausländischer Kinder usw.
224
Es mag überraschen daß in der jüngsten Geschichte der Sozialpädagoge auch fur die Freizeit der Kinder und Jugendlichen zuständig war, sofern sie nicht von Familie bzw. Schule kontrolliert wurde. So gibt es bis heute nicht wenige, die Freizeitpädagogik als eine genuine Teilaufgabe der Sozialpädagogik betrachten, wobei sie sogar geltend machen Können, daß die im Jugendwohlfahrtsgesetz vorgesehenen Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche rechtlich als "vorbeugende Jugendfürsorge" begründet werden: man soll die jungen Leute von der Straße fernhalten, sie sinnvoll beschäftigen und sie so nicht auf dumme Gedanken kommen lassen. Tatsächlich ist in diesem überlieferten Jugendhilfeverständnis kein Platz für eine besondere Berufsgruppe von Freizeitpädagogen; allenfalls konnte es darum gehen, den klassischen Sozialpädagogen heute freizeitpädagogisch besser auszubilden. Jedenfalls finden wir nach wie vor z. B. in Jugendfreizeitheimen oder in Ferienfreizeiten meist Sozialpädagogen. Daran haben auch die öffentlichen Träger ein Interesse, weil die Sozialpädagogen durch ihre Ausbildung in das System der öffentlichen Verwaltung leicht integrierbar und insofern natürlich auch kontrollierbar sind.
Fragwürdiges Jugendhilfekonzept
Aber an mindestens zwei miteinander zusammenhängenden Punkten ist dieses überlieferte Jugendhilfekonzept schon seit der Weimarer Zeit fragwürdig geworden.
Dieses Konzept beruhte auf einer normativen Vorentscheidung: Die Sozialpädagogen wußten ziemlich genau, was "gut", "richtig" und "sinnvoll" für die Freizeit von Kindern und Jugendlichen ist, und den Maßstab dafür entnahmen sie vor allem den Erfindungen des Wandervogels vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich der Idee des "Jugendgemäßen": Jugendliche wollen und sollen demnach
- in Gruppen gleichaltriger Gleichgesinnter ihre Freizeit verbringen;
- der Natur verbunden und nahe sein, z.B. durch Wandern und "einfaches Leben" in Zeltlagern;
- eine eigene Kultur in Abgrenzung zur offiziellen Erwachsenenkultur entwickeln (z B Lieder; Moden,. Rituale, Symbole);
- sexuell enthaltsam leben ("rein bleiben und reif werden").
Nun genügt schon ein flüchtiger Blick in unsere Gegenwartskultur um zu erkennen, daß diese Idee des Jugendgemäßen keinerlei kulturelle und soziale Fundierung mehr hat. Das schließt nicht aus, daß einzelne Elemente - z. B. Wandern, Zeltlager - wieder attraktiv werden können, dann aber nur im Sinne eines "Alternativ-Urlaubs", der an den übrigen touristischen Möglichkeiten gemessen wird, nicht jedoch mehr an dem erwähnten Maßstab, wie man als Jugendlicher zu leben habe und "eigentlich" - d. h. wenn man durch kommerzielle Gegenangebote nicht bereits verführt ist - auch leben wolle.
2) Das freizeitpädagogische Jugendhilfekonzept war von Anfang an einer auf Dauer siegreichen Konkurrenz ausgesetzt: den kommerziellen Freizeitanbietern. Diese orientierten sich nicht an irgendwelchen jugendpädagogischen Ideen wie dem "Jugendgemäßen", sondern an den Regeln des Marktes. Gebremst wurde der Siegeszug der kommerziellen Anbieter vor allem durch die Tatsache, daß ihre Angebote Geld kosteten, aber die Einkommen der Massen - und vor allem auch der Jugendlichen - lange Zeit recht niedrig waren. Die subventionierten freizeitpädagogischen Angebote der Jugendpflege waren entschieden billiger, und bis etwa Mitte der 50er Jahre konnte sich kaum ein Jugendlicher einen touristischen Urlaub leisten. Die "Freizeiten" der Jugendorganisationen und Kommunen waren für die meisten die einzige Möglichkeit, überhaupt Urlaub zu machen. Ähnlich war die Bedeutung der lokalen Jugendfreizeitheime. Erst mit der Verbreitung der Diskothek gab es eine kommerzielle Alternative für das Bedürfnis von Jugendlichen nach öffentlichen Treffpunkten.
Seit den Zeiten des Wandervogels ist also nicht nur die Freizeit junger Menschen gewachsen, vielmehr ist auch der Spielraum von Verhaltensalternativen größer geworden und zwar in dem Maße, wie die Sozialkontrolle des jugendlichen Freizeitlebens nachließ. Die jugendpflegerische Freizeitpädagogik war also von Anfang an ein Teil des Marktes überhaupt, und es hätte sie nie gegeben, wenn sie sich unter echten Marktbedingungen, nämlich zumindest kostendeckend hätte behaupten müssen. Aber der kommerzielle Teil des Freizeitmarktes hat die überlieferten normativen Maßstäbe Zug um Zug zurückgedrängt. Jahrzehntelang galt der Freizeit- und Konsummarkt als Hauptfeind jener normativen Pädagogik, was sich z. B. in den schon in der Weimarer Zeit entstandenen Jugendschutzgesetzen niederschlug, die ja nach wie vor Jugendfreizeitschutzgesetze sind.
Die historische Entwicklung hat zur Folge, daß Freizeitpädagogik keine normative Grundlage mehr hat, von der aus sie mit hinreichender öffentlicher Unterstützung pädagogische Ansprüche geltend machen könnte; sie hat kein eigenständiges inhaltliches Konzept, sondern ist im wesentlichen darauf angewiesen, sich auf die aktuellen Wunsche ihrer Partner einzulassen. Das aber unterscheidet sie kaum noch von kommerziellen Anbietern.
(3) Wenn auch die allgemeingültige Norm für "richtiges" Freizeitverhalten von Jugendlichen (das "Jugendgemäße") zusammengebrochen ist, so gibt es doch nach wie vor partikulare normativ orientierte freizeitpädagogische Angebo-
225
te. Zu denken ist etwa an die Angebote von Kirchen oder politischen Organisationen, die junge Menschen in deren Freizeit für ihre eigenen Vorstellungen zu gewinnen trachten. Auch in diesem Sinne war Freizeit von Anfang an ein Markt mit konkurrierenden Anbietern.
Alles spricht aber dafür, daß dieser traditionelle, subventionierte freizeitpädagogische Marktanteil der Jugendpflege sich kaum nennenswert vergrößern wird. Er wird sich wohl wie bisher auf Randgruppen beschränken, die nicht oder nur sehr begrenzt in der Lage sind, am "normalen" freizeit-kulturellen Angebot teilzunehmen. Für eine Ausweitung fehlen die Motive, die man der Öffentlichkeit plausibel machen konnte. Die Tendenz geht eher weg von der allgemeinen Freizeitpädagogik hin zur zielgruppenorientierten Arbeit mit Randständigen.
Ein Markt für Pädagogen?
Abgesehen von solchen Randgruppen hat sich jedoch die Hoffnung vieler Pädagogen nicht bestätigt, daß die Menschen vermehrte Freizeit von sich aus nicht zu nutzen wüßten, sondern dafür bestimmter Hilfen z. B. von Freizeitpädagogen bedürften. Das Problem ist vielmehr, daß die Menschen subjektiv fast immer zu wenig Freizeit haben. Das liegt daran, daß ja nicht nur die Massenfreizeit gewachsen ist, sondern auch das Masseneinkommen, und unsere darauf basierende moderne Freizeit- und Konsumkultur enthält immer mehr Wahlmöglichkeiten, als man Zeit (und Geld) hat, zu realisieren. Zudem verwenden wir sehr viel mehr Zeit für Kommunikation und Erziehung, als das früher für die meisten Menschen möglich war. Was privat von hinreichend vielen Menschen bezahlt werden kann, wird auf dem Markt auch angeboten. Das beste Beispiel ist der Tourismus. Dort gibt es z. B. inzwischen - wenn auch natürlich nur für Minderheiten - spezielle Angebote für alle möglichen Bildungsinteressen obwohl der Tourismus per se ja keine Bildungsinstitution ist.
Der Freizeitmarkt ernährt viele Menschen, Millionen sind in ihm tätig. Aber hat er auch noch Platz für Freizeitpädagogen? Mit anderen Worten: enthält der Freizeitmarkt Chancen für Pädagogen, die nicht mit öffentlichen Mitteln subventioniert werden, sondern von den Zahlungen ihrer Kunden leben können?
Um diese Frage weiter zu erörtern, müssen wir uns zunächst über den Begriff des "Freizeitpädagogen" klar werden. Wie schon festgestellt wurde, können Freizeitpädagogen nicht mehr verstanden werden als Vertreter einer normativen Leitidee für "richtiges" Freizeitverhalten. Eine solche Idee könnte jeder nur für sich selbst vertreten, aber er könnte sich dabei nicht mehr auf eine allgemein anerkannte kulturelle Selbstverständlichkeit beziehen. Deshalb können wir heute pädagogisch-professionelles Selbstverständnis nur noch allgemein über den Begriff des Lernens definieren, wobei grundsätzlich offenbleiben muß um welche Inhalte es jeweils geht und wer sie festsetzt (der Pädagoge oder seine Partner). Freizeitpädagogen im weitesten Sinne sind also Menschen, von und mit denen man in seiner Freizeit etwas lernen kann.
Faßt man diesen Begriff so weit, dann sind Sozialpädagogen in Freizeitheimen, Erwachsenenbildner, pädagogisch geschulte Verkäufer von Freizeitgütern oder Freizeitdienstleistungen, Reiseleiter Sport- und Musiklehrer usw. alle Freizeitpädagogen. Die Schwierigkeit ist nur, daß man unmöglich für eine derartige Breite von Kompetenzen eine einheitliche Ausbildung einrichten kann. Nun wäre das ja auch nicht unbedingt erforderlich. Viele, die in diesem Bereich lernhelfend tätig sind, haben einfach etwas gelernt, was nun im Freizeitbereich nachgefragt wird - ob sie nun die Bezeichnung Freizeitpädagogen dafür verwenden oder nicht.
Vielleicht gibt es in Zukunft immer mehr Menschen, die ihre Freizeit dazu benutzen wollen, etwas für sie Interessantes zu lernen. Im Prinzip kann das alles sein, was sich innerhalb der Legalität bewegt. Traditionell etablierte Formen solcher Lernangebote sind die Einrichtungen der Erwachsenen- und der außerschulischen Jugendbildung.
Lernangebote
Der Grundgedanke, Menschen in ihrer Freizeit Lernangebote zu machen, kann in einer Reihe von Varianten verwirklicht werden.
1. Ein Freizeitpädagoge versteht etwas von einer Sache, verfügt also über eine spezifische kulturelle Kompetenz und begibt sich mit dieser Kenntnis auf den Markt. Beispiel: Jemand hat "Spielpädagogik" studiert und verkauft dann Spiele in der Hoffnung, daß seine sachkundige Beratung sein Geschäft attraktiv macht. Oder jemand kann Brot backen, Töpfern, ein Museum erklären, Tennis spielen, surfen usw.
2. Ein Freizeitpädagoge hat selbst zwar keine besondere kulturelle Kompetenz anzubieten, versucht aber, Menschen an die offizielle Kultur (Konzerte: Theater, Museen, Ausstellungen) heranzuführen, indem er sie z.B. berät und Hemmungen zu überwinden hilft. Er "vermittelt" also im wörtlichen Sinne kulturelle Kompetenz, die er selbst nicht unbedingt hat.
3. Ein Freizeitpädagoge vermittelt keine spezifische kulturelle Kompetenz, sondern gesellige Anlässe, damit Menschen sich über gemeinsames Tun (Singen, Tanzen, Spielen, Wandern, Basteln usw.) kennenlernen können. Auch hier wäre eine sachkundige Anleitung nötig, aber sie müßte nicht unbedingt professionelles Niveau haben. Viele Angebote im Tourismus, aber auch in der Erwachsenenbildung sind von dieser Art und was im allgemeinen "Animieren" genannt wird, hat hier seinen Ort. Der Geselligkeitswert einer freizeit-kulturellen Tätigkeit spielt bekanntlich eine große Rolle, aber die Erwartun-
226
gen können unterschiedlich sein, je nachdem, wie hart das Interesse an der jeweiligen "gemeinsamen Sache" ist.
4. Ein Freizeitpädagoge hilft und berät Freizeitinitiativen, die sich ohne ihn gebildet haben. Das ist z. B. eine Aufgabe der Jugendpfleger.
5. Das, was sowieso geschieht im kommerziellen Freizeitbereich (Verkaufen von Gütern und Dienstleistungen; Betreuung von Kunden im Tourismus) wird pädagogisiert in dem Sinne, daß die Kunden immer auch auf die Lernmöglichkeiten hingewiesen werden, die in der jeweiligen Situation enthalten sind. Das geschieht vielfach auch, insofern bei allen freizeitorientierten Berufen Information und Beratung eine wichtige Rolle spielen.
Im Prinzip also könnten die Menschen vieles in ihrer Freizeit lernen und damit ihr Leben bereichern, und auf den ersten Blick scheint es hier einen noch unentdeckten Markt für Freizeitpädagogen zu geben. Aber man muß auch die Grenzen deutlich sehen.
- Je älter die Menschen werden, um so geringer wird ihre "Lernreichweite". Sie sind durch ihre bisherige Bildungsgeschichte mehr oder weniger festgelegt in ihren kulturellen Interessen. Außerdem nehmen die Chancen des Zugangs zu einer neuen Sache ab. Wer nicht schon als Kind eine Beziehung zu künstlerischen, wenn auch nur laienhaften Ausdrucksformen gefunden hat, wird nur in Ausnahmefällen als Erwachsener noch einen Weg dazu finden. Und wer kunstgeschichtlich interessiert ist, wählt entweder eine sehr anspruchsvolle Spezialreise, oder er findet im normalen Tourismus selbst den Weg, seine Neugier zu befriedigen. Eine Ausnahme ist bekanntlich der Sport. In jedem Alter kann man noch Sportarten lernen, die Spaß machen und die der jeweiligen Leistungsfähigkeit angepaßt werden können. Man denke etwa an die Zunahme des Ski-Langlaufs gerade auch unter älteren Menschen Am größten ist die Lernreichweite bekanntlich im Kindes- und Jugendalter. Da andererseits ein wichtiger Sinn dieser Altersphasen ist, möglichst viele Fähigkeiten zu entfalten, vor allem auch solche, die in der Schule nicht zum Zuge kommen, liegen hier sicher noch sinnvolle Möglichkeiten brach, zumal in ländlichen Gegenden. Aber unbesetzt ist das Feld keineswegs. Es gibt z. B. kommerzielle Musik- und Ballettschulen sowie spezielle Sportangebote wie Karate oder Fitneß-Center. Ein marktfähiges Lernpotential ist also nur sehr begrenzt zu mobilisieren.
- Sehr wahrscheinlich wird das vorhandene Lernpotential durch die bereits vorhandenen Angebote weitgehend befriedigt, unter anderem durch die Volkshochschulen, die aber nur wenige hauptamtliche Dozenten haben, und die nebenamtlichen können in der Regel nicht von den Kursgebühren leben. Die Volkshochschule verhält sich ja verhältnismäßig marktgerecht, indem sie die vom Publikum gewünschten Themen auch anzubieten versucht. Im übrigen spielen zur Befriedigung des Lernbedarfs die Massenmedien eine überragende Rolle.
Was ist bezahlbar?
Bei der Durchsicht der Möglichkeiten muß man also unterscheiden zwischen dem, was an und für sich sinnvoll wäre und möglicherweise auch Interessenten finden könnte, und dem, was davon auch bezahlt werden kann. Manches, was für einen Freizeitpädagogen interessant sein könnte, ist nicht bezahlbar, weder durch öffentliche Subvention noch auf dem Markt. Viele Tätigkeiten im Tourismus z. B. sind saisonbedingt, eine Sache für Studenten oder jedenfalls junge Ledige. Andere Tätigkeiten können nur nebenamtlich oder ehrenamtlich wahrgenommen werden, und dies zu tun, ist ja gerade für viele Menschen eine sinnvolle und befriedigende Freizeitbeschäftigung.
Zusammenfassend läßt sich also feststellen, daß der Bedarf an bezahlbaren Freizeitpädagogen relativ gering ist. Der normale Bürger braucht keinen Freizeitpädagogen, weil er das, was er will, schon kann. Allenfalls will er unterhalten werden.
Unterhaltung aber ist nicht pädagogisierbar. Der Mensch, der unterhalten wird, will dabei nicht belehrt werden, mit seinem Spaß unterstreicht er, daß er so bleiben will, wie er ist, und genau das begründet seinen Spaß. Unterhaltung mißt sich an subjektiven Maßstäben: der derbe Witz eines Animateurs bringt den einen zum Totlachen und langweilt den anderen. Ich weiß nicht, ob man überhaupt planmäßig lernen und studieren kann, wie man andere Menschen unterhält, jedenfalls kenne ich dafür keinen pädagogischen Studiengang.
Daß Unterhaltung nicht pädagogisierbar ist, soll nicht heißen, daß das Phänomen der Unterhaltung überhaupt uninteressant für Pädagogen sei. Im Gegenteil: Ein Pädagoge, der Elemente der Unterhaltung verwendet, kann die Lernwilligkeit seiner Partner durchaus fördern. Aber Unterhaltung als Selbstzweck kann keine pädagogische Kategorie sein, sie ist die tragende Idee anderer Berufe.
Studium und Berufschancen
Da es inzwischen Studiengänge für Freizeitpädagogik gibt, sollte man den Studenten klar sagen, wie die beruflichen Aussichten sind. Vielleicht kommen dann manche, die später im Freizeitbereich ihr Geld verdienen wollen, auf die Idee, sich auf die wirklichen Freizeitberufe einzulassen z. B. im Bereich der Publizistik, des Hotel- und Gaststättengewerbes, des Entertainments, des Tourismus, der Schönheits- und Gesundheitsindustrie. So, wie es aussieht, ist dieser Markt immer noch expansiv. Und was hier an Pädagogik benötigt wird in dem Sinne, daß man die Kunden erfolgreich informieren und beraten und das Verkaufen befriedigend arrangieren kann, ist wohl eher ein Feld der Verkaufspsychologie als unserer herkömmlichen Pädagogik.
Ein Studiengang für "Freizeitpädagogik" ist dann problematisch, wenn man damit den Zugang zu bestimmten Berufen verspricht. Primär an kulturellen Kompetenzen orientierte Studiengänge (z B. Kunstgeschichte, Geschichte, Sport, Informatik, Publizistik, Psychologie usw.) sowie andere Fachausbildungen unterhalb der Hochschulebene haben da mindestens gleiche Chancen. Studenten kann man heute nur folgendes raten: sie sollen das studieren, was sie wirklich interessiert, und sie sollen es so gut wie möglich tun. Danach müssen sie mit dem was sie wissen und können, auf den Markt gehen. Vieles, was man dann braucht, kann man ohnehin nicht vorher "auf Vorrat" lernen.
227

154. Zur Geschichte der außerschulischen politischen Jugendbildung (1987)
(In: R. Hanusch/G. Lämmermann (Hrsg.): Jugend in der Kirche zur Sprache bringen. München 1987, S. 191-200)
Mit der Entstehung des Wandervogels begann um die Jahrhundertwende eine Entwicklung, die ich die "Politisierung des Jugendalters" nennen möchte. Jugendliche entziehen sich, zunächst nur zögernd und begrenzt, bis heute aber sehr weitgehend den Einflüssen der traditionellen "Erziehungsmächte" (Familie, Schule, Kirche), um in Gleichaltrigengruppen eine Art von "Selbsterziehung" in ihrer Freizeit zu inszenieren. Man kann auch sagen: Seit dem Beginn des Wandervogels hört das Jugendalter Zug um Zug auf, ein primär pädagogisch definierter Status zu sein, der einerseits von den "Verführungen" und "Verfrühungen" der Erwachsenenwelt zu schützen sei (Jugendschutz), dem andererseits aber auch die volle Verantwortung eines Erwachsenen noch nicht zugemutet werden könne. "Politisierung" nenne ich diesen Prozeß deshalb, weil in dem Maße, in dem das Jugendalter das Gehege der Erziehungsmächte verläßt, es öffentlich zugänglich wird für die Werbung partikularer Erwachsenengruppen, die die Jugendlichen nun für ihre kulturellen, politischen, wirtschaftlichen und weltanschaulichen Bestrebungen gewinnen wollen und vor allem: die dies nun auch können. Die Jugendlichen treten gleichsam auf einen Markt, auf dem die verschiedenen Anbieter einander den Rang abzulaufen trachten. Das wurde schon auf dem Fest auf dem "Hohen Meißner" im Jahre 1913 deutlich, wo Erwachsene die dort versammelten Jugendlichen für ihre kulturkritischen bzw. Iebensreformerischen Ziele gewinnen wollten. Nach dem Ersten Weltkrieg wurde daraus eine Massenbewegung; es gab in der Weimarer Zeit kaum eine Erwachsenenorganisation, die nicht einen eigenen Jugendverband hatte oder sich wenigstens bemühte, einen aufzubauen. Die Hitler-Jugend, die zunächst auch nur einer dieser zahlreichen Jugendverbände war, zerschlug bekanntlich 1933 diesen pluralistischen "Jugendmarkt" und suchte sich ein Monopol zu sichern. Nach 1945 knüpfte die Jugendarbeit wieder an die Formen an, die 1933 zerstört worden waren.
191
Jugendarbeit und gesellschaftliche Praxis
Nun lag die Ursache für die "Politisierung" des Jugendalters keineswegs primär in dem Autonomiestreben der Jugendlichen selbst, vielmehr wurde deutlich, daß zunächst Teile der bürgerlichen Jugend, inzwischen praktisch alle Jugendlichen im Hinblick auf ihre berufliche, weltanschauliche usw. Zukunft ihre Vergangenheit, die aus ihrer sozialen Herkunft erwächst, nicht einfach fortschreiben konnten; man konnte nicht mehr einfach "in Vaters Fußstapfen treten". Vielmehr boten sich reale Optionen, also Wahlmöglichkeiten an - in der Weimarer Zeit auch schon für aufstiegsorientierte Arbeiterjugendliche - über die entschieden werden mußte, und diese Entscheidung mußte der Jugendliche letzten Endes selbst fällen - wie groß unter Umständen die Konflikte mit dem Elternhaus dabei auch sein mochten. Heute ist das alles kaum noch fraglich, aber hinzugekommen ist ein neues Problem in Konsequenz des jugendlichen Politisierungsprozesses: Nachdem wir die Bildungsprivilegien im Prinzip beseitigt haben, ist auch der Entscheidungsdruck erhöht worden (die Optionen sind kaum noch übersehbar), aber auch der Leidensdruck. Damit meine ich folgendes: In der Weimarer Republik hatte fast jeder Jugendliche noch sein festes Herkunftsmilieu (Bildungsbürger, Handwerker, Facharbeiter), an dem er sich zunächst einmal orientieren konnte. Wurde z.B. der junge Arbeiter wie sein Vater ebenfalls Arbeiter, so "war er wer". Gelang ihm darüber hinaus ein sozialer Aufstieg, so konnte dies seinem Selbstbewußtsein nur zugute kommen. Heute dagegen, am Ende der Politisierung des Jugendalters, wozu auch der Abbau der Bildungsprivilegien gehört, muß der Jugendliche nicht nur seine Chancen nutzen, sondern sich auch mit seinen Grenzen zufrieden geben ("zu mehr reicht es eben nicht"). Die gegenwärtige Jugendarbeitslosigkeit verschärft dieses Problem, verunklart es aber auch, weil viele junge Menschen ihre Chancen nicht wahrnehmen können, andererseits aber auch der Notwendigkeit enthoben sind, sich mit ihren Grenzen zu identifizieren.
Nun ist dieser Prozeß der Politisierung - also der heute erreichten vollen Vergesellschaftung des Jugendalters - langsam vor sich gegangen. Aber die modernen Jugendverbände verdanken sich dieser Tatsache. Zugleich haben sie diesen Prozeß über Jahrzehnte dadurch verlangsamt, bzw. gemildert, daß sie die Idee des "Jugendgemäßen" akzeptierten und realisierten, wie sie der Wandervogel in den Grundzügen bereits erfunden hatte. Diese Idee besagte etwa, daß es zum "Wesen" "des" Jugendlichen gehöre, sich Gleichaltrigen zuzugesellen, der Natur nahezustehen, einer bestimmten "Jugendkultur" mit Wandern, Singen usw. zu folgen, auf Distanz zur großstädtischen Freizeit-Zivilisation zu gehen und sexuell enthaltsam zu leben. Schon in der Weimarer Zeit war dies "Jugendgemäße" das fast allen Jugendverbänden gemeinsame Element, worin sie sich auch sonst unterscheiden mochten. Die Kultur des "Jugendgemäßen" verhinderte also für
192
die sie akzeptierenden Jugendlichen eine allzu schroffe Entfremdung, die ja mit dem Prozeß der Politisierung verbunden ist, indem sie Geborgenheit in Kleingruppen anbot; andere suchen diese Geborgenheit außerhalb der Jugendarbeit in Gleichaltrigengruppen.
Die Idee des Jugendgemäßen überdauerte - wenn auch modifiziert - die HJ und verschwand etwa Ende der 50er Jahre allmählich. Darin drückte sich nur aus, daß die Politisierung des Jugendalters sich endgültig durchgesetzt hatte - zunächst im Freizeit- und Konsumbereich, wo Jugendliche als selbständige Käufer ernstgenommen wurden, später, Ende der 60er Jahre, im Zuge der Studenten- , Schüler- und Lehrlingsbewegung auch auf politischem Gebiet: Jugendliche wurden nun als politische Subjekte akzeptiert, die ihre politischen Interessen selbst vertreten dürfen und diese nicht mehr wie vorher nur über die Stellvertretung durch die Herkunftsfamilie geltend machen können. Die Herabsetzung der Volljährigkeit auf 18 Jahre war nur eine logische Folge dieser Entwicklung. Der Prozeß der Politisierung löste also die Jugendlichen aus ihren sozialen Herkunftskontexten heraus und zwang sie zu jeweils individuellen Entscheidungen, und diese radikale Individualisierung des Jugendalters erhöhte die Probleme des Erwachsenwerdens und damit der Identitätsfindung. Von der subjektiven Seite her gesehen ist also Politisierung der Zwang zur Emanzipation.
Nun läge die Vermutung nahe, daß diesem Prozeß der Politisierung, der Emanzipation vom Herkunftsmilieu und von den Erziehungsmächten auch eine entsprechende politische Aufklärung gerade im Rahmen der Jugendarbeit entsprochen habe. Welche Rolle spielte also "politische Bildung" unter den Angeboten der Jugendarbeit?
Hier muß man unterscheiden zwischen der Arbeiterjugendbewegung und der bürgerlichen Jugendbewegung. Für die Arbeiterjugendbewegung war politisch orientierte "Bildung" von Anfang an ein wichtiges Moment ihres Selbstverständnisses. Zunächst - vor dem Ersten Weltkrieg - verstand sich diese Bildungsarbeit als eine Art von "Gegensozialisation" gegen die in der Schule erworbene bürgerlich-nationalistische, der Arbeiterbewegung feindliche politische Ideologie. Da aber die Arbeiterjugendbewegung damals nicht nur Bildung im Sinne von Aufklärung im Geiste des Sozialismus wollte, sondern auch ihre spezifischen wirtschaftlichen Interessen (als Lehrlinge, als junge Arbeiter im Unterschied zu den erwachsenen Arbeitern) selbst vertreten wollte, geriet sie vor dem Ersten Weltkrieg auch in Konflikt mit der Arbeiterbewegung, vor allem mit der Gewerkschaft, die ihr Monopol der wirtschaftlichen Interessenvertretung für alle Arbeiter gefährdet sah. Die Erwachsenenverbände - Sozialdemokratie und Gewerkschaft - erklärten nun die Bildung ihres Nachwuchses zum Hauptzweck der Jugendorganisationen - unter Verzicht auf deren politische Eigenaktivität. Unter dem Aspekt der vorhin erwähnten Politi-
193
sierung des Jugendalters bedeutet dies, daß "Bildung" nicht nur oder gar nicht einmal in erster Hinsicht der je individuellen Aufklärung dienen sollte, sondern vor allem der ideologischen Abschottung der "eigenen Schäflein" gegenüber den Verführungen des nun entstandenen "Weltanschauungsmarktes", der sich in der Weimarer Zeit voll entfalten konnte. Vom Standpunkt der Organisation her gesehen taten die Verbände der Arbeiterbewegung nichts anderes, als z.B. die Kirchen auch: sie versuchten, den offenen Markt in ihrem Sinne zu kanalisieren. Allerdings interessierte sich immer nur eine Minderheit der Mitglieder für politische Themen, die überwiegende Mehrheit war an den Freizeitangeboten interessiert. Jedenfalls wurde der Versuch, sich als Jugendlicher zum politisch handelnden Subjekt zu erklären, zunächst und für Jahrzehnte unterbunden.
In der bürgerlichen Jugendbewegung spielte bis 1933 politische Bildung keine Rolle. Ihre Absicht war, in Gruppe und Bund Lebensformen zu realisieren, die ihrerseits "erzieherisch" wirken konnten, aber unter weitgehendem Verzicht auf bewußte Aufklärung. Die Emotionalität des "Erlebnisses" blieb im allgemeinen bestimmend. Gleichwohl kann man z.B. die Bünde der Weimarer Zeit nicht einfach als unpolitisch bezeichnen. Ihre Gründung verdankte sich nämlich entweder antidemokratischen Impulsen oder zumindest einem Mißverständnis demokratischer Formen. Die Techniken der politischen Meinungs- und Willensbildung und deren parlamentarischer Gestaltung, das Agieren von Parteien und von mehr oder weniger "namenlosen" Politikern in ihnen wurde als Kälte, als Entfremdung, als "undeutsch" und persönlichkeitsfeindlich empfunden. Die Bünde dagegen sollten das "lebendige" Gegengewicht dazu bilden, in dem sich Persönlichkeiten entfalten würden, die als Herangereifte ihrem Volk dann zur Verfügung stünden. Da die Bünde sich aber außerhalb des demokratischen Betriebes in Staat und Gesellschaft und überhaupt abseits der modernen gesellschaftlichen Komplexität etablierten, haftete ihnen vom Ansatz an etwas politisch Illusionäres an.
In der HJ schließlich setzte sich die Idee des Bundes fort, nicht die Idee des politisch geschulten Arbeiters, wie sie die Arbeiterjugendbewegung vertreten hatte. Auch die HJ verstand sich als eine Lebensform, verkörpert vor allem im Konzept des "Lagers", d.h. man wollte das gemeinsame Leben so arrangieren, daß es selbst die gewünschte erzieherische Wirkung erzielte, ohne daß man durch rationale Argumentation dabei nachhelfen müsse. "Erziehend" sollten die "Formationen" sein sowie die auf emotionale Identifikationen hin angelegten Arrangements der Aufmärsche, Symbole (Fahne) und Lieder. Der Antiintellektualismus der HJ wie der Nazi-Bewegung überhaupt ließ eine politische Bildung im Sinne der rationalen Information und Auseinandersetzung mit politischen Tatsachen und Phä-
194
nomenen nicht zu. Die Hitlerbewegung wollte gleichsam bewußtlose politische Erziehung unter Verzicht auf politische Bildung. Dabei kam es ihr zustatten, daß sie sich nicht als Partei unter anderen Parteien verstand, sondern als parteienübergreifende nationale Bewegung, weshalb Schirach auch die "Pluralität" der Bünde als historisch überholt erklärte.
Als Zwischenergebnis läßt sich also feststellen, daß es zwischen 1919 und 1945 in der Jugendarbeit keine politische Bildungsarbeit gab, die angemessene Vorstellungen über Staat und Gesellschaft vermittelt bzw. die politische Urteilsfähigkeit gefördert hätte, obwohl - wie erwähnt - die Politisierung des Jugendalters eingesetzt hatte und die Jugend von allen Seiten nicht zuletzt auch politisch umworben wurde, also irgend eine Form der politischen Aufklärung zumindest objektiv auf eine entsprechende Betroffenheit hätte stoßen müssen. Aber Politik paßte nicht ins Konzept des "Jugendgemäßen", und offensichtlich entsprach diese Einstellung nicht nur den Vorstellungen der meisten in der Jugendarbeit tätigen Erwachsenen, sondern auch der meisten Jugendlichen, der bürgerlichen zumal, aber auch der überwiegenden Mehrheit der Arbeiterjugendlichen. Nicht politische Aufklärung, sondern im Gegenteil Entpolitisierung des Jugendalters unter dem Leitmotiv des "Jugendgemäßen" war die leitende Vorstellung der Jugendarbeit - einschließlich der HJ - bis etwa zum Ende der 50er Jahre. Nun muß man allerdings hinzufügen, daß dies sinngemäß für die Erwachsenen auch galt. Deren "politische Bildung" blieb zunächst - in der Weimarer Zeit - der Pluralität der politischen Parteien überlassen und deren publizistischer Begleitmusik, bis die Nazis dann auch diese "Aufklärung" in den Massenmedien und im Schulungslager monopolisierten. Gleichwohl muß festgehalten werden, daß
195
dem objektiven gesellschaftlichen Status, in den das Jugendalter nun eintreten mußte, über Jahrzehnte hinweg keine angemessene politisch-pädagogische Reaktion entsprach.
Nach dem Zweiten Weltkrieg setzte sich die Tradition der Bünde und der HJ in der Jugendarbeit insofern fort, als nun politische Erziehung erneut als "Lebensform" propagiert wurde. Im Rahmen der re-education boten die Besatzungsmächte verständlicherweise diejenigen Vorstellungen und Praktiken an, die sie aus ihrem Heimatland kannten. In den USA herrschte damals das pragmatische politische Erziehungskonzept der "Demokratie als Lebensform" vor, wie es unter anderem Dewey propagierte. Nicht intellektuelle Aufklärung über Staat und Gesellschaft stand im Vordergrund, sondern die mitbestimmende Teilnahme der Bürger an politisch-gesellschaftlichen Basisaktivitäten. Dieses Prinzip führten die Amerikaner in ihren Jugend- und Kulturhäusern ein und die Engländer verfuhren ähnlich. Im Gegensatz zu den undemokratischen Erfahrungen der Nazizeit sollten junge Menschen nun die Erfahrung machen, daß ihre individuellen Bedürfnisse und Wünsche ernstgenommen und respektiert werden, daß sie gemeinsam mit anderen über die für sie gemachten Programme mitbestimmen können, daß sie zwischen demokratischen Organisationen wählen und nach demokratischen Regeln (z.B. Mehrheitsbildung) Entscheidungen treffen dürfen. Die Jugendlichen sollten sich also eingewöhnen in die neuen demokratischen Lebensformen und sich mit ihnen auf diese Weise identifizieren. In diesen Zusammenhang gehört auch die Breitenwirkung der sogenannten "Gruppenpädagogik", wie sie etwa vom "Haus Schwalbach" propagiert wurde. Politische Bildung im Sinne einer sachorientierten Kunde blieb dagegen unbedeutend. Allerdings zeigte sich bald, daß die deutschen Erwachsenenverbände - insbesondere die Kirchen - selbst Schwierigkeiten mit diesen neuen demokratischen Formen und Regeln hatten. So versuchten sie in ihren Jugendverbänden doch wieder einen mehr oder weniger umfassenden Erziehungsanspruch geltend zu machen, also wie schon in der Weimarer Zeit Pluralität zu kanalisieren. Die Vorstellung war etwa, daß der einzelne Jugendliche erst in einer "weltanschaulichen Grundrichtung" aufwachsen müsse, um dann, persönlich gefestigt, der weltanschaulichen und normativen Pluralität entgegentreten zu können. Die Liberalität der von den westlichen Besatzungsmächten angebotenen "demokratischen Lebensformen" wurde also bald zurückgedrängt zugunsten von eher autoritativ-erzieherischen Formen, weil insbesondere die moralische Autorität der Kirchen, die die Nazizeit unkorrumpiert überstanden zu haben schienen, für ein entsprechendes öffentliches Klima sorgen konnte. So blieb die "Aufarbeitung" der NS-Vergangenheit im wesentlichen ein moralisches Problem. Im übrigen gab die politische Unterdrückung in der SBZ und der jungen DDR Anlaß für eine breite antikommunistische Stimmung in der BRD, die diese als Hort der Freiheit und die "Aufarbeitung" der NS-Vergangenheit als entbehrlich erscheinen lassen konnte; denn schließlich galt der Kommunismus als genauso totalitär wie der zurückliegende Nazismus. Noch immer war politische Bildung ein Thema allenfalls für kleine Minderheiten in der Jugendarbeit.
Das änderte sich erst Ende der 50er Jahre. Hakenkreuzschmierereien von Jugendlichen, die damit weniger eine politische Überzeugung als vielmehr eine allgemeine Provokation zum Ausdruck brachten, riefen die überwunden geglaubte Vergangenheit wieder ins Gedächtnis und brachten die Bundesrepublik im Ausland in Mißkredit. Die FDJ ergriff die "ideologische Offensive" und lud westdeutsche Jugendliche zu politischen Diskussionen ein, denen sie in der Regel nicht gewachsen waren; aber sie brachten "Dokumentationsmaterial" über die Nazi-Vergangenheit führender westdeutscher Politiker mit nach Hause, was allein schon genug Aufregung bei den Politikern verursachte und den Ruf nach einer politischen Bildung im Sinne einer ideologischen "Immunisierung" erschallen ließ.
196
Die "Politisierung" des Jugendalters und damit seine Emanzipation von den traditionellen Erziehungsmächten verstärkte sich und erreichte in der "Kulturrevolution" Ende der 60er Jahre ihren Höhepunkt. Zudem hatte die Konsumgüterindustrie das Jugendalter als neue, nun durchaus schon zahlungskräftige Käuferschicht entdeckt, und deren Angebote und Werbestrategien hatten keine erzieherische Tendenz ("was ist gut für Kinder und Jugendliche?"), sondern eine ökonomische ("was kann man an Jugendliche oder über sie verkaufen?"). Nicht zuletzt diese Ausweitung des Freizeitmarktes hat die Emanzipation des Jugendalters vorangetrieben.
Teils also aus politischen Gründen, teils aus der Einsicht, daß Jugendliche schon zu ihrer persönlichen Orientierung politische Aufklärung benötigen, wurde seit Ende der 50er Jahre "politische Bildung" zu einem Schwerpunkt in der außerschulischen Jugendarbeit. Nun flossen auch die öffentlichen Mittel für diesen Zweck, von denen hauptamtliche Jugendbildungsreferenten bezahlt werden konnten sowie nebenamtliche studentische "Teamer"; denn die ehrenamtlichen Mitarbeiter waren mit dieser sachbezogenen Aufgabe in der Regel überfordert; ihre Kompetenz hatten sie vielmehr aus der Idee des Jugendgemäßen bezogen, die keine spezifische Sachkenntnis erforderte. Die neuen Profis hatten im Studium die jungen Sozialwissenschaften kennengelernt - vor allem Politikwissenschaft und Soziologie - die einerseits die notwendige sachliche Fundierung erlaubten, also der politischen Bildungsarbeit ihre "Gegenstände" gaben, andererseits aber auch erst die Entwicklung didaktischer Konzepte ermöglichten.
Frei von schulischer Reglementierung konnten sich nun didaktische Experimente entfalten, die dann auch die Schuldidaktik und die Arbeit der Jugendverbände befruchteten. Zu nennen wären hier unter anderem der Jugendhof Vlotho, der Jugendhof Steinkimmen, das Haus am Rupenhorn in Berlin, der Jugendhof Dörnberg und die unter anderem von Helmut Kentler inspirierte politische Jugendbildungsarbeit der IG-Chemie. Als aber die Zeit der Experimente vorbei war und die didaktischen Variationsmöglichkeiten, die ja nicht unbegrenzt sind, im wesentlichen durchgespielt waren, wurde eine Phase der Konsolidierung nötig, in der sich das Problem des professionellen Selbstverständnisses stellen mußte. Es ist bis heute nicht befriedigend gelöst. Die Schwierigkeit besteht unter anderem darin, daß dieses Selbstverständnis sich gleichsam in einem Dreieck entfalten muß: im Rahmen der Erwartungen des Trägers, der in der außerschulischen Bildung auch - im Unterschied zur Schule - politisch parteilich sein darf; im bezug auf die Partner und deren (freizeitorientierte) Erwartungen und Bedürfnisse (die können schließlich "mit den Füßen abstimmen"), und schließlich in bezug auf die Erwartungen, die die neuen Hauptamtlichen an sich selbst stellen.
197
Diese neue Gruppe professioneller Pädagogen, die es vorher in der Jugendarbeit nicht gab, wurde nun zum eigentlichen "Träger" der politischen Bildung in der Jugendarbeit und zum Motor ihrer Ausweitung; denn Ansehen und Status dieser neuen Berufsgruppe hingen nun entscheidend davon ab, daß der politischen Bildung für möglichst alle Jugendlichen eine große Öffentliche Bedeutung zugeschrieben wurde. Eine prinzipielle Defizienz an politischer Aufklärung "der anderen" zu unterstellen wurde nun zu einer Frage der eigenen beruflichen Existenz. Je mehr der Prozeß der Politisierung des Jugendalters, also seiner Emanzipation vom Herkunftsmilieu, und damit der Prozeß der Individualisierung fortschritt, um so mehr konnte diese Berufsgruppe mit ihrer Problemdefinition in diese Lücke treten, zumal das professionelle Selbstverständnis weitgehend unklar blieb (wofür wird man eigentlich bezahlt?). Politische Bildung geriet so leicht zur Agitation, also zur Werbung für ein bestimmtes politisches Handeln, oder zur Indoktrination, also zum Geltendmachen einseitiger Positionen, weil dieser Berufsgruppe - und erst recht den nebenamtlichen studentischen Mitarbeitern - jene am Partner bzw. an der Sache orientierte Disziplin fehlte, wie sie etwa dem klassischen Schullehrer eigen ist. Diese professionelle Unsicherheit ist bis heute nicht beseitigt und führt nicht nur zur Verwechslung von Bildung und Agitation bzw. Indoktrination, sondern auch zur Unterwerfung unter wechselnden Moden - etwa von der neomarxistischen "Gesellschaftskritik" zur subjektivistischen "Beziehungsarbeit", angesichts derer politisch-gesellschaftliche Objektivationen nur noch lästig erscheinen, wo die "Sache" Politik also aus dem Blick entschwindet.
Wenn meine Beobachtungen richtig sind, scheint sich auf eigentümliche Weise die alte Idee des "Jugendgemäßen" auf neue Art zu etablieren, sicher nicht im Sinne der sexuellen Enthaltsamkeit, aber im Sinne der zivilisationskritischen Distanz, eines subkulturellen Jugendjargons und Jugendstils, ja, sogar einer anti-intellektuellen Attitüde. Die "Sache" Politik, ihre Funktionen, Strukturen, Prozesse, das Funktionieren von Institutionen usw., sind aus dem Interesse geraten zugunsten einer "Beziehungsarbeit", die an der unmittelbaren Befindlichkeit ansetzt und sie oft nicht überschreitet. Im Rahmen unseres Themas wäre eine solche Tendenz nicht verwunderlich, denn der beschriebene historische Prozeß der Politisierung und damit der Emanzipation und Individualisierung des Jugendalters ist ja auch ein entfremdender Vorgang, der gleichsam einen Hunger nach Beachtung und Anerkennung der Subjektivität durch "die anderen" verursacht. Aber das epochale Problem der politischen Aufklärung der politisierten Jugendlichen wäre damit ebenso wenig gelöst wie schon zur Zeit der Weimarer Republik.
Unter dem Stichwort "Beziehungsarbeit" läßt sich gegenwärtig das professionelle Selbstverständnis wohl am ehesten charakterisieren, und zwar träger- und verbandsübergreifend wie schon das "Jugendgemäße".
198
Zusammenfassend läßt sich also etwa folgendes feststellen: Ungefähr mit der Entstehung des Wandervogels beginnt der Prozeß der Auflösung des Jugendalters als einer primär pädagogisch definierten und entsprechend "geschützten" Altersstufe. Das Jugendalter wird "politisiert" bzw. "vergesellschaftet", also dem öffentlichen Zugriff einerseits der Erwachsenenverbände, andererseits der Freizeit- und Konsumindustrie zugänglich. Dieser Prozeß führt zur zunehmenden Individualisierung der Jugendlichen, also zur weitgehenden Ablösung aus den sozialen Herkunftskontexten. Diesem Prozeß müßte eigentlich eine politische Bildung bzw. Aufklärung entsprechen, die auf individuelle Autonomie des Handelns und Urteilens orientiert ist. Dies geschieht jedoch im Grund bis heute nicht. Bis etwa Ende der 50er Jahre waren die Bemühungen der Jugendarbeit im Gegenteil darauf gerichtet, diesen Politisierungsprozeß aufzuhalten oder zumindest zu verlangsamen mit dem Ziel, kollektive soziale Kontexte zu bewahren (Beispiel Arbeiterjugendbewegung) oder neu zu stiften (Beispiel Bünde und HJ), wobei die Idee des "Jugendgemäßen" eine die HJ einschließende Kontinuität abgab. Selbst die Professionalisierung der außerschulischen politischen Bildung etwa seit Anfang der 60er Jahre hat im Hinblick auf die politische Aufklärung keinen einschneidenden Wandel gebracht, weil sie mangels professionellen Selbstbewußtseins zu sehr politischen und pädagogischen Modeströmungen verhaftet blieb und von daher und kaum aus der Perspektive der persönlichen politischen Autonomie ihre Aufgabe definierte. Die politische Bildung in der außerschulischen Jugendarbeit wird erst dann zu einer adäquaten Antwort auf die Politisierung des Jugendalters finden, wenn sie sich einerseits als "Lernhilfe" versteht, andererseits aber auch sich in der Sache kompetent macht, d.h. das Politische als einen objektiven, außersubjektiven Funktions- und Strukturzusammenhang begreift, so daß politische Aufklärung nach beiden Seiten hin erfolgen kann: als Aufklärung über die je subjektiven Bestrebungen, Wünsche, Hoffnungen usw. einerseits, und als Aufklärung über die davon unbeeindruckte "Sache" Politik andererseits; erst diese Differenz ergibt einen Spielraum für produktive politische Lernprozesse.
199
Literatur
H. Giesecke: Die Jugendarbeit. München 5. Aufl. 1980.
Ders.: Vom Wandervogel bis zur Hitler-Jugend. München 1981.
H. Kentler: Jugendarbeit in der Industriewelt. München 3. Aufl. 1962.
H. Lessing/M. Liebel: Jugend in der Klassengesellschaft. München 1974.
U. Lüers u.a.: Selbsterfahrung und Klassenlage. München 1971.
C.W. Müller u. a.: Was ist Jugendarbeit? München 1964.
H.H. Schepp: Offene Jugendarbeit. Weinheim 1963.

155. Über die Antiquiertheit des Begriffes "Erziehung" (1987)
(In: Zeitschrift für Pädagogik, H. 3/1987, S. 401-406)
In den Diskussionen, die ich bisher mit Eltern, Lehrern und Sozialpädagogen über mein Buch "Das Ende der Erziehung" habe führen können, ist mir aufgefallen, daß viele, gerade auch pädagogisch interessierte und aufgeklärte Menschen, am Begriff "Erziehung" hängen, als ob davon ihre Existenz abhinge. Wenn man ihnen vorschlägt, doch einfach einmal zu beschreiben, was sie tatsächlich in Schule, Familie oder sonstwo mit Kindern und Jugendlichen tun, um dann zu erklären, was sie davon warum nun partout "Erziehung" nennen wollen, stößt man oft zumindest zunächst auf eine schwer erklärbare, irrational fundierte Abwehr. Was tun wir denn eigentlich, wenn wir "erziehen"? Wir unterrichten, erklären, informieren, beraten, animieren, setzen Grenzen, ärgern uns, freuen uns, trösten, ermutigen, unterstützen, streiten usw. Nichts davon ist spezifisch für den Umgang mit Kindern. Wollen wir das alles insgesamt "Erziehung" nennen oder nur einiges davon? Brauchen wir überhaupt den Begriff "Erziehung", um den komplexen Umgang mit Kindern zu beschreiben? "Erziehung" ist offensichtlich gar keine pädagogische Handlungsform, sondern nur eine Interpretationskategorie für alle möglichen Handlungsformen, und genau darin liegt das Problem. Das tatsächliche pädagogische Handeln und Verhalten, so scheint es, steht in einem mehr oder weniger großen Widerspruch zu den bewußten und vor allem unbewußten Vorstellungen, die sich um den Begriff "Erziehung" ranken. Der umgangssprachliche Vorstellungszusammenhang von "Erziehung" ist ideologisch geworden, repräsentiert nur noch Rudimente der damit gemeinten Wirklichkeit. Die Leute tun etwas anderes, als sie sagen. Aber warum sagen sie nicht, was sie tun?
Vermutlich sind es dieselben pädagogisch aufgeklärten Menschen, die einen bestimmten Typus von kulturkritischer "Erziehungs"-Literatur zu Bestsellern machen. Was immer z. B. A. Miller, M. Wynn oder N. Postman sonst unterscheiden mag, jedenfalls schildern sie die Schlechtigkeit der Welt und die Vernachlässigung der Kinder in ihr in grellen Farben, ohne auch nur in Andeutungen kundzutun, was die "Erzieher" denn nun eigentlich tun sollen bzw. ob sie als selbst Kaputt-Erzogene überhaupt etwas Vernünftiges tun können. Sind diese Leser Masochisten? Offensichtlich beruht der Erfolg dieser Art von Literatur darauf, daß das scheinbar radikal Kritische in Wahrheit alle diejenigen aufwertet, die privat oder beruflich mit Kindern umzugehen haben: je mehr alles in Scherben fällt, um so wichtiger werden wir, die "Erzieher"! Der alltagssprachliche Begriff "Erziehung" enthält offensichtlich Elemente, die sich der Aufklärung widersetzen, und diese sind normativ bestimmt: der verantwortungsvolle Umgang mit Minderjährigen unterscheidet sich, so wird postuliert, grundlegend von allen anderen Formen des verantwortlichen mitmenschlichen Umgangs, und diese Besonderheit begründet Rechte des Intervenierens, der Stellvertretung und nicht zuletzt des psychischen Besitzes, und vor allem legitimiert sie die pädagogische Profession und deren Ausbilder.
Nun sollte die Erziehungswissenschaft eigentlich versuchen, diese Irrationalität aufzuklären. Das will sie natürlich auch, aber indem sie am generellen Begriff von
401
"Erziehung" festhält, verstärkt sie nur diese kulturkritische Gegen-Aufklärung. Jeder kann nämlich das, was er im Umgang mit Minderjährigen tut, mit dem Begriff "Erziehung" rechtfertigen, weil dieser in der Umgangssprache in sich keine kritische Potenz enthält, sondern schlechthin affirmativ ist. Wer das nicht glaubt, der verfolge einmal unter diesem Gesichtspunkt öffentliche Diskussionen über Erziehungsthemen.
Auch Ulrich Herrmanns Kritik meines Buches scheint mir in diesem Punkt eigentümlich befangen. Offensichtlich ist er so irritiert darüber, daß es dem Begriff "Erziehung" ans Leder geht, daß er Schwierigkeiten hat, den Kern der Argumentation zu entdecken. Anders kann ich seine Umwege und vor allem folgenden Satz nicht deuten: "Was sollen Eltern und Erzieher eigentlich anderes tun, als die ihnen anvertrauten Kinder in einer bestimmten Richtung, die ihnen richtig und wichtig erscheint, zu beeinflussen, sie zu leiten und zu lenken, eben zu erziehen? Was wäre denn die praktische Alternative? Sie orientierungslos herumtappen lassen? Ihnen keinen Rat mehr geben, den nötigen Halt entziehen, sie treiben lassen?" (HERRMANN 1987, S. 106).
Verliebte, Eltern, Ehepaare, Freunde - alle diejenigen, die zueinander eine gewisse soziale Verbindlichkeit aufrechterhalten, "beeinflussen" einander "in einer bestimmten Richtung, die ihnen richtig und wichtig erscheint", was ist daran das Besondere im Umgang mit Minderjährigen? Sicher gibt es gewisse Besonderheiten, zum Beispiel, daß im juristischen Sinne Erwachsene Verantwortung für Minderjährige haben, aber diese Verantwortung kann defensiv und offensiv eingesetzt werden, je nachdem, wie ich den minderjährigen anderen ansehe, beziehungsweise was ich ihm wegen seines Alters schon zumuten kann. Auch gibt es die sogenannte "Generationenschwelle": Kinder können nur mit Einschränkungen gleichrangige "Partner", zum Beispiel "Freunde" von Erwachsenen sein, und ebenso unstrittig ist die Umkehrung, daß nämlich Kinder je nach Alter eine besondere Rücksicht auf ihre "Kleinheit" beanspruchen können. Aber all dies kann ich beschreiben und begründen ohne den Begriff "Erziehung". Gerade im deutschen Sprachgebrauch haftet diesem Begriff die Vorstellung an, man müsse mit und aus den Kindern etwas Bestimmtes "machen", anstatt davon auszugehen, daß sie aus sich selbst etwas machen müssen, daß sie dafür Zug um Zug die Verantwortung übernehmen müssen und daß die Erwachsenen dafür bildungspolitisch wie im unmittelbaren Umgang Möglichkeiten anzubieten haben. Erst wenn diese Blickwendung klar ist, hat es wieder Sinn, einen Begriff wie "Fördern" neu zu überdenken, wie U. Herrmann mit Recht fordert. Der von mir anvisierte Perspektivenwechsel - weg vom erwachsenen "Erzieher", hin zum lernenden Subjekt - würde auch den von U. Herrmann angesprochenen bildungspolitischen Reflexionen eine neue Richtung geben. Im Unterschied zu manchen kleinkarierten Zänkereien unserer Kultusminister, die sich ebenfalls der überlieferten Erziehungsvorstellung verdanken, wäre künftig das Bildungswesen als öffentliche Dienstleistung zu verstehen, die in erster Linie danach zu beurteilen ist, was sie zur Förderung von Fähigkeiten taugt. Das Kind bedient sich - unterstützt und ermutigt von den für es zuständigen Erwachsenen - dieser Dienstleistung, entwickelt seine Fähigkeiten, so gut es kann, und muß damit anschließend eben auf den Arbeitsmarkt gehen. Es würde hier zu weit führen, die bildungspolitischen und vor allem auch sozialpolitischen Konsequenzen dieser
402
Überlegungen durchzuspielen, aber erst, wenn wir uns vom Bedeutungsfeld des Wortes "Erziehung" lösen, werden solche Perspektiven frei.
Das Festhalten daran verführt dagegen zu falschen Alternativen. Wieso fällt U. Herrmann keine andere Alternative zum "Erziehen" ein, als "orientierungslos herumtappen lassen" und "keinen Rat mehr geben"? Im Umgang mit seinen Freunden käme ihm eine solche Logik (entweder nach eigenem Willen beeinflussen oder herumtappen lassen) gar nicht in den Sinn. Warum also beim Umgang mit Kindern? Die Fülle der Möglichkeiten eines solchen Umgangs gerät unter dem Druck des alles Konkrete vernebelnden Erziehungsbegriffes gar nicht in den Blick. Ich kann zum Beispiel meine Kinder nerven, indem ich ihnen teuren Musikunterricht aufzwinge; ich kann dasselbe Geld auch gleich für mich selbst ausgeben wollen, mich aber dann doch für den Musikunterricht von den Kindern "breitschlagen" lassen. Wenn U. Herrmann beides Erziehung nennen will, dann weiß ich nicht, welche Wirklichkeiten der Begriff noch decken soll. Ich würde das erste "Erziehung" nennen und das zweite Sozialisation, weil hier auf die Kosten-Nutzen-Rechnung der real konkurrierenden Bedürfnisse abgehoben wird, und weil ich nicht einsehe, warum ich aus meinen Kindern Musiker (oder Abiturienten, oder Professoren oder ... usw.) machen soll, wenn sie es auch nach gründlicher Diskussion und Auseinandersetzung selbst nicht wollen. Indem ich meine Bedürfnisse gegen die der Kinder stelle, "erziehe" ich nicht - was sie daraus lernen werden, kann ich nicht wissen und außerdem tue ich das im Umgang mit Erwachsenen auch - sondern ich konfrontiere sie mit einer Realität.
Ich habe den Eindruck, daß U. Herrmann wie viele andere Pädagogen am "Erziehungs"-Begriff gerade wegen der damit verbundenen normativen Implikationen festhält (daß wir wissen, was gut und richtig ist für Kinder und von daher zum Beispiel unsere berufliche Identität gewinnen). Bei ihm heißt das in dem erwähnten Zitat "leiten und lenken". Daß aber genau diese Handlungsformen nicht nur immer unrealistischer werden, sondern auch problematischer, weil geleitet und gelenkt werden eben unter den gegenwärtigen Sozialisationsbedingungen neurotisieren oder zumindest lebensuntüchtig machen kann, habe ich ja mit einer bestimmten historischen Argumentationsfigur, die ich hier nicht wiederholen kann, darzustellen versucht, und ich wundere mich ein wenig, daß der Erziehungshistoriker U. Herrmann nicht dort mit seiner Kritik ansetzt. Keine der mir bisher bekannt gewordenen Kritiken hat das übrigens versucht, und das ist doch wohl merkwürdig. Das eigentliche "Beweismittel" wird gar keiner Prüfung unterzogen, sondern nur die Schlußfolgerungen werden mit einem vorgefaßten normativen Begriff von "Erziehung" bewertet. Schon die Diskussion mit den Antipädagogen ist weithin so verlaufen. Man spürte förmlich die Erleichterung, als dann "bewiesen" wurde, daß die Antipädagogen ja auch "erziehen", weil sie ja auch irgendwie auf Kinder "einwirken".
Zur Rechtfertigung seiner Argumentation führt U. Herrmann eine Reihe von Problemen an (Hermann 1987, S. 111), die nach meiner Auffassung teilweise Grenzen der pädagogischen Handlungsmöglichkeiten darstellen, für die er aber offensichtlich eine pädagogische Zuständigkeit beansprucht, einfach weil es sich um den Umgang mit Minderjährigen handelt. Was ist, so fragt er in mancherlei Varianten, wenn es nicht funktioniert? Wenn etwas sozial wirklich nicht mehr
403
funktioniert, funktioniert es auch dann nicht besser, wenn man ein pädagogisches Problem daraus macht - es sei denn, man kann durch Lernangebote helfen. Eine wirklich zerrüttete Familie ist nicht mehr pädagogisierbar; sie kann sich nur noch auflösen, und wenn die Kinder alt genug sind, können sie weggehen von zu Hause (nicht wenige tun dies schon unter Duldung der zuständigen Gerichte und ihre Zahl wird zunehmen) (zu den familienpädagogischen Konsequenzen ausführlicher Giesecke 1987 a). Oder sie finden Kompensation bei Freunden oder anderen Verwandten. "Randständige" Familien sind ebenfalls nur begrenzt pädagogisierbar, viele Hauptschullehrer wissen ein Lied davon zu singen. Ein beiderseits zufriedenstellender Umgang von Erwachsenen und Kindern setzt ein Mindestmaß an ökonomischer Existenzgarantie voraus, die aber kann nicht der Pädagoge, sondern nur der Sozialpolitiker schaffen. Vielleicht hätten wir Pädagogen mehr öffentliche Resonanz, wenn wir dies deutlicher betonen würden, anstatt den Eindruck zu erwecken, wir würden auch mit den schlimmsten Bedingungen pädagogisch irgendwie fertig, weil wir ja die normative Verpflichtung von "Erziehung" in uns spüren. Wenn wir Pädagogen etwas für mißhandelte, mißachtete und in ihren Fähigkeiten brutal beschränkte Kinder tun wollen, dann müssen wir uns politisch für öffentliche, attraktive, d. h. des Miefs der Fürsorge enthobene Alternativen des Aufwachsens einsetzen.
Bücher über Pädagogik kann man nur für Menschen schreiben, die willens und in der Lage sind, entsprechende Überlegungen kritisch zu würdigen und mit ihren Erfahrungen zu verbinden, also nur für unseresgleichen, für die inzwischen sehr breit gewordene Mittelschicht, die über ein Mindestmaß an Existenzsicherung und Bildung verfügt und insoweit überhaupt erst einen Spielraum für intentionales Handeln hat. (Sozialpädagogik ist eine andere Sache, davon ist in dem Buch nicht die Rede). Und in unseren Kreisen gibt es genug pädagogischen Unfug zu diskutieren, der mit dem Begriff "Erziehung" gedeckt wird. Da werden Kinder gestillt, bis sie in die Grundschule kommen; junge Erwachsene stehen wie hilflose Riesenbabys lebensuntüchtig in der Weltgeschichte herum; da gibt es die Mütter, die ihre Kinder nicht loslassen können, und die Väter, die am liebsten Mütter wären; Pseudo-Feministinnen, die ihre Kinder als den Männern abgeluchste Kriegsbeute betrachten; scheidungsreife Eltern, die ums Kind kämpfen, aber meist etwas ganz anderes dabei meinen; Eltern, die ihre Kinder ehrgeizig in Schullaufbahnen zwingen, denen sie nicht gewachsen sind - um nur einiges zu erwähnen.
Ein fundamentales Mißverständnis ergibt sich in dieser Diskussion daraus, daß "Erziehung" eben kein interner wissenschaftlicher Begriff ist, der sich so oder so definieren ließe. Möglicherweise wäre der historische Prozeß, der zum "Ende der Erziehung" geführt hat, auch im Rahmen einer inneren Differenzierung des traditionellen Erziehungsbegriffs zu beschreiben, wie ihn A. Flitner in seinem "Konrad" noch einmal präsentiert hat. Ich habe es noch nicht versucht, aber ich hege insofern Zweifel, als ja gerade die Voraussetzung dieser Tradition, nämlich das Arrangement eines pädagogisch gestaltbaren "erzieherischen Milieus" immer mehr entfallen ist. Aber was immer dabei herauskäme, es wäre nur innerhalb unserer Wissenschaft interessant; denn "Erziehung" ist in erster Linie kein wissenschaftlicher Terminus, sondern ein gesellschaftlicher und als solcher steckt er in jedem erwachsenen Kopf und eben nicht in der Fassung von Schleiermacher oder Flitner, sondern als ein archaischer, der das Kind trotz aller vordergründigen
404
Aufgeklärtheit immer noch als Verfügungsmasse betrachtet, was besonders in Krisensituationen schnell deutlich wird. Nach meinen Erfahrungen ist dieser Begriff von "Erziehung" nicht aufklärbar, man kann ihn nur denunzieren und aus dem Verkehr ziehen, und statt dessen jene Begriffe ins Feld führen, die - wie eingangs erwähnt - wirklich Handlungen beschreiben.
Für die Erziehungswissenschaft andererseits ist der Begriff "Erziehung" entbehrlich geworden, denn für die pädagogischen Handlungsziele - also die normativen Implikationen des pädagogischen Handelns - haben wir inzwischen bessere Begriffe wie Autonomie und Mündigkeit zur Verfügung. Nicht "Erziehung", sondern "Lernen" sollte der Leitbegriff unserer Profession sein, und wirklich professionell werden die pädagogischen Berufe erst dann, wenn sie sich partikular verstehen, sich also auf das beschränken, was in Form von "Lernhilfe" auch tatsächlich mit einiger Aussicht auf Erfolg zu inszenieren ist (zum Begriff der pädagogischen Professionalität ausführlicher Giesecke 1987 b). U. Herrmann aber mobilisiert in seiner Kritik alles, was zumindest moralisch den universalen Anspruch der "Erzieher" und damit auch der Erziehungswissenschaft auf das Leben von Minderjährigen aufrechterhalten kann. Meine These dagegen ist, daß wir geradezu gezwungen sind, die Selbständigkeit und Autonomie der Kinder nicht nur zu fördern, sondern auch zu fordern, weil die sozialen Kontexte, Milieus und Verbindlichkeiten fehlen, die früher zur Entlastung bereitstanden. Die Grundidee der bürgerlichen Gesellschaft, die Radikalisierung der Individualität durch ihre Emanzipation von solchen sozialen Kontexten, hat inzwischen auch die Altersphase zumindest der späten Kindheit erfaßt. Die Verrechtlichung, die das Kind gegenüber Schule und Familie immer mehr zu einem selbständigen Rechtssubjekt macht, ist ein wesentlicher Motor für diese Entwicklung. Was ich Pädagogisierung und Infantilisierung des Kindes genannt habe, ist daran gemessen unverantwortlich geworden. U. Herrmanns Frage, was man denn nun mit dem machen solle, bei dem die Lernwilligkeit oder die Lernfähigkeit nicht nur aktuell, sondern längerfristig erlahme, kann ich nur so beantworten: Die Pädagogen abziehen und dem Betreffenden eine seinen Fähigkeiten entsprechende Realsituation vermitteln. Jedenfalls ist es keine Lösung, Kindern und Jugendlichen über Jahre hinweg in sogenannten "fortschrittlichen" Schulen oder Familien Illusionen zu machen, die danach nicht annähernd eingelöst werden können.
Den historisch kulturellen Prozeß, den ich beschreibe, habe ich nicht zu verantworten, ich kann nur versuchen, daraus Schlußfolgerungen zu ziehen, die an den "klassischen" Leitmotiven der Autonomie und der Mündigkeit orientiert sind. Die Ambivalenz dieser Leitmotive - einerseits Emanzipation, andererseits Entfremdung - wird uns erst heute richtig bewußt, wo sie auch die Kindheit erfaßt hat. Und die daraus resultierenden Probleme kommen erst noch auf uns zu und sie werden nicht mehr unter der antiquierten Generalüberschrift der "Erziehung" angemessen behandelt werden können.
Autonomie und Mündigkeit sind, was das Kindes- und Jugendalter angeht, nicht von uns "fortschrittlichen Pädagogen" oder von unseren Vorgängern realisiert worden, sondern von der gesellschaftlichen Entwicklung selbst. Die Freiheit, die Jugendliche heute haben, verdanken sie nicht den Pädagogen, sondern vor allem dem Markt und den Massenmedien - gegen den jahrzehntelangen Widerstand der
405
Pädagogik, wie sich an der Geschichte der außerschulischen Erziehungs- und Sozialisationsfaktoren eindrucksvoll zeigen läßt. In diesem Bereich nämlich ist die Geschichte der "erzieherischen Einwirkungen" eine Geschichte von Niederlagen.
Ich gebe zu, daß ich diese Entwicklung nicht ohne Wehmut betrachte, weil mit dem Verschwinden des Moratoriums der relativ behüteten Kindheits- und Jugendphase auch etwas verlorengegangen ist, das den heute und morgen Aufwachsenden fehlen wird. Unsere Vorstellungen über Autonomie und Mündigkeit waren bisher an die Erwartung gebunden, daß diese Fähigkeiten sich in Ruhe in einer relativen gesellschaftlichen Exterritorialität entfalten könnten, daß wir "Erzieher" also dafür einen relativ langen Zeitraum zur Verfügung haben, eben den Zeitraum, der durch "Erziehung" und nicht schon durch den vollen Ernst des Lebens geprägt ist. Verantwortung für das, was die später Erwachsenen mit unseren Vorstellungen von Aufklärung, Mündigkeit und Autonomie machen würden, hatten wir Pädagogen nicht zu übernehmen. Das eben ist anders geworden. Heute müssen wir den Kindern und Jugendlichen nicht nur klarmachen, daß es als Alternative zur individuellen Autonomie nur noch Varianten von Lebensuntüchtigkeit oder kollektiver Unterwerfung gibt, sondern auch, daß sie nicht zu haben ist ohne ein Mindestmaß an Entfremdung und kultureller Distanz - und dies nicht erst morgen - wenn man erwachsen ist - , sondern heute - schon im späten Kindesalter und im Jugendalter. Es geht nicht mehr darum, irgendwelche neuen oder alten Erziehungsziele zu propagieren, sondern darum, Kinder und Jugendliche das lernen zulassen, was sie in einer Welt, die sie sich nicht aussuchen können, für ein souveränes und mündiges Leben wirklich brauchen, und das sind keine pädagogisch verklausulierten Weltverbesserungsideen oder Wunschbilder von Erwachsenen, für die sie Kinder als Krücken und Vehikel benötigen. Mir ist klar, daß mit der Frage, was Kinder in dieser Situation wirklich brauchen und von wem sie es bekommen können, die eigentliche pädagogische Diskussion erst beginnen kann.
Literatur
Flitner, A.: Konrad, sprach die Frau Mama ... Berlin 1982.
Giesecke, H.: Die Zweitfamilie. Stuttgart 1987a.
Giesecke, H.: Pädagogik als Beruf. Grundformen pädagogischen Handelns. Weinheim/München 1987b.
Herrmann, U.: Verantwortung statt Entmündigung, Bildung statt Erziehung. Zu Hermann Gieseckes Plädoyer für ein "Ende der Erziehung". In: Zeitschrift für Pädagogik 33 (1987), H. 1, S. 105-114.
406URL des Dokuments: : http://www.hermann-giesecke.de/werke19.htm