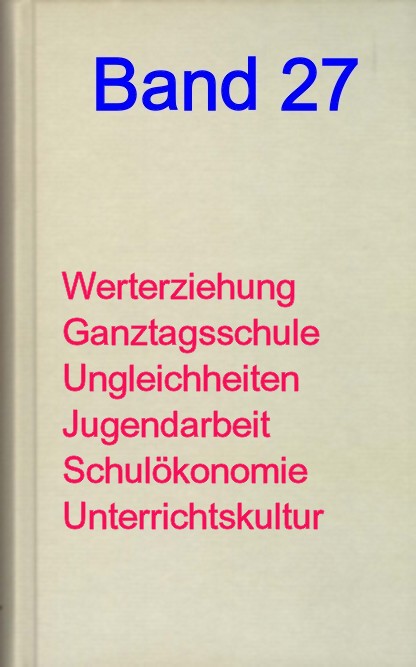 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke
Gesammelte
Schriften
Band 27 (2002 – 2003)
© Hermann Giesecke
Inhaltsverzeichnis aller Bände

Inhalt
217.Was nützt
den Schülern wirklich? (2002)
218.
Fächer, Stoffe Bildung
(2002)
219. Meine Stiefkinder lehnen mich ab (2002)
220. Bei Werner Rietz im
Vlothoer Bildungskonzern (2002)
221. Ganztagsschule
und
außerschulische Jugendbildung (2002)
222. Brauchen wir eine neue Unterrichtskultur?(2002)
223. Rezension zu: Wolfgang
Böttcher: Kann eine ökonomische Schule auch eine pädagogische sein?
(2002)
224. Werteerziehung als
schulpädagogische Aufgabe (2003)
225.
Ganztagsschulen: Operation
am lebenden Objekt (2003)
226.
Warum die Schule soziale
Ungleichheiten verstärkt (2003)
227.
PISA und der pädagogische
Zeitgeist (2003)

Dieser 27. Band meiner Gesammelten Schriften enthält Arbeiten aus den Jahren 2002-2003. In dieser Zeit war ich bereits emeritiert. Nähere biographische Angaben finden sich in meiner Autobiographie Mein Leben ist lernen, Weinheim: Juventa Verlag 2000.
Die Edition der Schriften in diesem Band bemüht
sich um
Vollständigkeit. Aufgenommen wurden nur bereits gedruckte Texte.
Allerdings wurden Texte, die nach Vorträgen mehrmals an
unterschiedlichen Orten - z.B. in Verbandszeitschriften - wiedergegeben
wurden, nur einmal berücksichtigt.
Die Plazierung der Fußnoten wurde vereinheitlicht; sie befinden sich
nun am Ende des jeweiligen Beitrags. Offensichtliche Druckfehler wurden
korrigiert. Darüber hinaus wurden die Originale jedoch nicht verändert.
Nachträgliche Anmerkungen des Herausgebers sind durch (*) oder durch
ein Namenskürzel ("H.G.") gekennzeichnet. Um die Zitierfähigkeit der
Texte zu gewährleisten, wurden die ursprünglichen Seitenangaben mit
aufgenommen und erscheinen am linken Textrand; sie beenden die
jeweilige Textseite des Originals.
Die Beiträge werden von "1" an nummeriert, die vorangehenden Arbeiten
befinden sich in den früheren Bänden.
©
Hermann Giesecke

217. Was nützt den Schülern wirklich? (2002)
Die Pisa-Studie entlarvt den pädagogischen Zeitgeist. Nun gehören die Illusionen auf den Prüfstand.
In: Stuttgarter Zeitung, 26.1.2002, S. 49
(Dieser Text ist in der Druckausgabe leicht redaktionell verändert worden, H.G.)
Die Ergebnisse der PISA-Studie, nach der die Leistungen der deutschen Schüler im Lesen sowie in der mathematischen und naturwissenschaftlichen Grundbildung weltweit im unteren Drittel rangieren, kommen nicht überraschend. Zu einem ähnlichen Urteil gelangen seit Jahren Erhebungen der Wirtschaft über die Basisqualifikationen von Schulabgängern, die eine Ausbildung beginnen wollen. Schon die im vergangenen Jahr veröffentlichte TIMSS-Studie, bei der die Lesekompetenz allerdings noch nicht abgefragt wurde, hatte ein ähnliches Resultat, aber damals dachten viele noch: wer ist oder war schon gut in Mathematik! Nun jedoch geht es mit dem Lesen um eine zentrale Kulturtechnik, von der nicht nur alle weiteren schulischen Leistungen, sondern auch alle gesellschaftlichen Teilhabemöglichkeiten - nicht zuletzt im Arbeitsleben - abhängen. Deshalb ist die öffentliche Aufmerksamkeit wesentlich größer. Von den getesteten 15-jährigen sind insgesamt fast 23 Prozent nur fähig, auf einem sehr niedrigen Niveau zu lesen. Die Forscher betrachten sie als eine "Risikogruppe" im Hinblick auf selbstständiges Lesen und damit auf die Fähigkeit zum Weiterlernen. Der Anteil derjenigen, die angeben, überhaupt nicht zum Vergnügen zu lesen, beträgt 42 Prozent und wird von keinem anderen Land übertroffen. Zu den Leistungsschwachen gehören insbesondere Ausländer, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, Aussiedler und Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien. In keinem anderen Land ist zudem der Abstand zwischen den guten und schwachen Leistungen so groß wie in Deutschland. Die viel berufene "Chancengleichheit", in deren Namen so viele pädagogische Experimente in den letzten 30 Jahren gemacht worden sind, hat sich offensichtlich als Flop erwiesen.
Inzwischen dürfte also jeder begriffen haben, dass sich unser Bildungswesen in einem miserablen Zustand befindet. Aber dürfen wir uns beklagen? Wir haben genau das Schulwesen, das wir verdienen, weil wir es seit 30 Jahren gewollt haben. Die Lehrer tun das, was sie im Studium gelernt haben, sie erteilen den Unterricht, den man ihnen in der Referendarzeit beigebracht hat: aufgebaut nach einem formalen Schema, das für kreative und von der Planung abweichende Fragen der Schüler kaum Raum lässt. Das vorher geplante Ergebnis muss am Ende der Stunde auch herauskommen, sonst ist die Lehramtsprüfung gefährdet. Wer die nun von allen Seiten geforderte "neue Lernkultur" zum Maßstab seines Unterrichts machen würde, würde vermutlich durchfallen.
Ähnlich verhält es sich mit den meisten anderen "Reform"-Forderungen, die jetzt von den Kultusministern eilfertig auf den Markt geworfen werden: bessere Förderung der Leistungsschwachen, wirksamere didaktische Ausbildung der Lehrer, größere Aufmerksamkeit für die Grundschule. Aber was soll daran neu sein?
Haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten nahezu das ganze Schulsystem darauf ausgerichtet, die leistungsschwächeren Schüler mit Hilfe von Gesamtschulen, Orientierungsstufen, Förderstufen, verlängerter Grundschulzeit, Leistungskursen und den Methoden des individualisierten Unterrichts zu fördern? Warum ist das offensichtlich erfolglos geblieben? - Für die Fortbildung der Lehrer wurde noch nie zuvor so viel Geld ausgegeben, eigene, fast monopolartige Institute mit teurem Personal haben die Kultusminister sich dafür zugelegt - was wurde den Lehrern dort eigentlich über all die Jahre vermittelt? - Didaktik als wissenschaftliche Disziplin gibt es seit 40 Jahren an den Hochschulen - warum hat sie den Ruin des schulischen Unterrichts nicht verhindert oder wenigstens öffentlich wirksam rechtzeitig kritisiert? - Nun sollen die Bildungsbemühungen im Vorschulbereich und in der Grundschule verstärkt werden - aber die infantile Unterforderung von Grundschulkindern ist schon Ende der sechziger Jahre ausführlich diskutiert worden, und der Bildungsrat hat seinerzeit ein ausführliches Reformkonzept vorgeschlagen - warum ist das so schnell versandet? Schon damals lag auf der Hand, was die Kultusministerin von Baden-Württemberg und Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Annette Schavan, heute zu Recht betont: "In jungen Jahren sind Kinder besonders empfänglich fürs Lernen. Sie schon in diesem Alter an Schule und Leistung heranzuführen ist besonders wichtig für Kinder aus bildungsfernen Schichten. In der Grundschule werden unsere Kinder systematisch unterfordert. Hier akkumuliert sich ein Rückstand, der nur mit großer Anstrengung aufzuholen ist. Kinder aus dem bildungsnahen Milieu haben es da deutlich leichter". Man könnte ironisch unter Rückgriff auf die traditionelle linke Ideologiekritik hinzufügen: Wenn wir das alte Bildungsprivileg retten wollten - was uns ja gelungen ist, wie PISA zeigt - dann hätten wir die Grundschule genauso planen müssen, wie wir sie jetzt haben - einschließlich ihrer personellen und materiellen Unterversorgung. Es ist die Tragik der sozialdemokratischen, auf Chancengleichheit gerichteten Bildungspolitik, dass sie von pädagogischen Illusionisten aus ihren eigenen Reihen torpediert wurde, denen es gelungen ist, über Jahrzehnte einen mehr als problematischen pädagogischen Zeitgeist zum ideellen Leitmotiv der öffentlichen Meinung zu machen, dessen Zauberworte auch jetzt noch zur Heilung empfohlen werden, obwohl sie Teil der Krankheit sind. Dafür nur einige Beispiele:
- Die "Neue Lernkultur", die jetzt Abhilfe schaffen soll, ist ein alter Hut der gescheiterten Schulpädagogik. Inhaltlich offen und ohne erkennbare Ziele wurde sie aus der Abneigung gegen jede Art von gedanklich geordnetem und systematischem Unterricht geboren. Unterstellt wird, unsere Schüler lernten etwas Falsches, nämlich nur "theoretisches" Wissen, weshalb sie bei dessen Anwendung, wie in der PISA-Studie gefordert, scheitern müssten. In Wahrheit lernen sie unter dieser Flagge gar kein geordnetes Wissen, deshalb können sie angesichts eines besonderen Problems auch nichts davon anwenden. Die Anwendung auf einen besonderen Fall setzt immer ein geistiges Repertoire voraus, das jenseits davon und unabhängig von ihm zur Verfügung steht. Nur was systematisch begriffen worden ist, kann auch angewendet werden, und dafür ist ein vom Lehrer geleiteter Unterricht erforderlich. Deshalb sollte man lieber von "Unterrichtskultur" und "Schulkultur" sprechen, die beide in der Tat verbessert werden müssen.
- Ein weiteres Zauberwort ist "Individualisierung des Lernens". Es drückt in erster Linie die Abneigung gegen eine für alle Schüler einer Klasse gemeinsam geltende Leistungserwartung aus. Dahinter steckt ein verkürztes Verständnis des in der Tat notwendigen und deshalb zu fördernden Individualisierungsprozesses von Schülern. Der wird allerdings nicht dadurch behindert, dass alle zur gleichen Zeit denselben Stoff bewältigen und am selben Problem arbeiten müssen, wie das im normalen Unterricht üblich ist. "Individuell" ist in diesem Zusammenhang nur das Lerntempo - weshalb in Einzelfällen eine besondere Förderung nötig werden kann - und die Art und Weise der subjektiven Aneignung, auf Grund derer das Gelernte in der Vorstellungswelt des einzelnen eine Bedeutung erhält - oder auch nicht. Das war früher gemeint, wenn man vom "Bildungswert" eines Faches oder eines Stoffes sprach. Dieser Gesichtspunkt scheint allerdings wegen der unübersehbaren Instrumentalisierung des Wissens weitgehend verloren gegangen zu sein. Die Bedeutung dessen, was in der Schule behandelt wird, ist für die meisten Eltern offensichtlich uninteressant und für die Schüler erst recht. Wenn aber das Gelernte der Person äußerlich bleibt, also den Charakter des bloß für einen bestimmten Zweck auswendig Gelernten behält, ist es nur schwer auf neue Probleme anwendbar. Diese subjektive Seite des Lernens kann die Schule nur anregen, erzwingen kann sie sie nicht. Sie hat auch nicht nur etwas mit fehlender bzw. anzuregender Motivation zu tun, sondern mit einer komplexen Lebenseinstellung, die von gesellschaftlichen Faktoren und Einwirkungen bestimmt wird, über die die Schule nicht verfügen kann. Individualisierung scheitert heute also in erster Linie daran, dass die Bearbeitung des Ich durch die Herausforderungen der Außenwelt, die sich ja in den Schulstoffen repräsentiert, verweigert wird - nicht daran, dass wir nicht jeden lernen lassen, was er will und wann er es will.
- Damit einher geht jener antistaatliche Affekt, den die Achtundsechziger bis heute erfolgreich propagiert und zumindest in der älteren Lehrerschaft fest verankert haben. Demnach hat der Staat keine Ansprüche zu erheben, sondern die Mittel für das Wohlbefinden seiner Bürger bereit zu stellen. Eine Schule, die Leistungsansprüche an die Schüler stellt, gilt somit als eine Zumutung an deren Persönlichkeit. Nur was der Schüler selbst lernen will, darf auch von ihm gefordert werden. Die Schule habe sich nach den Bedürfnissen des Kindes zu richten, nicht umgekehrt. Spätestens seit den achtziger Jahren richtete sich der pädagogische Blick auf die subjektive Befindlichkeit des Kindes, die Schulstoffe wurden verstanden als Rohmaterial für das Drama der Subjektivität des jeweiligen Schülers. Die Welt wurde nun intimisiert, nämlich auf unmittelbare menschliche Beziehungen reduziert. Eine Kultivierung des Ich machte sich breit, ins Zentrum der didaktisch-methodischen Reflexion drängte sich die Frage, was ein Thema mit diesem Ich zu tun habe. Die menschlichen Beziehungen, gerade auch zwischen Lehrern und Schülern, wurden wichtiger als die Inhalte; menschliche Nähe wurde zum Kult und Selbstzweck. Im Verlaufe dieser Entwicklung sind die Sachverhalte als etwas Objektives, in das durch Lernen einzudringen ist, weitgehend abhanden gekommen. Alle kognitive Anstrengung, die mühselige Arbeit des Denkens und Argumentierens, wurden entwertet oder zumindest als nachrangig angesehen. In diesem geistigen Klima ist es fast gleichgültig, was im Lehrplan steht. Die didaktischen Überlegungen gehen nicht dahin, grundlegende Modelle, Begriffe, Tatsachen oder Strukturen der real existierenden Welt zu entwerfen und sie auf diese Weise erkennbar und lehrbar zu machen; das gilt als pädagogisch unmodern. Statt dessen wird z.B. gründlich darüber sinniert, was welcher Stoff für das "Leben" der Schüler bedeuten könnte. Aber welches so genannte "Leben" ist damit gemeint? Das, was die Schüler gegenwärtig führen, was sie in Zukunft führen könnten, oder das, was sie vielleicht in den Blick nehmen, weil der Unterricht ihnen dafür eine lohnende Perspektive verschafft hat, auf die sie ohne ihn nicht gekommen wären? Schule hat eben – "schülerorientiert" oder "lebensweltorientiert" oder wie die Zauberworte sonst heißen - nicht nur die Aufgabe, das bisherige Leben der Schüler und damit ihre jeweilige Milieubefangenheit fortzuschreiben oder sie sogar darauf zu fixieren, sondern auch - behutsam - eine Konfrontation damit einzuleiten. Wie sonst sollten denn wohl die Kinder aus sozial benachteiligten Familien die Chance erhalten, sich daraus zu emanzipieren? Das einzige Kapital, das diese Kinder von sich aus vermehren können, sind ihr Wissen und ihre Manieren; dafür brauchen sie eine Schule, in der der Lehrer nicht nur "Moderator" für "selbstbestimmte Lernprozesse" ist, sondern die Führung übernimmt und die entsprechenden Orientierungen vorgibt. Gerade das sozial benachteiligte Kind bedarf, um sich aus diesem Status zu befreien, eines geradezu altmodischen, direkt angeleiteten, aber auch geduldigen und ermutigenden Unterrichts, wie alle Lernforschung zeigt. Die Schulreformpädagogik der letzten Jahrzehnte hat entgegen ihren Beteuerungen für diese Kinder gar nichts bewirkt, wie sich jetzt herausgestellt hat. Kinder, die der deutschen Sprache kaum mächtig sind, werden einfach in die Grundschulen gesteckt, weil es so am bequemsten und vor allem am billigsten ist, während andere, erfolgreichere Länder wie Schweden niemanden in die Schule lassen, der nicht hinreichend die Landessprache beherrscht. So manche skurrile Idee der Grundschulpädagogik ist nichts weiter als eine darauf reagierende Not-Philosophie; wenn Unterricht nicht möglich ist, lässt sich wenigstens so etwas wie "interkulturelle Erziehung" veranstalten: man spielt ein wenig miteinander, redet besänftigend über Konflikte, und eigentlich müssten die deutschen Kinder türkisch lernen statt umgekehrt die türkischen ihre aktuelle Landessprache.
Die
Kultusminister, geradezu süchtig
nach Konsens,
vermeiden jede Schuldzuweisung aneinander, der Blick soll nach vorne
gerichtet werden, nicht in die Vergangenheit. Aber vorne wird sich
nichts zeigen, was der Mühe wert ist, wenn nicht eine Bilanz gezogen
wird, die die Entwicklung der letzten Jahrzehnte kritisch in den Blick
nimmt. Statt hektischer Betriebsamkeit, die die Wähler beruhigen soll,
ist Besinnung angezeigt unter der Leitfrage: Was wollen wir eigentlich
mit der Schule, was kann sie leisten und was nicht? Dafür gehören nicht
zuletzt die pädagogischen Illusionen auf den Prüfstand. Auch dafür gibt
es eine einfache Leitfrage: Was nützt den Schülern im Hinblick auf ihre
gegenwärtige und vor allem zukünftige gesellschaftliche Teilhabe? Die
Lehrer sind nämlich die einzigen Beteiligten, deren Beruf es ist sich
daran zu orientieren. Bei ihren Verbänden und Gewerkschaften ist das
schon ganz anders - ganz zu schweigen von anderen Interessengruppen und
von Ministern, Verwaltern, Ausbildern, Fortbildnern. Sie haben fast
notwendigerweise auch ihre spezifischen Zwänge und Interessen im Sinn,
für deren öffentliche Rechtfertigung sie Ideologien brauchen, die in
der pädagogischen Praxis dann als Illusionen ankommen.

218. Fächer, Stoffe Bildung (2002)
In: Böttcher, Wolfgang/Kalb, Peter E. (Hrsg.): Kerncurriculum. Was Kinder in der Grundschule lernen sollen. Eine Streitschrift, Weinheim/Basel 2002, S. 64-81
(Abgesehen von kleinen redaktionellen Änderungen Nachdruck aus: H. Giesecke: Pädagogische Illusionen. Stuttgart 1998, S. 181-198)

In: Weg. Die Zeitschrift für alleinerziehende und getrennte Eltern, H. 2/2002, S. 11-13
(Nachdruck aus dem gleichnamigen Text in: www.familienhandbuch.de, Vgl. Nr. 264)
220. Bei Werner Rietz im Vlothoer Bildungskonzern (2002)
In: Michael Günther: Werner Rietz. Ein Leben für die politische Bildung, Münster 2002, S. 57-69.
(Leicht überarbeiteter Nachdruck aus: H. Giesecke: Mein Leben ist lernen. Weinheim/München 2000, S. 96-114)

221. Ganztagsschule und außerschulische Jugendbildung (2002)
In: deutsche jugend H. 10/2002, S. 440-446
Vorbemerkung:
Ich freue mich, mit dem folgenden Beitrag der Zeitschrift "deutsche Jugend" zu ihrem 50. Geburtstag gratulieren zu dürfen, der ich als Leser und Autor viel für meine Arbeit in den letzten vier Jahrzehnten zu verdanken habe.
Überblickt man die Entwicklung der Jugendarbeit im Spiegel der Zeitschrift "deutsche jugend" seit etwa Mitte der achtziger Jahre des vergangenen Jahrhunderts, dann fallen mindestens zwei problematische Entwicklungen ins Auge - nämlich die zunehmende Sozialpädagogisierung einerseits und, damit zusammenhängend, das abnehmende Interesse an Bildungsarbeit andererseits(1).
Die Sozialpädagogisierung legt den Schwerpunkt auf Sozialintegration und aktuelle Lebensbewältigung, also in diesem Sinne auch auf den Umgang mit Randgruppen. Historisch gesehen war die Arbeit mit dieser Klientel zum Zwecke ihrer gesellschaftlichen Integration kein Kernpunkt im Selbstverständnis der Jugendarbeit, diese beruhte vielmehr auf einem gemeinsamen Lebensgefühl solcher Jugendlicher, die nach einer "jugendgemäßen" Lebensform suchten und dabei - abgesehen von der Zeit des Nationalsozialismus - auf eine Reihe von unterschiedlichen politischen und weltanschaulichen Optionen zurückgreifen konnten. In dieser Form war Jugendarbeit ein Teil des Freizeitsystems und seiner geschichtlichen Veränderung, dessen strukturelle Besonderheiten (kein Leistungszwang, keine Leistungsbewertung, Freiwilligkeit) auch sie bestimmten.
Auf diesem Hintergrund hatte auch Bildungsarbeit lange keine Tradition in der Jugendarbeit - außer in der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen, aber dort hatte sie politisch-kompensatorische Hintergründe, weil eine selbstständige politische Tätigkeit von Jugendverbänden in diesen Organisationen nicht erwünscht war(2). Erst nach dem Zweiten Weltkrieg geriet Bildung - insbesondere als politische Bildung - auf dem Hintergrund der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus und dem Kommunismus sowie zur Verbreitung demokratischer Vorstellungen in der Jugend schon deshalb in den Aufgabenkatalog der Jugendarbeit, weil sie relativ großzügig öffentlich subventioniert wurde. Aber auch dabei ging es zunächst nicht um inhaltliche Analysen im Sinne einer wissenschaftlich fundierten Aufklärung, sondern eher um kommunikative Übungen: die jungen Deutschen sollten lernen, einander zuzuhören, argumentativ miteinander umzugehen, fair zu diskutieren, Konflikte zu schlichten - was sie in der Hitlerjugend nicht hatten lernen können. Parallel dazu wurde seit den fünfziger Jahren "Bildung" als eine mögliche Freizeitbeschäftigung entdeckt und öffentlich propagiert; diese Tendenz übertrug sich auch auf die Jugendarbeit, die darin eine neue Aufgabe erblickte, zumal sie sich damals in einer Krise befand, nachdem sie weitgehend ungebrochen an ihre Tradition vor 1933 angeknüpft hatte(3). Auf Inhalte bezogene, über eine rein pragmatisch-technisch orientierte Mitarbeiterfortbildung hinaus gehende Bildungsarbeit wurde in der Jugendarbeit jedoch erst in dem Maße möglich, wie die vorher dominierenden ehren- und nebenamtlichen Mitarbeiter durch hauptamtliche, die von den Sachverhalten genügend verstanden, wenn nicht ersetzt, so doch in zunehmendem Maße ergänzt wurden. Vorreiter und didaktische Modellgeber waren hier vor allem einige Jugendbildungsstätten – insbesondere Vlotho, Steinkimmen und später Dörnberg(4). Die didaktisch-methodische Reflexion hatte damals bereits einen so hohen Stand erreicht, dass später sogar die Schulpädagogik davon profitierte. Warum das in den letzten Jahrzehnten regelrecht vergessen wurde und die Bildungsarbeit aus dem Angebotskatalog der Jugendarbeit weitgehend verschwand, wäre genauer zu untersuchen; wahrscheinlich liegt das nicht zuletzt daran, dass sich auch in der übrigen Gesellschaft ein ähnlicher Trend durchsetzte.
Und nun kommt der "Pisa-Schock", der die Kultusminister, die Politiker und die einschlägigen
440
Verbände zu teilweise hektischen Reaktionen und zu allen möglichen Vorschlägen veranlasst, um die Resultate unseres Schulwesens zu verbessern; Bildung ist fast über Nacht zu einem "Mega-Thema" geworden. Nun sollen z.B. mehr oder gar flächendeckend Ganztagsschulen eingerichtet werden, in denen sich die Schüler bis etwa 16:00 Uhr aufhalten; lediglich etwa fünf Prozent der allgemeinbildenden Schulen bieten diese Möglichkeit gegenwärtig an.
Dieser Vorschlag fand erhebliche Zustimmung in der Bevölkerung und scheint eine Reihe von Problemen auf einen Schlag zu lösen: Eltern - vor allem Mütter - könnten gelassener ihren beruflichen Pflichten nachgehen bzw. eine berufliche Tätigkeit aufnehmen, zumal ihren Kindern eine ordentliche Mittagsmahlzeit gesichert wäre; die Schüler – vor allem die weniger leistungsfähigen – könnten besser gefördert werden; die erweiterte Schulzeit würde - so hofft man - allgemein zu höheren Schulleistungen führen.
Ganztagsschulen. Eher mehr Probleme als weniger?
Angesichts dieser Euphorie wächst bei den Verbänden und Einrichtungen der Jugendarbeit die Sorge, die Ausdehnung der Schule in den Nachmittag hinein könnte ihnen die Teilnehmer für ihre eigenen Veranstaltungen entziehen oder sie müssten ihre Programme künftig zumindest teilweise unter den besonderen Rahmenbedingungen der Schule anbieten. Aus folgenden Gründen teile ich diese Befürchtung nicht:
- Man muss unterscheiden zwischen Ganztagsschule und Ganztagsbetreuung. Im Fall der Ganztagsschule wird die gesamte zur Verfügung stehende Zeit für schulische Zwecke genutzt, also im Wesentlichen durch Unterricht bzw. durch damit zusammenhängende Projekte oder Arbeitsgemeinschaften. Diese Variante ergibt nur Sinn, wenn die Teilnahme der Schüler verbindlich ist, weil sie ja sonst Unterricht versäumen würden. Deshalb spricht man in diesem Falle auch von einer gebundenen oder geschlossenen Ganztagsschule. Sie erfordert etwa 30 bis 40 Prozent mehr Lehrer und dürfte deshalb schon aus Kostengründen nicht zur Normalschule werden – abgesehen davon, dass mittelfristig gar nicht genug Lehrer zur Verfügung stehen würden.
Bei der Ganztagsbetreuung jedoch - auch "offene Ganztagsschule" oder "Schule mit Ganztagsbetreuung" genannt - findet der Unterricht wie üblich am Vormittag statt, die Nachmittagsangebote bestehen dann neben der Hausaufgabenhilfe und speziellen Fördermaßnahmen aus eher freizeitpädagogischen Projekten. Die können den Schülern bzw. deren Eltern nur als freiwilliges Angebot angedient werden und befinden sich deshalb im Wettbewerb mit den Angeboten der Jugendarbeit. Diejenigen Kinder und Jugendlichen, die keine nennenswerten Schulprobleme haben und von sich aus - auch in den Augen ihrer Eltern - pädagogisch akzeptable Freizeitinteressen zum Beispiel im Rahmen der Jugendarbeit verfolgen, werden wenig Interesse verspüren, ihre Schulzeit auf den Nachmittag auszudehnen, wenn es dafür keine zwingenden Gründe gibt.
- Diskutiert wird der Ganztagsbetrieb ohnehin nur für die Sekundarstufe I, die Oberstufe des Gymnasiums, aus der sich zahlreiche nebenamtliche und ehrenamtliche Mitarbeiter rekrutieren, ist davon prinzipiell nicht betroffen - abgesehen davon, dass auch jetzt schon manche Unterrichtsstunden oder Arbeitsgemeinschaften aus technischen Gründen auf den Nachmittag verlegt werden müssen.
- Überzeugend an "Ganztagsbetreuung" durch die Schule ist weniger der schulpädagogische als vielmehr der sozialpädagogische Aspekt – als attraktives Gegenangebot zu einem oft tristen Fernsehalltag und Straßenmilieu, wo die Chancen der Jugendarbeit Fuß zu fassen ohnehin gering sind. Vor allem für jüngere Schüler (mindestens bis zum 4. Schuljahr) in so genannten "sozialen Brennpunkten" wäre ein solches Angebot ein Segen; deshalb sollten Schulen in solchen Regionen bevorzugt mit entsprechenden personellen und materiellen Ressourcen ausgestattet werden. Der oft zu hörende Einwand, dies diskriminiere bestimmte Kinder bzw. soziale Schichten, ist abwegig. Das "kulturelle Kapital" (Bourdieu) ist in der Gesellschaft nun einmal sehr ungleich verteilt, und es kann nicht ehrenrührig sein, denjenigen, die von Hause aus zu we-
441
nig davon mitbekommen haben, zusätzlich etwas zu vermitteln, ohne - wie beim Kindergeld - auch diejenigen zu berücksichtigen oder gar zu nötigen, die das nicht brauchen.
- Der versorgungsgerechte Kernpunkt ist offenbar das verlässliche Mittagessen, und das sollte endlich für jeden Schüler, der das wünscht, auch ermöglicht werden - auch wenn es sich um eine Halbtagsschule handelt bzw. auch wenn der Schüler anschließend an den weiteren Angeboten nicht mehr teilnimmt. Allerdings dürfte der Bedarf je nach den örtlichen Bedingungen unterschiedlich sein - in ländlichen Gebieten wohl erheblich geringer als in den großen Städten.
- Abgesehen von relativ begrenzten Sonderfällen wie den oben erwähnten würden sich die meisten Schulen mit dem Ganztagsprojekt übernehmen, weil sie dafür einen exquisiten und vielseitig qualifizierten Lehrerstab benötigen, den sie in der Regel nicht haben. Von der Jugendarbeit könnten die Schulen lernen, wie schwierig es ist, älteren Kindern oder gar Jugendlichen ein Programm anzubieten, das allenfalls von Minderheiten für interessant gehalten wird; in der Jugendarbeit können die Unzufriedenen mit den Füßen abstimmen, in der Schule werden sie vielfach mit noch größerer Renitenz reagieren als heute schon am Vormittag, wenn sie dort zwangsweise auch noch den Nachmittag verbringen müssten. Laut PISA-Studie ist das schlechte Abschneiden der deutschen Schüler vor allem auf mangelnde Qualität des Unterrichts zurückzuführen. Lediglich mehr von dem zu veranstalten, was nach diesen Ergebnissen offensichtlich versagt hat, kann keinen Sinn machen. Zudem gehen die Meinungen darüber, was unter Unterricht überhaupt zu verstehen sei, inzwischen so weit auseinander, dass sie kaum noch auf die gleiche Sache zu beziehen sind. Eine offene Debatte darüber würde aber aufdecken, dass der gesellschaftliche Konsens über Aufgaben und Ziele der Schule längst zusammengebrochen ist; die Schule steckt in einer sehr viel tieferen Krise, als die Öffentlichkeit wahrhaben will. Abgesehen davon lässt sich die für schulisches Lernen nötige Anspannung und Konzentration nicht einfach erhöhen, auch wenn dafür gelockerte Formen wie Projekte, Wahlfächer und Interessengruppen angepriesen werden. Die freieren Formen des schulischen Lernens können weitaus anstrengender sein als der klassische Frontalunterricht. Dass der Schulunterricht auf den Vormittag beschränkt ist, hat auch seinen guten Sinn; die Schüler müssen auch sein Ende im Blick haben können. Die begrenzte Zeit muss andererseits die Lehrer dazu anhalten, ihre Unterrichtsarbeit auf das Wesentliche zu konzentrieren; mehr Zeit verspricht per se noch keine bessere Qualität. Die Ausdehnung der Schulzeit wäre im Bewusstsein der Schüler ebenfalls Schule - wie auch immer ihre Veranstaltungen genannt und gestaltet werden mögen. Aus der Sicht zumindest der älteren Schüler macht es einen erheblichen Unterschied, ob sie sich unter den Bedingungen der Schule oder der Freizeit Anstrengungen zumuten. Mit einem Wort: Die Schule wird sich nur dann sanieren und im internationalen Vergleich besser abschneiden, wenn sie sich auf ihr Kerngeschäft - den Unterricht – besinnt und konzentriert, nicht dadurch, dass sie sich mit dem Ganztagsbetrieb auf eine neue Unübersichtlichkeit einlässt; dass dabei auch die didaktisch-methodischen Varianten und die Sozialbeziehungen zwischen Schülern und Lehrern auf dem Prüfstand gehören, versteht sich von selbst.
- Selbst wenn Ganztagsschulen sich in der einen oder anderen Variante durchsetzen sollten, hätten die Schüler in dieser Zeit auch ihre Hausaufgaben erledigt und stünden davon unbelastet am späten Nachmittag für die Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung.
Eigenständigkeit der Jugendarbeit
Weil sich in Deutschland seit über 100 Jahren die Vormittagsschule als Normalschule durchgesetzt hat, hat sich hier im Unterschied zu anderen Ländern eine breite außerschulische Kultur für Kinder und Jugendliche entwickelt. Dazu zählen nicht nur die vielfältigen Angebote der Jugendarbeit, sondern auch die nicht weniger breiten des Bildungsmarktes - von den Reitschulen über die Musikschulen bis zum Balletttanz. Dies nicht zu sehen, sondern immer wieder auf die erheblich größere Zahl von Ganztagsschulen im Ausland zu verweisen, zeigt, mit welcher historischen Bor-
442
niertheit bei uns bildungspolitische Fragen diskutiert werden. Es ist zudem keineswegs sicher, dass angesichts der Bedingungen einer pluralistischen Gesellschaft und einer hochkomplexen kulturellen Ausdifferenzierung das flächendeckende Überziehen von Kindheit und Jugend mit Ganztagsschulen "moderner" ist als die bisherige deutsche Lösung einer Trennung von Schule und Freizeit.
Das Verhältnis von Schule und Jugendarbeit wurde schon Ende der sechziger/Anfang der siebziger Jahre diskutiert, als die Debatte um die Gesamtschule begann, die im Idealfall als Ganztagsschule gedacht und gerade deshalb für viele Eltern interessant war. Schon damals kritisierten die Verbände der außerschulischen Bildung und Erziehung den Monopolanspruch der Schule, die sich übernehme, wenn sie sich auch noch die Freizeitpädagogik einfach einverleiben wolle. Die Vertreter der Gesamtschule reagierten mit dem Konzept der "Offenen Schule", einer Schule also, die sich in ihre Umgebung hinein öffnen und Anregungen von dort aufgreifen sollte. Daraus ist bekanntlich nicht viel geworden, weil die Schule alles, was sie anfasst, schon aus systemischen Gründen wieder zur Schule macht.
Der pädagogische Zwischenraum "Kinder- und Jugendarbeit" hat in der modernen Gesellschaft einen eigenständigen Wert bekommen, der weder von der Schule noch von der Familie wieder übernommen werden kann. Die Möglichkeiten des sozialen Lernens zum Beispiel sind in der Kindergruppe oder im Jugendverband ganz andere, als sie im Rahmen der Familie oder der Schule gegeben sind; hier wie dort dominieren ganz unterschiedliche rechtliche und soziale Anforderungen. Die für die Jugendarbeit charakteristischen Merkmale wie Freiwilligkeit der Teilnahme und Verzicht auf Leistungskontrollen prägen die Beziehungen zwischen Pädagogen und Kindern und der Kinder untereinander in besonderer Weise. Unter schulischen Bedingungen kann das nicht kopiert werden. Überhaupt müssen wir uns an den Gedanken gewöhnen, dass nicht alle wünschenswerten Lernleistungen an ein und demselben sozialen Ort möglich sind; auch diejenigen, die sich zusätzlich durch die Ausdehnung der Schule auf den Nachmittag ergeben könnten, sind geringer als oft angenommen wird, weil wichtige Sozialsituationen dort aus faktischen oder aus rechtlichen Gründen gar nicht herstellbar sind. In der Schule gibt es keine Diskothek - jedenfalls nicht unter Realbedingungen -, kein Kaufhaus, keine Straßenclique, weder einen Markt noch eine Fernsehberieselung.
Welche Schlussfolgerungen ergeben sich nun aus dieser knappen Analyse für die Beziehungen zwischen Schule und Jugendarbeit? Im Falle der "geschlossenen Ganztagsschule" wird die Jugendarbeit institutionell kaum eine Rolle spielen. Allenfalls einzelne Personen dürften von Einzelschulen für bestimmte Projekte unter Vertrag genommen werden. Bei den "offenen Ganztagsschulen" jedoch könnten institutionell verbindliche Kooperationen in Aussicht stehen, deren Schwierigkeiten jedoch nicht unterschätzt werden sollten. So ist zum Beispiel zu klären, ob die Zusammenarbeit unter den rechtlichen Bedingungen der Schule oder eines außerschulischen Trägers gestaltet werden soll, beides gemischt dürfte nicht funktionieren. Denkbar wären verschiedene Varianten: ein Träger übernimmt unter der Hoheit der Schule in deren Räumen eine bestimmte Aufgabe; oder ein Träger wird unter eigener Regie in einer Schule tätig; oder interessierte Schüler suchen im Anschluss an das Mittagessen in Absprache mit Elternhaus und Schule ein bestimmtes Angebot eines Trägers auf; oder die Schule begibt sich selbst unter die Anbieter von Jugendarbeit, so dass daran nicht nur die eigenen Schülerinnen und Schüler, sondern auch andere interessierte Gleichaltrige – etwa Freunde – teilnehmen können. Aus einer solchen Konstruktion könnte sich eine "Offene Schule" entwickeln, die diese Bezeichnung verdient, weil sie ihre Ressourcen vom Schwimmbad über den Computerraum bis zur Bibliothek zur Verfügung stellt und zudem brachliegendes pädagogisches Kapital aus ihrem Umfeld zu mobilisieren vermag. Soll das Angebot - in welcher Variante auch immer - bedarfsgerecht sein, müssten die örtlichen Gegebenheiten und Bedürfnisse ermittelt und berücksichtigt werden; dies könnte geschehen im Rahmen eines informellen "runden Tisches", der nicht zuletzt auch die Aufgabe hätte, den Schülern die vorhandenen außerschulischen pädagogischen Möglichkeiten bekannt zu machen. "Kooperation" ist jedoch kein Selbstzweck und dient oft lediglich dazu, präzise Verantwortlichkeiten
443
zum Verschwinden zu bringen; deshalb sollte die Jugendarbeit institutionell nur dann dazu bereit sein, wenn sie dies im Rahmen ihrer eigenen Bedingungen tun kann. In diesem Punkte steht nicht die Jugendarbeit, sondern die Schule unter Druck - abgesehen allerdings von der Gefahr, dass die öffentlichen Mittel auf Kosten der Jugendarbeit umgeschichtet werden.
Über die Ziele der Jugendarbeit neu nachdenken
Um dies zu verhindern, muss sie ihren besonderen Beitrag im Rahmen der gesamten Sozialisation von Kindern und Jugendlichen erneut formulieren und das Ergebnis wirkungsvoll öffentlich vertreten. Wenn sie sich dabei zu sehr an den aktuellen schulpädagogischen Debatten orientiert und sich gar in die tiefgehende Schulkrise involvieren lässt, läuft sie Gefahr, ihre eigentümliche Substanz aus dem Blick zu verlieren. Gewiss geht es dabei auch - aber nicht nur - um die Wiederentdeckung der Bildungsaufgabe. Nachzudenken wäre deshalb unter anderem über folgende Gesichtspunkte:
- Jugendarbeit bewegt sich auf dem Freizeitmarkt als ein Teil davon. Diese Tatsache ist eine nicht hintergehbare Voraussetzung und bestimmt die Erwartungen der Teilnehmer ebenso wie die - konjunkturell wechselnden - Chancen und Grenzen der pädagogischen Möglichkeiten. Auf dem Freizeitmarkt entfaltet und verändert sich der kulturelle Zeitgeist, den die Jugendarbeit im Wesentlichen aufgreifen muss, gegen den sie nur sehr begrenzt Alternativen mobilisieren kann - zum Beispiel dadurch, dass sie gegen den Strom schwimmende Minderheiten anspricht. Deshalb werden Bildungsangebote nur dann eine Chance haben, wenn sie im Rahmen des Zeitgeistes wieder "in" und auf dem Freizeitmarkt "verkäuflich" sind. Aber auch dann werden die eher geselligen, nicht an feste Inhalte geknüpften Interessen der Jugendlichen bestehen bleiben, und sie verdienen schon wegen des "vorbeugenden Jugendschutzes" berücksichtigt zu bleiben.
- Jugendarbeit ist zuständig für normal integrierte Kinder und Jugendliche, für die Arbeit mit Randgruppen ist eine spezifische professionelle Kompetenz erforderlich. Das schließt nicht aus, dass Träger und Personen der Jugendarbeit sich auch um Randgruppen kümmern, sofern diese sich im Rahmen gesellschaftlicher Normalität bewegen können. Die teilweise problematischen Erfahrungen mit der sog. "akzeptierenden Jugendarbeit" haben jedoch auch die Grenzen zum Bewusstsein gebracht und bewiesen, dass manche Jugendliche etwas brauchen, was die Jugendarbeit ihnen mangels Kompetenz nicht bieten kann, und sie sollte sich dagegen verwahren, dass sie sozialpolitisch als preiswerter Lückenbüßer benutzt wird. Der Denkfehler liegt nicht darin, dass man sich um diese Jugendlichen kümmert und sie einzubeziehen versucht; problematisch wird es jedoch, wenn man ihnen die Definition des Standards dafür überlässt. "Normale" Jugendarbeit kann man zunächst einmal nur mit "normalen" Jugendlichen machen, also mit solchen, die die Grundregeln des Verhaltens in der Öffentlichkeit bereits begriffen haben. Will man davon abweichende Jugendliche in eine solche Kultur integrieren, muss man zunächst einmal die Defizite ihrer Verhaltensmöglichkeiten erkennen und entsprechend mit ihnen bearbeiten. Sonst erscheint das Randständige als das Normale, und damit ist niemandem geholfen, schon gar nicht den abweichenden Jugendlichen selbst. Jugendarbeit ist pädagogisch gesehen dazu da, Kindern und Jugendlichen zusätzliche Lernerfahrungen zu ermöglichen, die ihnen an ihren anderen sozialen Orten nicht zur Verfügung stehen - gerade auch nicht in der Schule.
- Die pädagogische Leitvorstellung sollte nicht vom Begriff der Bildung, sondern von dem des Lernens ausgehen. Im Rahmen der besonderen strukturellen Bedingungen der Jugendarbeit sind eine Vielzahl von kognitiven, emotionalen und sozialen Lernleistungen möglich, die teilweise gar nicht ins Bewusstsein dringen, aber dennoch in das Verhaltensrepertoire eingehen. Sie ergeben sich teils aus dem Umgang mit Gleichaltrigen und mit Erwachsenen, teils aus der Verfolgung gemeinsamer Aufgaben und Ziele. Der Eigenwert solcher Lernleistungen muss nicht zusätzlich mit dem Begriff "Bildung" geschmückt werden. Sonst beteiligt man sich nur an der Inflationierung dieses Wortes, die Politi-
444
ker, Funktionäre und Medien seit langem betreiben und die folgerichtig schon die Schulen intellektuell mit in den Ruin getrieben hat. Alles, was irgendwie für wünschenswert gehalten wird, wird als "Bildung" bezeichnet; dazu gehört auch die Ausdehnung auf Komposita wie Bildungsforschung, Bildungswesen, Bildungsökonomie, Gemütsbildung, Seniorenbildung, um nur einige zu nennen. Auch die oft zu vernehmende Ansicht, dass unter Bildung jede Art von selbstreflexiver geistiger Aktivität zu verstehen sei, führt in die Irre, insofern die Frage offen bleibt, an welchen Maßstäben dies geschieht.
Problematisierung des Bildungsbegriffs
Bildung ist ein Sonderfall innerhalb der Vielfalt von Lernmöglichkeiten. Wenn man die historischen Variationen, Fehldeutungen und Fehlentwicklungen außer Acht lässt und auf den Kern der Problemformulierung seit der Mitte des 18. Jahrhunderts zurückblickt, ist Bildung ein Programm zur Produktion der je eigenen Individualität. Darunter wird jedoch nicht bloße Subjektivität oder eine genetische Vorgabe im Sinne einer herauszulockenden innerpsychischen Tatsache, sondern eine Aufgabe verstanden, nämlich das Nichtsubjektive, die außersubjektive Welt, mit ihren Regeln, Strukturen und Gesetzen ernst zu nehmen; Individualisierung erwächst als Resultat aus einem spezifischen geistigen Prozess, nicht aus bloßer Wahrnehmung von Optionen. Dieses Projekt der Selbstaufklärung ist an Weltaufklärung gebunden und verschränkt den Prozess der Herausarbeitung der Individualität deshalb mit objektiven Anforderungen. Wissen, dass in diesem Zusammenhang erworben wird, ist hier jedoch kein Selbstzweck, sondern ein notwendiges Mittel, um sich zutreffende Vorstellungen über die Welt aufzubauen. Es geht demnach um eine eigentümliche Beziehung von Sache und Person, nicht um die bloße Einverleibung einer bestimmten Wissensmenge - was die Schule vielfach bildungsfeindlich macht - , aber auch nicht um die Beliebigkeit von persönlichen Interpretationen oder wenn diese durch die Zufälligkeit einer Gesprächssituation zu Stande kommen. Der je individuelle Bildungsprozess beruht auf Auseinandersetzung mit der Welt, auf dem immer wiederholten Abarbeiten der Differenz zwischen der bisherigen Erfahrung einerseits und den ihr widersprechenden Ansprüchen der Bildungsstoffe bzw. der Lebensanforderungen andererseits. Diese Konfrontation ist nicht möglich, ohne immer wieder Sinn- und Moralfragen nicht nur an die Welt, sondern auch an sich selbst zu richten. Eine in diesem Sinne selbstreflexive Grundhaltung macht den eigentlichen Kern von Bildungsprozessen aus, aber sie ist ein auch psychisch mühsames Unterfangen, weil sie mit ständiger Verunsicherung verbunden ist. Deshalb kann das Leben nicht allein aus Bildungsanstrengungen bestehen, es gibt vieles Wichtige, das damit wenig zu tun hat, im Gegenteil einer eher dumpfen, unreflektierten Selbstverständlichkeit bedarf, um nicht die Orientierung zu verlieren. Wenn also die Jugendarbeit in diesem Sinne Bildungsveranstaltungen anbietet, tritt sie damit in Distanz zur "normalen" Selbstverständlichkeit etwa des üblichen Gruppenlebens. Außerdem muss sie dann dafür sorgen, dass höchstmögliche Sachgerechtigkeit dabei gewährleistet ist; entscheidend ist das ernsthafte Bestreben, einer Sache auf den Grund zu gehen und dabei bisherige Urteile und Werteinstellungen einer Überprüfung zu unterziehen. Das Problem dabei ist, dass die so wichtige subjektive Seite solcher Lernprozesse weder planbar noch anschließend messbar ist; das ist vielmehr nur möglich für den sachbezogenen Aspekt.
Die besondere Chance der Jugendarbeit besteht nun darin, dass sie in ihren Feldern die dafür nötige wenigstens zeitweise Distanz zu fremdbestimmten Verwertungsinteressen - etwa einer lediglich funktional verstandenen wirtschaftlichen Brauchbarkeit oder auch des schulischen Zensuren-Fetischismus - arrangieren kann. Im Umfeld eines solchen Abstandes können Kinder und Jugendliche ihre geistigen Fähigkeiten neu erfahren. Das gilt auch für schulbezogene Themen: Nachhilfeunterricht etwa Rahmen eines Angebotes der Jugendarbeit kann nicht nur finanzschwachen Familien eine Hilfe bieten, sondern bei den Schülern vielleicht auch dank des bildungsfreundlichen Ambiente geistige Interessen mobilisieren, die in der Schule nicht zum Zuge gekommen sind, aber nun dorthin zurückwirken. Oder didaktisch fantasievolle Arrangements zur Sprachförderung führen möglicherweise zu Leseinteressen, die
445
vorher nicht zu erkennen waren. Wenn die Jugendarbeit vom Sinn der Bildung ausgeht, wird sie auch die kleinen Schritte entdecken, die auf den Weg dorthin führen.
Soll dabei jedoch nicht Dilettantismus triumphieren, werden Mitarbeiter gebraucht, die genügend von den zu behandelnden Sachverhalten verstehen, sonst lohnt sich die geistige Anstrengung nicht, die die Kinder und Jugendlichen ihrerseits aufbringen müssen - dieses Problem haben sie oft schon in ihren infantilisierten Schulen. Ich weiß nicht, ob solche Mitarbeiter gegenwärtig in genügender Zahl zur Verfügung stehen; wenn nicht, bleibt die Frage, woher sie kommen sollen. Außerdem muss die Jugendarbeit sich mehr für "elitäre" Minderheiten interessieren, z.B. für diejenigen Schülerinnen und Schüler, die in ihren Schulen weit unterfordert sind. Die Wiederentdeckung der Bildungsarbeit erfordert also mehr als nur eine Programmänderung, sie wird ohne Auseinandersetzungen etwa mit übertriebenen egalitären Tendenzen, mit den die gegenwärtige öffentliche Diskussion beherrschenden vollmundigen pädagogischen Zauberworten sowie über die erforderliche Qualifizierung von Mitarbeitern kaum zu haben sein.
Anmerkungen:
1 Vgl. dazu die Beiträge in: deutsche jugend, Heft 7-8/2002
2 Vgl. H. Giesecke: Vom Wandervogel bis zur Hitlerjugend, München 1981; als Volltext unter: www.hermann-giesecke.de/wv.htm
3 Vgl. Martin Faltermaier (Hrsg.).: Nachdenken über Jugendarbeit, München 1983
4
Zur Bildungsarbeit in Steinkimmen:
H.-H. Schepp: Offene Jugendarbeit, Weinheim 1963 - H. Giesecke:
Politische Bildung in der Jugendarbeit, München 1966, als Volltext
unter: www.hermann-giesecke.de/steink.htm – Zur Arbeit im Jugendhof
Dörnberg: U. Lüers u. a.:
Selbsterfahrung und Klassenlage, München 1971 – Ferner:
H. Kentler: Jugendarbeit in der Industriewelt, München 2. Aufl. 1962

In: CDU Nordrhein-Westfalen (Hrsg.): Blickpunkt Schule. Reden vom Kongress "Blickpunkt Schule" der CDU NRW, 29 Juni 2002, Wasserwerk Bonn, S. 31-36
Sieht man sich die Ergebnisse von PISA an, muss man zu der Überzeugung gelangen, dass eine verbesserte Unterrichtskultur unbedingt erforderlich ist. Aber was heißt das?
"Guter Unterricht ist, wenn nicht mehr unterrichtet wird." So lautet eine oft zu hörende und zu lesende Parole. Tatsächlich gehen die Meinungen darüber, was unter Unterricht überhaupt noch zu verstehen sei, inzwischen so weit auseinander, dass sie kaum noch auf einen Nenner zu bringen sind. Diese tiefe Kluft signalisiert einen Konsensverlust, den es nicht einmal auf dem Höhepunkt der Auseinandersetzungen um die Gesamtschule in den 70er Jahren gegeben hat. Wie die vielfältigen Reaktionen auf PISA zeigen, befinden wir uns in einer Art von Schulkulturkampf, der weniger parteipolitische als vielmehr berufspolitische Hintergründe hat. Was in den Schulen wirklich geschieht, wissen wir nicht zuverlässig, auch PISA gibt uns darüber keine hinreichende Auskunft. Vieles spricht aber dafür, dass dort im Hinblick auf einen geordneten Unterricht teilweise chaotische Zustände herrschen, die durch gewisse Zauberworte des pädagogischen Zeitgeistes schön geredet werden.
Deshalb führt es nicht weiter, einfach den wohl klingenden Zauberworten der gegenwärtigen öffentlichen Diskussion weiter zu folgen, vielmehr müssen wir die Überlegungen vom Fundament her neu aufbauen. Welche Faktoren gehören zu einer befriedigenden und erfolgreichen Unterrichtskultur? Unter "Kultur" verstehen ich hier einen von Menschen gestalteten Handlungszusammenhang, der bestimmten Zielen folgt und auf gemeinsam anerkannten Werten beruht. Dazu in der von mir erwarteten Kürze die folgenden Hinweise:
1. Unterricht geht vom Lehrer aus, nicht vom Schüler und auch nicht von den Mitschülern - so wichtig diese für das Unterrichtsgeschehen sind. Der Lehrer hat das Pensum der Grundbildung, das die Schüler noch vor sich haben, bereits hinter sich; er hat die Sachverhalte studiert, er kann Wichtiges von weniger Wichtigem unterscheiden, er kennt die Methoden des Lernens. Die führende Bedeutung
31
des Lehrers bleibt auch dort erhalten, wo sie wie bei bestimmten didaktisch-methodischen Arrangements zu verschwinden scheint. Ohne Lehrer kann es alle möglichen Lernsituationen und Lernerfolge geben, aber keinen Unterricht.
Das Leben selbst lehrt zwar vieles und wichtiges, aber es unterrichtet nicht. Unterricht geschieht immer in Distanz zum Leben, in das man anschließend wieder zurückgekehrt, und in dafür eigens errichteten gewissermaßen künstlichen sozialen Orten wie Schule und Hochschule. Diese Orte sind Institutionen sui generis, nicht deckungsgleich mit anderen Institutionen wie etwa Industriebetriebe, bedürfen deshalb eigentümlicher Maßstäbe und Regeln, die nicht einfach von anderen gesellschaftlichen Orten her importiert werden können. Unterricht ist eine geniale kulturelle Erfindung, weil sie uns ermöglicht, die Unmittelbarkeit unserer Existenz zu überschreiten und für noch unbekannte spätere Verwendungssituationen gleichsam auf Vorrat zu lernen; nur wenn die künftigen Handlungssituationen weitgehend unbekannt sind, ist Unterricht nötig; sonst könnte man sich auf Lernen durch Mitmachen und Imitieren beschränken. Unterricht ist zudem eine besonders effektive Form der Aneignung komplexer Sachzusammenhänge.
2. Unterricht geht primär von den Sachverhalten aus, erst sekundär auch von den sog. Bedürfnissen der Schüler. Er soll vorhandene Interessen aufgreifen, aber mehr noch neue entstehen lassen. Man kann die Didaktik und Methodik verbessern, den Umgangsstil modernisieren, aber es macht keinen Sinn, die Sachverhalte, um die es gehen muss, einer mehr oder weniger interessierten Nachfrage anzupassen oder von einem begrenzten Leistungswillen der Schüler diktieren zu lassen. Viele aktuelle schulpädagogische Erfindungen beruhen nicht auf pädagogischer Einsicht, sondern auf Anpassung an konsumorientierte Einstellungen und Verhaltensweisen der Schüler einschließlich ihrer Disziplinprobleme.
3. Unterricht, jedenfalls an den allgemein bildenden Schulen, hat die Bildung der Schüler zum Ziel. Zu diesem Zweck konfrontiert er die bisherigen Erfahrungen der Schüler mit neuen, in den Schulstoffen gedanklich und methodisch geordneten, und vor allem auch mit denjenigen Werten und Normen, die darin enthalten sind. Bildungsprozesse entstehen nicht durch Fortschreibung bereits vorhan-
32
denen Erfahrungen, sondern durch Widerstand dagegen. Sie sind das Ergebnis subjektiver Leistungen der einzelnen Schüler, nämlich der Art und Weise, wie sie sich die Stoffe aneignen. Diese Prozesse können vom Lehrer angeregt, aber letztlich nicht erzwungen und schon gar nicht determiniert werden. Sie sind kaum messbar, weil sie nicht in kollektivierbaren Abstraktionen aufgehen, sondern eine je persönliche Version zum Ausdruck bringen. Diese subjektive Aneignung kann auch verweigert werden, dann bleibt bloß äußerliches Lernen von Informationen übrig. Gerade in Deutschland scheint es - im Unterschied zu einem Land wie Finnland - unter Schülern wie Studenten eine zunehmende verinnerlichte Bildungsverweigerung zu geben, also einen Widerstand dagegen, das eigene Ich durch die Herausforderungen der Schulstoffe kritisch zu bearbeiten. "Cool-bleiben" heißt da die Devise.
Diese subjektive Seite des Bildungsprozesses wird oft vernachlässigt. Sie ist zwar im Kern Privatsache der Schüler, deshalb nicht recht verwaltungsfähig und messbar, muss aber durch den Unterricht angeregt werden - z.B. durch einen Wechsel vom systematisch orientierten Frontalunterricht zum problemorientierten Anwenden sowie durch Phasen konzentrierten gemeinsamen Nachdenkens; dafür müssen die Lehrpläne Zeit lassen.
4. Unterrichten ist eine Form des sozialen Handelns. Es richtet sich auf das Handeln anderer - der Schüler - und wirkt von dort aus zurück. Erfolg kann nur eintreten, wenn die Beteiligten sich über gemeinsame Ziele und Regeln verständigt haben.
Daraus folgt, dass auch die Schüler eine Mitverantwortung für das Gelingen des Unterrichts haben. Davon ist jedoch weit und breit erstaunlicherweise wenig zu hören, die vorherrschende Meinung ist, dass es zum Beruf des Lehrers gehört, die Schüler zur Mitwirkung zu werben, zu motivieren. Diese Aufgabe setzt aber voraus, dass Verweigerung nicht grundsätzlich stattfindet, sondern lediglich auf solchen Abweichungen beruht, die kommunikativ und im Dialog behoben werden können. Ich halte es für pädagogisch höchst bedenklich, Schüler einseitig als Opfer von irgendetwas anzusehen und ihnen damit Ausreden für Fehlverhalten anzubieten. Wer immer davon etwas haben mag, die Schüler sind es nicht. Auch erfolgreiches Fördern setzt übrigens voraus, dass der betreffende Schüler auch gefördert werden will.
33
Unterrichten als soziales Handeln ist andererseits niemals nur die Anwendung von irgendetwas, sondern stets ein Schritt ins Ungewisse mit ungewissem Ausgang. Deshalb haben auch wissenschaftliche Forschungen dafür immer nur einen begrenzten Wert. Sie können dieses Handeln grundsätzlich nicht konstituieren, sondern nur vorbereiten und aufklären. Deshalb sind Untersuchungen wie TIMSS und PISA für den Handlungshorizont der Lehrer nur von begrenzter Bedeutung - im Unterschied zu ihrer bildungspolitischen Relevanz. Das gilt übrigens für andere Forschungen wie die Lernforschung auch; sie überschwemmen inzwischen die Schulen mit immer wieder neuen Fachterminologien, deren Nutzen doch relativ begrenzt bleibt, weil die Ergebnisse immer erst in den Standpunkt des Handelns übersetzt werden müssen. Geschieht das nicht, brechen neue Forschungsergebnisse nur wie einander ablösende Moden in das Schulgeschehen ein, ohne es wirklich verbessern zu können. Die grundlegende Handlungsstruktur des Unterrichtens ist als eine eigentümliche gesellschaftliche Praxis der wissenschaftlichen Aufklärung vorgegeben und nicht aus ihr deduzierbar.
5. Zu einer akzeptablen Unterrichtskultur gehört auch ein angemessenes soziales und ästhetisches Ambiente - nicht nur im jeweiligen Klassenzimmer, sondern in der gesamten Schule. Dazu zählen Ton und Stil des Umgangs - auch unter den Schülern, freundliche Gestaltung der Räume - nicht nur als Aufgabe der Putzfrauen, vorbildliches Verhalten der Lehrer, ein Klima von Gewaltlosigkeit und Gelassenheit. Auch das Thema Disziplin gehört in diesen Zusammenhang. Disziplinlosigkeit ist primär ein ästhetisches Problem, sie treibt die menschlichen Beziehungen in die Verwahrlosung. Wo Schüler, von der Institution Schule nicht geschützt, sich täglich in einem Klima von sozialem Darwinismus behaupten müssen, kann kaum noch Energie für die Aufgabe des Unterrichts übrig bleiben. In diesem Bereich ergeben sich die vielleicht wichtigsten Erziehungsaufgaben der Schule.
6. Unterrichtskultur und Schulkultur können sich jedoch nicht nur aus sich selbst heraus entfalten. Sie bedürfen der Unterstützung durch eine entsprechende öffentliche Meinung. Der Erfolg des finnischen Schulwesens - so ist zu hören - beruhe nicht zuletzt darauf, dass dort die öffentliche Meinung hinter den Schulen, ihren Aufgaben und den Lehrern steht. In Deutschland ist das offenbar - im Unterschied
34
zu früheren Zeiten - ganz anders. Hier gibt es z.B. ein weit verbreitetes Bündnis der Eltern mit ihren Kindern gegen die Schule und ihre Lehrer. Es würde sich lohnen, über die Gründe dafür einmal genauer nachzudenken. An dieser Stelle kann ich nur feststellen, dass eine Verbesserung der Schulkultur und damit der Ergebnisse des schulischen Lernens kaum möglich sind, ohne eine entschiedene Unterstützung durch die öffentlichen Meinung und die tonangebenden Medien.
7. Keine noch so gute Unterrichtskultur kann Selektion unter den Schülern verhindern. Wir müssen weiterhin davon ausgehen, dass nicht jeder zu jedem wissenschaftlichem Studium taugt, auch wenn er das Abitur hat, und dass viele Schüler nicht in der Lage sind, die psychischen und geistigen Anforderungen, die mit dem eigentümlichen Sinn des Unterrichts notwendigerweise verbunden sind, über ein bestimmtes Maß hinaus auszuhalten. Die Frage ist nur, wie wir mit dieser Tatsache umgehen. An dieser Stelle kann ich nur ein prinzipielles Ziel vorschlagen: Schulorganisation und Unterrichtskultur so anzulegen, dass jedes Kind diejenigen Fähigkeiten, die die Schule zu fördern vermag, optimal ausreizen kann und dass es diese Chance generell auch so erlebt.
8. Unterrichtskultur kann sich nicht entfalten, wenn es nicht auch eine dementsprechende Schulkultur gibt. Aber beides hängt in der Luft, wenn man die politische Dimension außer Acht lässt. Schule ist eine Einrichtung der Gesellschaft bzw. des Staates, die - wenn auch pädagogisch modifiziert - Forderungen an die nachwachsende Generation zu stellen hat. Auf einen wesentlichen Grund dafür weist die PISA-Studie hin: Unsere Gesellschaft kann sich kein soziales Dynamit leisten, das aus massenhafter schlechter Schulbildung resultiert. In Gestalt der Schule bietet die Gesellschaft der nachwachsenden Generation einerseits eine Ausbildung für die optimale Partizipation an ihren beruflichen, politischen und kulturellen Handlungsmöglichkeiten an, andererseits braucht sie diese Fähigkeiten zu ihrer eigenen Reproduktion und Weiterentwicklung. Beide Seiten können nur zusammen gesehen werden, den enormen Investitionen für das Bildungswesen muss eine angemessene Bereitschaft zur Leistung und Anstrengung seitens der Schüler - und ihrer Eltern - entsprechen.
Eine Schule, die Leistungsanforderungen an die Schüler stellt, gilt
35
jedoch vielfach als eine Zumutung an deren Persönlichkeit. Nur was der Schüler selbst lernen will, darf auch von ihm gefordert werden – und ohne "Spaß" läuft schon gar nichts. Die Schule habe sich nach den Bedürfnissen des Kindes zu richten, nicht umgekehrt. Folgerichtig hat sich der pädagogische Blick immer mehr auf die subjektive Befindlichkeit des Kindes, auf sein Ich gerichtet und dabei die notwendige und erwünschte Selbstbildung des Subjekts über weite Strecken in anstrengungslosen und deshalb wohlfeilen Subjektivismus verkehrt. Diese Tendenz verkennt die zu Grunde liegenden politischen und ökonomischen Voraussetzungen.
Leistungsfeindlichkeit ist demnach in dreifacher Hinsicht problematisch: Sie dient (1.) nicht der persönlichen Entwicklung der Schüler, ignoriert (2.) die Vorleistungen der staatlichen Gemeinschaft und ist (3.) ökonomisch gesehen parasitär. Es ist an der Zeit, diese außerpädagogischen Gesichtspunkte wieder nachdrücklich zur Geltung zu bringen – auch gegenüber uneinsichtigen Eltern.
Was die staatliche Gemeinschaft an Leistungen von ihrem Nachwuchs erwartet, muss knapp und bündig, möglichst für jedermann verstehbar, in Lehrplänen oder auch nur in einem Kerncurriculum fixiert und im Sinne einer Erfolgskontrolle in geeigneter Weise überprüft werden. Das ist auch pädagogisch geboten, weil sonst die Beziehung zwischen Lehrern und Schülern von nicht einsichtiger Willkür geprägt wäre.
Schlussbemerkung:
Die gegenwärtige Schuldebatte ist bestimmt durch eine kaum noch zu übersehende Fülle von Forderungen, Vorschlägen, wissenschaftlich mehr oder weniger fundierten Erkenntnissen und Ratschlägen und nicht zuletzt von einander widersprechenden berufspolitischen Optionen. Um all das vernünftig zu sortieren, muss man zurückgehen auf das grundlegende Handlungsmodell des Unterrichtens. Wenn man Schüler fragt, wen sie für einen guten Lehrer halten, lautet die Antwort sinngemäß: "Lehrer müssen etwas können, sie müssen es gut beibringen können, und im Übrigen sollen sie nett und gerecht zu uns sein." Das ist eine knappe und für weitere Differenzierungen durchaus brauchbare Ausgangsformel zum Stichwort "Unterrichtskultur".
36

223. Rezension zu: Wolfgang Böttcher: Kann eine ökonomische Schule auch eine pädagogische sein? (2002)
Schulentwicklung zwischen Neuer Steuerung, Organisation, Leistungsevaluation und Bildung. Weinheim und München: Juventa-Verlag 2002, 335 S., EUR 24,50
In: Die deutsche Schule, H.1/2003, S. 118-119
Dass höhere Investitionen nicht automatisch zu besseren Erträgen führen, weiß man aus der Betriebswirtschaft. Angesichts knapper werdender Mittel wird seit geraumer Zeit diese Einsicht auch auf staatliche Aufgaben übertragen - neuerdings auch im Bildungsbereich. Spätestens seit PISA gilt die Leistung des deutschen Schulwesens zumal angesichts der hohen Kosten als unbefriedigend. Versuche einer zentral dirigierten Reform haben sich in den letzten Jahrzehnten als weitgehend erfolglos erwiesen. Deshalb gilt vielen Zeitgenossen als ausgemacht, dass Besserung nur durch Reformen auf der Ebene der einzelnen Schule - durch deren Autonomisierung - zu erwarten sei. Auf diese Weise erhält die Einzelschule jedoch einen vorher nicht gekannten Handlungsspielraum, für dessen Ausfüllung sie folgerichtig ein neues Konzept braucht, und dafür bieten sich unter anderem betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte wie Effektivität, Effizienz, Organisationsmanagement und Erfolgskontrolle an. Andererseits erwächst aus der Tendenz zur Dezentralisierung die Notwendigkeit einer neuen "Rezentralisierung", weil nun allgemeine Standards etwa im Sinne eines Kerncurriculum vorgegeben und auch kontrolliert werden müssen. Auf diesem Hintergrund haben sich teilweise heftige Debatten über die Gefahr einer Ökonomisierung der Schule und damit der Verdrängung ihrer eigentlichen Bildungs- und Erziehungsaufgabe ergeben.
Der Aufklärung dieser Auseinandersetzung und der Beantwortung der Frage, ob eine ökonomische Schule auch eine pädagogische sein könne, dient die hier anzuzeigende - als Habilitationsschrift entstandene – Untersu-
118
chung von Wolfgang Böttcher. Auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Unzufriedenheit mit der Schule rekonstruiert er das Projekt jener "Neuen Bildungsökonomie", indem er die ökonomischen Kernbegriffe gründlich analysiert und sie auf ihre Verträglichkeit mit pädagogischen Intentionen abklopft. Den zentralen Stichworten "Organisation", "Qualität", "Dezentralisierung", Rezentralisierung", "Standards" und "Outputkontrolle" sind jeweils eigene Kapitel gewidmet, wobei die einschlägige amerikanische Forschung ausgiebig rezipiert wird. Aus diesen Einzelaspekten ergibt sich "Das ökonomische Programm der Schulreform", das der Verf. an den Beispielen "Curricula", "Klassengröße" und "Anreizsysteme" exemplarisch konkretisiert.
Böttcher kommt zu dem Schluss, dass zwischen einer ökonomischen und einer pädagogischen Schule kein grundsätzlicher Widerspruch bestehen muss, wenn die Grenzen des ökonomischen Denkens beachtet und kurzfristig ökonomisch inspirierte Moden vermieden werden sowie die eigentümliche Substanz des pädagogischen Handelns im Blick bleibt. Die Problematik wird an der empirischen Wirkungsforschung deutlich, die selbst in den USA und erst recht bei uns unterentwickelt ist. Aber selbst wenn sie optimal wäre bliebe die Frage, was aus ihr ernsthaft für die pädagogische Praxis abgeleitet werden könnte. "Wie und mit welchem Aufwand lässt sich begründet feststellen, welcher didaktische Ansatz welchem überlegen ist, welcher Lehrer eine Leistungszulage verdient, welche Schule ihre Schüler unterdurchschnittlich gefördert hat?" (S.290) Möglicherweise schlägt sich die angestrebte Ökonomisierung mit ihren eigenen Waffen, weil die Kosten für diesen Aufwand an Empirie und Rationalität zu hoch werden könnten. "Vielleicht kann man ja abwarten, ob solche Länder tatsächlich erfolgreicher werden, die eine Neue Steuerung implementieren? Das wäre auch eine Art empirischer Schulforschung." (S. 307)
Wolfgang Böttchers nach allen beteiligten Seiten hin ebenso offene wie kritische, dazu materialreiche, abgewogene, aber keineswegs standpunktlose, zudem erfreulich leserfreundliche Studie könnte für die Versachlichung der Diskussion von großem Nutzen sein. Ob jedoch das hier so gründlich recherchierte Reformkonzept eine ernsthafte bildungspolitische Chance bekommt oder wie andere vor ihm wieder in der Versenkung verschwindet, wird abzuwarten sein.
119

In: Die Realschule in Schleswig-Holstein, Nr. 286, Januar 2003, S.12-22
Die öffentliche Diskussion über die Werte, denen die Menschen folgen oder jedenfalls folgen sollten, hat überwiegend einen negativen Tonfall, nämlich im Sinne eines Werteverlustes. Das Thema scheint die Menschen überhaupt nur in diesem Sinne zu interessieren, obwohl das Wort "Wert" ja eigentlich positiv besetzt ist. Folgerichtig wird in der gegenwärtigen Debatte dieser negative Akzent mit einer ganzen Reihe von Krisenphänomenen verbunden: Erosion des Gemeinsinns, Ellenbogengesellschaft, einseitige Freizeit- und Spaßorientierung, Verlust moralischer Standards, ausufernder Individualismus und Egoismus. Nun soll die Schule dagegen halten, nämlich wieder so genannte "positive" Werte vermitteln. Über die Schwierigkeiten und Chancen dieses Ansinnens soll ich heute zu Ihnen sprechen. Ich möchte das in drei kleinen Kapiteln tun.
Ich möchte
1. zeigen und begründen, warum die sozialwissenschaftliche Werteforschung für das pädagogische Handeln nicht besonders ergiebig ist;
2. in wesentlichen Punkten die Schwierigkeiten des Wertbildungsprozesses bei Kindern und Jugendlichen skizzieren;
3. die Chancen der Schule zur Unterstützung dieses Prozesses beschreiben.
Zu 1: Die pädagogische Unzulänglichkeit des empirischen Wertebegriffs
Was wir über die Werte wissen, die unsere Mitmenschen vertreten und verfolgen, verdanken wir empirischen Untersuchungen. Die Sozialwissenschaftler sprechen seit Ende der sechziger Jahre von einem Wertewandel, bei dem frühere Werte – grob gesagt: die Tugenden des bürgerlichen Zeitalters - an Bedeutung verlieren und andere in den Vordergrund treten. Das wichtigste Indiz war damals, dass die Werteinstellungen der Jugendlichen sich von denen der Erwachsenen - gerade auch ihrer Eltern - deutlich zu unterscheiden begannen - und zwar quer durch alle sozialen Schichten. Seither gibt es eine Gewichtsverlagerung von Pflicht- und Akzeptanzwerten hin zu Selbstentfaltungswerten. Das Selbst, die eigenen Lebensinteressen, sind zur Leitinstanz des Denkens und Fühlens geworden. Das Bedürfnis, Subjekt des eigenen Handelns zu sein, hat einen hohen Stellenwert gewonnen.
Nun scheint sich seit den neunziger Jahre eine Trendwende abzuzeichnen. Die neue Shell-Studie 2002 zeigt, dass 85 Prozent der befragten Jugendlichen zwischen 12 und 24
12
Jahren das Familienleben, 81 Prozent Gesetz und Ordnung, 76 Prozent Fleiß und Ehrgeiz für wichtig halten. 71 Prozent wollen ihre Kinder so erziehen, wie sie selbst erzogen worden sind. Das deutet auf eine relativ hohe Übereinstimmung zwischen den Generationen hin.
Als "Werte" bezeichnen die Sozialwissenschaftler Leitvorstellungen von dem, was die Menschen für wichtig und deshalb auch für erstrebenswert halten, woran sie ihr soziales Handeln wenn nicht in jedem Einzelfall, so doch in einem strategischen Sinne ausrichten wollen. Um das herauszufinden hat die Shell-Studie 24 Vorgaben gemacht, die einzeln mit einer Bewertungsskala von eins bis sieben bewertet werden konnten. Zu den Vorgaben gehörten beispielsweise: "Gesetz und Ordnung respektieren", "einen hohen Lebensstandard haben", "von anderen Menschen unabhängig sein", "an Gott glauben". Durch Korrelationen mit anderen erhobenen Daten haben die Forscher vier Werte-Typen herausgearbeitet: die "selbstbewussten Macher", die "pragmatischen Idealisten", die "robusten Materialisten", und die "zögerlich Unauffälligen", die jeweils etwa ein Viertel der Befragten ausmachen.
Die beiden ersten Gruppen können als die Leistungselite der Jugend angesehen werden. Sie akzeptieren ohne ideologische Scheuklappen Recht und Ordnung und Leistungswettbewerb; wichtig sind ihnen darüber hinaus materielle und körperliche Sicherheit sowie Einfluss und Ansehen. Sie unterscheiden sich voneinander nur durch eine andere Akzentsetzung: für die pragmatischen Idealisten steht die Humanisierung aller Lebensbereiche im Vordergrund, während bei den selbstbewussten Machern soziales Engagement und soziales Denken zweitrangig sind. Die robusten Materialisten, überwiegend Hauptschüler und aus der Unterschicht und unteren Mittelschicht stammend, reagieren auf ihre schulischen und beruflichen Probleme häufig aggressiv: Durchsetzung, Macht und Lebensstandard spielen in ihrem Denken eine übergeordnete Rolle, Toleranz und soziales Engagement wie auch Respekt vor dem Gesetz hingegen kaum. Die zögerlich Unauffälligen schließlich, überwiegend Mädchen und junge Frauen, finden sich mit ihren familiären, schulischen und beruflichen Benachteiligungen mehr oder weniger resignativ ab, ohne eine nennenswerte Aggressivität gegen andere zu entwickeln.
Nun sind solche Resultate und Konstrukte zwar in einem allgemeinen Sinne von pädagogischem Interesse, helfen jedoch den Lehrern im Hinblick auf die Werteerziehung aus folgenden Gründen nicht viel weiter:
1. Lehrer haben es nicht mit statistischen Typen, sondern mit je einzelnen Personen zu tun; es wäre nicht sehr professionell, Schüler unter einen solchen Typus zu subsumieren und entsprechend mit ihnen umzugehen. Das pädagogische Handeln muss immer von der Vorstellung ausgehen, dass die Zukunft des Schülers offen auch für pädagogische Einwirkungen ist. Die Umfragen sagen also dem Lehrer nichts Brauchbares über seine Schüler - einzeln wie als Gruppe - in seiner Klasse.
2. Untersuchungen dieser Art bieten kaum Erklärungen für ihre Resultate – von philosophischen, anthropologischen oder hirnphysiologischen Hintergründen ganz zu schweigen. Wie entstehen solche Vorstellungen beim einzelnen Menschen, wie sind sie in der
13
menschlichen Persönlichkeit verankert, wodurch sind sie beeinflussbar? Derartige Fragen, auf deren Klärung das pädagogische Handeln eigentlich angewiesen wäre, können im Rahmen solcher Untersuchungen gar nicht gestellt und bearbeitet werden.
3. Die Untersuchungen ermitteln Meinungen über Werte, es bleibt jedoch offen, ob bzw. in welchem Umfang und unter welchen Bedingungen sich die Befragten auch danach richten; Meinungen anzugeben kostet ja nichts weiter.
4. Weil es sich im Wesentlichen um Meinungen handelt, bleiben die ermittelten Werte recht vordergründig. Sind alle empirisch ermittelten Werte gleichrangig, oder muss man sie nicht in einer Hierarchie ordnen, die nicht nur auf der statistischen Häufigkeit ihrer Nennung beruht? Gibt es höhere Werte und weniger hohe? Wie ist das Verhältnis von Werten zur Ethik, zur Moral, zu den Normen zu verstehen - und zwar so, dass man darüber angesichts des weltanschaulichen Pluralismus einen Konsens finden kann, den die Schule ja in einer so wichtigen Frage braucht?
Was ich mit diesen Andeutungen sagen will ist: der Begriff der "Werte", wie ihn die Umfrageforschung verwendet und wie er dann von der Öffentlichen Meinung aufgegriffen wird, ist kein zweckmäßiger Ausgangspunkt für die "Werteerziehung"; er ist zu einem ganz anderen Zweck – nämlich der quantitativen Erhebung von Daten – definiert worden.
Ich selbst würde lieber auf das altmodische Programm der "Bildung" setzen. Zur subjektiven Seite des Bildungskonzepts gehört nämlich wesentlich auch der Aufbau verlässlicher und stabiler innerer Orientierungen. Weil aber die Öffentlichkeit das anders sieht und auch entsprechende Forderungen an die Schule stellt, will ich versuchen, einen einigermaßen realistischen Zugang zu diesem Stichwort zu finden.
Zu 2: Schwierigkeiten des Wertbildungsprozesses
Von der empirischen Sozialforschung können wir Pädagogen durchaus den pragmatischen Ansatz übernehmen: Wir können nämlich für unmittelbar evident halten, dass die Menschen sich an verinnerlichten Wertvorstellungen zu orientieren versuchen und sie als Leitmotive ihres sozialen Handelns im Laufe des kindlichen und jugendlichen Lebens aufbauen und entwickeln, im Laufe des Lebens gewiss auch verändern. Wenn wir in diesem Sinne nach den Möglichkeiten pädagogischer Einwirkungen auf diesen Wertbildungsprozess von Kindern und Jugendlichen fragen, müssen wir uns zunächst eine Vorstellung davon machen, worum es sich da eigentlich handelt. Und da stoßen wir schnell auf eine Fülle von Schwierigkeiten.
1. Das diffuse Verhältnis von Werten und sozialem Handeln
Werte als solche können wir bei anderen Menschen und eben auch bei Schülern gar nicht erkennen, wir können sie nur insofern wahrnehmen, als sie sich im Handeln aktualisieren. Nur indem Menschen argumentieren und/oder sich in bestimmter Weise verhalten,
14
können sie anderen ihre Wertüberzeugungen überhaupt signalisieren.
Die Umkehrung dieser Einsicht gilt jedoch nicht ohne weiteres. Aus dem konkreten sozialen Handeln im Alltag kann man keineswegs einfach erkennen, welchen Werten der Betreffende folgt. Zum einen haben viele routinisierte Handlungen gar nichts oder nur sehr entfernt etwas mit Werten zu tun; es wäre lebensfremd, jede Einzelhandlung auf ihre Werthaltigkeit hin überprüfen zu wollen. Das normale Alltagshandeln bedarf zu einem erheblichen Teil auch einer dumpfen Unaufgeklärtheit, um menschlich bleiben zu können. Im normalen Alltag tragen wir nicht unentwegt die Fahne unserer Werte vor uns her.
In früheren, stark autoritär geprägten Zeiten, hat man versucht, jede menschliche Regung eines Schülers oder überhaupt eines Kindes sofort nach "gut" oder "böse" zu sortieren. Tatsächlich jedoch ist es von der Sache her nicht möglich, ein bestimmtes Schülerverhalten - etwa einen Faustschlag gegen einen Mitschüler - einer bestimmten Werthaltung zuzurechnen, weil das beim Schläger zumindest eine entsprechend geplante Strategie voraussetzen würde, und die müsste erst einmal von außen als solche erkannt werden können.
Zum anderen ist soziales, also auf andere Menschen bezogenes Handeln, niemals nur die Anwendung von Werten, selbst wenn es so geplant sein sollte. Es ist vielmehr immer auch ein Schritt ins Ungewisse; denn die anderen Beteiligten – z.B. die Schüler - handeln ebenfalls mit eigenen Absichten und nach ihren eigenen Werten. In diesem komplexen Hin und Her kann der eigene angestrebte Wert leicht aus dem Blick geraten. Wir haben es hier also mit einer prinzipiellen kommunikativen Unsicherheit zu tun, die es ebenso schwer macht, ein bewusst wertorientiertes Leben zu führen, wie ein solches bei anderen auf den ersten Blick zu beurteilen. Praktisch heißt das: Es ist für Lehrer gar nicht so einfach, aus einem bestimmten Schülerverhalten auf dahinter stehende Wertüberzeugungen zu schließen, und mit entsprechenden Vermutungen sollte man deshalb vorsichtig operieren.
Normalerweise treten vielmehr erst in Konfliktfällen Werte ins Bewusstsein. Deshalb kann die Bearbeitung von Konflikten in der Schule für die Werteerziehung sehr produktiv sein; denn Wertstrukturen bilden sich wesentlich auf Grund von Erfahrungen, die man mit seinem eigenen Handeln macht. Die Erfahrung der Grenzsetzung durch andere - Mitschüler oder Lehrer - ist enorm wichtig. Wer Kindern und Jugendlichen keine Grenzen setzt, verhindert stabile Wertbildungen bei ihnen.
2. Die moralische Indifferenz von Werten
Werte, wie die Sozialwissenschaften sie ermitteln, sind für sich genommen moralisch offen, also indifferent. Wenn jemand etwa für den Wert "Solidarität" optiert, kann er das auf seine Clique beziehen, was Ausländerfeindlichkeit aber keineswegs ausschließt. Auch die Wege und Methoden zur Realisierung eines Wertes können moralisch unterschiedlich sein. So könnte etwa der erwähnte Wert "einen hohen Lebensstandard haben" z.B.
15
durch gute Schulleistungen für die Zukunft, aber auch durch regelmäßigen Ladendiebstahl so schnell wir möglich angestrebt werden. Die angestrebten Werte müssen also nicht nur einmal, sondern immer wieder einer kritischen Revision unterzogen werden: Sie müssen einer moralischen Überprüfung standhalten. Die Maßstäbe dafür müssen logischerweise den einzelnen Werten übergeordnet sein. Welche sollen das sein, und kann es darüber im weltanschaulichen Pluralismus überhaupt Konsens geben? Das Verhältnis von Werten zu den grundlegenden moralischen Maximen ist also ungeklärt. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe der Schule, die jeweilige Wertstruktur der Schüler, die als solche nicht offenkundig ist, mit entsprechenden Ansprüchen zu konfrontieren und darüber mit ihnen nachzudenken.
3. Die kollektive Dimension von Werten
Wertorientierungen werden zwar individuell vertreten, verweisen aber auf kollektive Zusammenhänge, sonst könnten sie ja auch nicht von den Sozialwissenschaften statistisch erfasst werden. Ein einzelner allein kann keine Werte anstreben, ohne dass er sie mit anderen teilt und eine entsprechende soziale Resonanz erfährt. Werte sind also im Kern eine soziale Tatsache, sie werden aus sozialen Zusammenhängen übernommen und konkretisieren sich in sozialen Handlungen. Aus diesem Grunde ist Werteerziehung eng mit Sozialerziehung verbunden. Deshalb ist auch von entscheidender Bedeutung, welche Werterfahrungen ein Kind in seinen ihm besonders wichtigen sozialen Kontexten wie Familie und Schule, aber auch in der Peergroup macht. Es können nämlich auch die falschen Erfahrungen sein - ein problematisches Milieu, problematische Freunde. Auch Neonazis reklamieren für ihr Tun Werte. Deshalb ist es so wichtig, dass die Schule in ihren Räumen entsprechende Gegenerfahrungen arrangiert, und sich nicht auf die bloße Fortschreibung des außerschulischen Milieus der Schüler einlässt.
4. Das Verhältnis von Werten und Normen
Wegen ihrer sozialen Implikationen kann man von Werten nicht ohne Blick auf die jeweils in den sozialen Formationen gültigen Normen sprechen. Deshalb heißt das Schulfach auch zu Recht "Werte und Normen". Werte ohne die Begrenzung durch Normen wären unrealistisch oder gar anarchisch. Normen sind soziale Regeln; sie setzen dem Handeln ein Maß, das nicht überschritten werden darf, sonst werden Sanktionen geltend gemacht - Strafen oder zumindest Zurechtweisungen. Normen orientieren sich nicht an individuellen Bedürfnissen und Zielen, sondern öffnen für deren Verwirklichung einen Rahmen und begrenzen sie somit auch. Nur im Rahmen von Normen dürfen Werte realisiert werden. Deshalb ist es sehr wichtig, dass die Schule die Normen, die in ihren Mauern für das Zusammenleben unentbehrlich sind, auch nachdrücklich geltend macht, und auf diese Weise den Schülern die Erfahrung vom notwendigen sozialen Charakter der von ihnen angestrebten Werte vermittelt. Aber auch Normen sind nicht unbedingt verlässlich, sie können sich ändern - sogar in der Rechtsprechung.
16
5. Wertkonflikte
In komplexen Gesellschaften wie der unseren sind auch Wertorientierungen komplex. Es kommt ständig zu Wertkonflikten, zwischen denen im konkreten Fall entschieden bzw. eine Balance gefunden werden muss. Zukunftsorientierte Werte können z.B. mit aktuellen hedonistischen konfligieren - statt Schularbeiten dann doch lieber Fernsehen. Die neueste Shell-Studie spricht von einem "Werte-Cocktail", den Jugendliche sich zusammenbrauen, sie versuchen auf vielen Ebenen die Vereinigung von Widersprüchen: Sicherheit und Individualität, Selbstverwirklichung und Einbindung in Familie und Freundeskreis. Diese Widersprüche in ein Lebenskonzept zu integrieren ist nicht einfach. Die Schule muss also erkennen und akzeptieren, dass es über weite Strecken nicht mehr um "richtige" oder "falsche" Werte geht, sondern um vernünftige Kombinationen und Balancen von an sich akzeptablen Werten.
6. Die Pluralität der sozialen Orte
Schüler müssen – wie andere Menschen auch - ihr Handeln und damit auch ihre Wertorientierung auf unterschiedliche soziale Orte aufteilen. Der hoch im Kurs stehende Wert, "gute Freunde haben, die einen anerkennen und akzeptieren", kann nicht überall realisiert werden, selbst in der Schule nur mit relativ wenigen Mitschülern. Die Schüler müssen im Rahmen ihrer pluralistischen Sozialisation lernen, sich nach den jeweils geltenden Regeln zu verhalten - anders in der Diskothek als in der Schule, anders im Kaufhaus als in der Kirche, in der Familie anders als unter Gleichaltrigen. Diese unterschiedlichen sozialen Orte unterliegen nicht nur unterschiedlichen Regeln, also Normen, sie bieten vielmehr auch unterschiedliche Realisierungschancen für wert- bezogenes Handeln. Eine besondere Schwierigkeit des Wertbildungsprozesses besteht nun darin, dass die Schüler diese widersprüchlichen Erwartungen und Erfahrungen produktiv in ihre Persönlichkeit zu integrieren und für ihre Lebensplanung zu nutzen lernen. Was richtig, gut oder angemessen ist, ist nicht mehr in einer logisch klaren Allgemeinheit zu fassen, sondern muss nach Ort und Situation differenziert werden. Umgekehrt folgt daraus aber auch, dass der Wertbildungsprozess nicht an einem Ort - auch nicht in der Schule – so umfassend erfolgen kann, dass er von daher auf alle anderen sozialen Orte einfach übertragbar wäre.
Wichtige Sozialsituationen sind z.B. in der Schule aus tatsächlichen oder aus rechtlichen Gründen gar nicht herstellbar. In der Schule gibt es keine Diskothek - jedenfalls nicht unter Realbedingungen - , kein Kaufhaus, keine Straßenclique, weder einen Markt noch eine Fernsehberieselung. Es fehlen also wichtige Bewährungssituationen und damit Orte des sozialen Handelns, die die Schule nicht nachbilden kann. Anders gesagt: Die Schule muss einerseits ihre Begrenztheit akzeptieren, andererseits aber auch ihre Besonderheit offenkundig machen, die sie auch in Sachen Werteerziehung von anderen sozialen Orten unterscheidet. Das soll heißen: Die Lehrer müssen den Schülern klar machen, welche Werte und Normen gerade in der Schule von besonderer Bedeutung sind, wobei es gleichgültig ist, ob sie an anderen sozialen Orten der Schüler ebenfalls diese Bedeutung haben.
17
7. Werte als Ergebnis von Verhandlungen
Die Werte und Normen, die in den einzelnen sozialen Orten gelten, sind keineswegs eindeutig. Es gibt überall - auch in der Schule - eine Art von nicht klar geregelten Grauzonen, die durch Verhandlungen und Verständigung gefüllt werden müssen. Werte entstehen geradezu teilweise erst in solchen Verständigungsprozessen und werden als Normen verbindlich gemacht. Das muss in gewissem Umfange auch in der Schule geschehen; davon wird noch die Rede sein.
Zu 3: Die Chancen der Schule zur Unterstützung des Wertbildungsprozesses
Das sind nur einige Skizzen, die verdeutlichen sollen, wie komplex die Wertbildung junger Menschen heute gesehen werden muss. Es geht offensichtlich nicht darum - wie die Öffentlichkeit oft meint - , für richtig gehaltene Werte zu propagieren und zu versuchen, sie in die Köpfe und Herzen der Schüler hinein zu transportieren. Die Aufgabe ist viel komplizierter, und sie zwingt die Schule und ihre Lehrer zu einer realistischen, illusionslosen Selbstbescheidung. Dafür folgende vier Vorschläge:
1. Lehrer sollten davon ausgehen, dass sie als Pädagogen nicht für die Klärung der letzten Fragen des menschlichen Lebens - also etwa für die Metaphysik - zuständig sind. Sie sind wegen des weltanschaulichen Pluralismus beruflich ohnehin gehalten, auf einer Ebene unterhalb der weltanschaulichen Grundentscheidungen zu operieren - abgesehen natürlich vom Religionsunterricht. Was Werte eigentlich sind und welche die richtigen sind, kann die Pädagogik nicht entscheiden. Je höher die Reflexionsebene wird – etwa in Grundsatzfragen der Ethik hinein – um so weniger gibt es Konsens selbst in den dafür zuständigen Wissenschaften. Was aber in der Gesellschaft strittig ist, kann die Schule zwar im Unterricht aufgreifen und bearbeiten, aber nicht unstrittig machen.
2. Lehrer sollten davon ausgehen, dass die Werteorientierung von Kindern und Jugendlichen sich aus vielen Quellen speist, die sie nur zu einem eher geringen Teil beeinflussen können, und dass manches davon auch einem modischen Verschleiß unterworfen ist. Nach den Erkenntnissen der Shell-Studie ist die Wertevermittlung in der Schule marginal; der Werte-Mix der Jugendlichen komme nicht durch die Schule, sondern durch das soziale Umfeld und die Medien zustande. Lehrer können also die Wertorientierung ihrer Schüler nicht herstellen, sondern nur ergänzend und korrigierend in sie eingreifen.
3. Lehrer sollten sich also an das halten, was im Rahmen ihres Handlungsspielraumes möglich ist. Es führt zu nichts Gutem, ständig erzieherische Wünsche in die Welt zu setzen, die an einem bestimmten sozialen Ort - etwa der Schule - gar nicht realisiert werden können.
18
4. Weil Werte sich im sozialen Handeln beziehungsweise Verhalten einerseits und in entsprechenden Argumentationen andererseits konkretisieren, sollten Lehrer versuchen, auf diesen beiden Ebenen im Sinne einer Hilfe zur Wertbildung Einfluss zu nehmen. Das kann in der Schule auf vier Ebenen geschehen -
auf der Ebene des
- Unterrichts,
- des Vorbilds der Lehrer,
- der Normen der Institution
- und des Schullebens.
1. Die Ebene des Unterrichts. Die Unterrichtsstoffe selbst berühren in jedem Schulfach unausweichlich Werte und Normen, also Fragen des guten und richtigen Lebens. Sie müssen dort aufgegriffen werden, wo sie entstehen, und dürfen nicht in ein besonderes Fach abgeschoben werden. Werteerziehung in der Schule heißt zu allererst, diese Aspekte der Sachverhalte wieder stärker in den Mittelpunkt des Unterrichts zu rücken. Das ist eigentlich immer schon gemeint, wenn vom bildenden Unterricht die Rede ist. Dabei geht es nicht um eine von außen herangetragene Moralisierung der Stoffe, die in der Regel von Schülern zu Recht innerlich abgewehrt wird, sondern um sachbezogene Reflexion dessen, was sowieso im Unterricht behandelt wird. Das didaktische Strukturmuster dafür ist die Konfrontation. Das heißt: Die bisherige Wertbildung der Schüler - wodurch immer sie erfolgt ist - wird konfrontiert mit solchen Werten und Normen, die im sachorientierten Unterricht - etwa in einer Kurzgeschichte - zum Vorschein kommen. Diese Differenz schafft die nötige Distanz, um in der Klasse eine diskursive Auseinandersetzung über Wertfragen führen zu können, deren Ergebnis vielleicht die kritische Revision des bisherigen eigenen Standpunktes ist.
Insofern die Schüler sich im Unterricht primär nicht mit sich selbst bzw. mit ihrer aktuellen Befindlichkeit befassen, sondern mit geistigen Ansprüchen, die die Stoffe und damit auch die natürliche und kulturelle Wirklichkeit an sie stellen, werden sie auch mit Werten konfrontiert, an denen sie sich abarbeiten können. Die Schule lehrt keine Werte, sie übt deren Reflexion. Genau darin liegt die wertbildende Bedeutung des Unterrichts.
2. Die Ebene des Vorbilds. Von nicht zu unterschätzender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang das Vorbild der Lehrerinnen und Lehrer: wie sie mit Schülern kommunizieren und sich Konflikten stellen, wie sie sich fachlich und didaktisch präsentieren, wie sie selbst mit dem geistigen Gehalt ihrer Stoffe umgehen, wie sie zwischen persönlicher Meinung und sachlicher Information unterscheiden, wie sie mit Stärken und Schwächen von Schülern umgehen usw. Nach wie vor können von Lehrerinnen und Lehrern bedeutsame Vorbildwirkungen ausgehen, auch wenn das nicht immer offensichtlich ist. Es widerspricht der grundsätzlich gebotenen weltanschaulichen Neutralität der Schule auch nicht, dass der Lehrer als Person seine eigene Position in moralischen Fragen in argumentativer Form - also nicht bloß als Bekenntnis - offenbart - zumal dann, wenn er von
19
Schülern ausdrücklich danach gefragt wird. Das setzt natürlich voraus, dass die Lehrer selbst ein reflexives Verhältnis zu den Werten finden, für die sie persönlich einstehen, und dies auch im Rahmen der Schule deutlich werden lassen. Wertbildung hat in einem hohen Maße mit personalem Austausch zu tun.
3. Die Ebene der institutionellen Regeln. Die beiden eben erwähnten Ebenen der Werteerziehung - der normative Gehalt der Schulstoffe und das Vorbild der Lehrer - können den Schülern allerdings im Sinne einer Einwirkung nur angeboten werden, es steht ihnen aber frei, sie zu akzeptieren oder auch nicht. Kein Schüler kann gezwungen werden, einen bestimmten Lehrer als Vorbild zu betrachten, oder einen bestimmten Stoff im Sinne des Lehrers für seine eigene Wertbildung zu deuten.
Verbindlich müssen jedoch die institutionellen Regeln der Schule sein; die können und müssen eingefordert und durchgesetzt werden wie in jeder anderen öffentlichen Institution auch. Es sind in der Schule diejenigen Regeln, die für eine erfolgreiche Unterrichtung unentbehrlich sind: eine gewisse Grunddisziplin, gewaltloser und höflicher Umgang miteinander, Toleranz in Verbindung mit Bereitschaft zur argumentativen Auseinandersetzung; prinzipielle Bereitschaft zur Mitwirkung an der gemeinsamen Aufgabe.
An diesem Punkt gibt es zwei Probleme: die Begründung dieser Regeln und die Gestaltung der erwähnten Grauzonen.
Dass Regeln, denen man folgen soll, durch Gründe legitimiert sein müssen, ist eine der wesentlichen Errungenschaften des erwähnten Wertewandels. Merkwürdigerweise geschieht das in der Schule offenbar selten. Die Schule klärt die Schüler über vieles auf, aber nicht über sich selbst. Vielleicht liegt das daran, dass jeder zu wissen meint, wozu die Schule da ist. Ich habe da meine Zweifel, zumal was die Schüler betrifft. Jedenfalls könnte man ihnen zumindest folgende Gesichtspunkte zur Begründung notwendiger Regeln mitteilen:
- 1. Begründung: In Gestalt der Schule bietet die Gesellschaft der nachwachsenden Generation einerseits eine Ausbildung für ihre optimale Teilhabe an den beruflichen, kulturellen und politischen Handlungsmöglichkeiten an. Andererseits braucht die Gesellschaft diese Fähigkeiten zu ihrer eigenen Reproduktion und Weiterentwicklung. Beide Seiten können nur zusammen gesehen werden, den enormen Investitionen für das Bildungswesen muss eine angemessene Bereitschaft zur Leistung und Anstrengung seitens der Schüler entsprechen. Unsere Gesellschaft hat z.B. ein Recht darauf, sich kein soziales Dynamit heranzuziehen, das aus massenhafter schlechter Schulbildung resultiert.
- 2. Begründung: Als Institution ist die Schule im Unterschied zur Familie Teil des öffentlichen Lebens, und das Kind tritt mit dem Schulbeginn in dieses öffentliche Leben ein. Daraus folgt unter anderem, dass der Schulunterricht nicht einfach die Fortsetzung des familiären Milieus auf neuer Ebene sein kann. Dieser Gesichtspunkt ist für die Werte-
20
erziehung unmittelbar relevant. Im privaten Rahmen der Familie dürfen nämlich auch Vorurteile aller möglichen Art, etwa rassistische oder sexistische, vertreten werden, jedenfalls kann das niemand verhindern; die Schule dagegen ist universellen Maßstäben wie Toleranz und Wahrheit verpflichtet, also solchen, die für das Zusammenleben außerhalb der Familie, nämlich in der ganzen Gesellschaft, verbindlich sind. Die wünschenswerte Zusammenarbeit zwischen Elternhaus und Schule darf also nicht verkürzt interpretiert werden. Es ist möglich und auch gerechtfertigt, dass der Schüler in der Schule andere Werthaltungen kennen lernt, als sie in seiner Familie üblich sind. Auch das ist mit dem Begriff "Konfrontation" gemeint.
- 3. Begründung: Die Schule als Institution muss darauf achten, dass sie ihren von der Gesellschaft vorgegebenen und von den Steuerzahlern ermöglichten Zweck auch verwirklichen kann. Dafür muss die Schule ihre Macht zur Geltung bringen, die sie als Institution zur Verfügung hat. Der Begriff "Macht" in diesem Zusammenhang ist dem pädagogischen Zeitgeist höchst verdächtig, als sei das per se etwas Böses. Es gibt aber keine machtfreien sozialen Gebilde, die Frage ist immer nur, wessen Macht sich mit welcher Legitimation Geltung verschafft. Die Schule als Institution hat z.B. das Recht und die Pflicht, ihre Mitglieder zu schützen: die Schüler voreinander und vor ihren Lehrern, die Lehrer voreinander und vor den Schülern und deren Eltern. Die Machtfrage darf also nicht pädagogisch verschleiert werden, sie muss vielmehr ins Bewusstsein genommen und mit der pädagogischen Aufgabe vermittelt werden.
Allerdings: Auf dieser institutionellen Ebene geht es nicht um die Durchsetzung eines allgemeinen Tugendkatalogs oder gar einer zu bekundenden Gesinnung, sondern um die Durchsetzung eines bestimmten Verhaltens. Eine öffentliche Institution - mit Ausnahme des Gerichts, aber das ist ein Sonderfall - darf weder von uns Erwachsenen, noch von Kindern eine bestimmte Gesinnung oder eine bestimmte Charakterstruktur erwarten. Niemand muss irgendeinen anderen Menschen mögen, aber verhalten muss sich jeder ihm gegenüber höflich und zivilisiert und erst recht im Rahmen der Gesetze. Auf diesem Hintergrund sind übrigens solche Kopfnoten in den Zeugnissen problematisch, die sich auf mehr als auf das offensichtlich erkennbare Verhalten beziehen.
Und nun zu den zu gestaltenden Grauzonen. Die erwähnten Regeln der Institution sind einerseits zu grobschlächtig, als dass sie das Leben in der Schule im Einzelnen regeln könnten, andererseits aber auch nicht mehr hinreichend. Dieser offen bleibende Raum muss aber gefüllt werden. Was soll zum Beispiel im Konfliktfalle zwischen Schülern oder zwischen Schülern und Lehrern geschehen? Viele Schulen haben inzwischen Schulordnungen verabschiedet, in denen solche Alltagsfragen in autonomer Verantwortung geregelt sind. Dabei spielen nicht mehr wie früher autoritäre Entscheidungen eine Rolle, sondern Prozeduren mit dem Ziel der Verständigung. Was tun wir wie und mit welchem Ziel, wenn etwas schief läuft? Da werden keine eindeutigen sittlichen Urteile mehr wie
21
früher gefällt, sondern eher Kompromisse angestrebt. Anders gesagt: In solchen Prozessen werden gemeinsame Werte erst einmal produziert oder zumindest ins Bewusstsein gehoben, um dann durch gemeinsam anerkannte Normen auch geschützt zu werden. Diese Dimension der Werteerziehung ist für die Schulen historisch gesehen noch weitgehend Neuland - übrigens auch für die unermüdlich Erlasse produzierende Administration.
4. Die Ebene des Schullebens. Auf die eben beschriebene Weise entsteht über die Aufgabe des Unterrichtens hinaus eine neue Schulkultur, die für die Wertbildung der Schüler von entscheidender Bedeutung sein kann. Es geht um die gemeinsame Gestaltung des sozialen Miteinanders, um Stil und Ton des täglichen Umgangs, um die Möglichkeiten der formellen Mitbestimmung der Schüler, um ästhetische Gestaltung, aber auch um das, was man im engeren Sinne "Schulleben" nennt, also z.B. künstlerische Aufführungen, Feste und Feiern usw. Von großer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang übrigens auch als positiv und vernünftig erlebte Gewohnheiten und Rituale.
In einem aus all dem resultierenden wohlwollenden und wohltuenden, aber auch Geborgenheit und Orientierung stiftenden "Klima" sind grundlegende Werteerfahrungen möglich, die weit über das Leben in der Schule hinaus reichen können.
Fazit: Die Schulen und ihre Lehrer sollten in Sachen Werteerziehung die pathetischen pädagogischen Deklamationen, Versprechungen und Zauberworte beiseite lassen und das tun, was im Rahmen ihres Handlungsspielraums wirklich möglich ist; das ist nicht wenig, wenn auch vielleicht weniger, als die Öffentlichkeit zu Unrecht oft erwartet.
22

In: Starke Eltern – Starke Kinder ( = Deutscher Kinderschutzbund: Jahresheft 2003, S.101 - 103
(Leicht veränderter Nachdruck meiner
Funksendung:
Brauchen wir mehr Ganztagsschulen? In: Funkmanuskripte Bd. 8, F43)

226. Warum die Schule soziale Ungleichheiten verstärkt (2003)
Ein Zwischenruf
In: Neue Sammlung H. 2/2003, S. 254-256Als die heute Alt-Achtundsechziger noch jung waren – also Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre – propagierten sie ihre bildungspolitischen und schulpädagogischen Reformforderungen u.a. mit dem "restringierten Code"(1) als Faktum und Symbol für die schulische Benachteiligung der "unteren Klassen", als deren Avantgarde sie sich fühlten. Alles, was die Schule damals strukturell wie konzeptionell ausmachte, wurde unter diesem Gesichtspunkt einem ideologiekritischen Verriss unter dem Maßstab des cui bono unterzogen. Seitdem wurde nahezu das ganze Schulsystem darauf ausgerichtet, die leistungsschwächeren Schüler als milieubedingt entschuldbar zu betrachten und mit Hilfe von Gesamtschulen, Orientierungsstufen, Förderstufen, verlängerter Grundschulzeit, Leistungskursen und den Methoden des individualisierenden Unterrichts zu fördern. PISA hat nun gezeigt, dass das alles offensichtlich vergeblich war; der Abstand ist nicht kleiner, sondern größer geworden. Dieses Resultat wird im Allgemeinen der Dreigliedrigkeit des Schulwesens und der frühen Selektion angerechnet. Vielleicht wäre es aber auch angebracht, die alte Ideologiekritik wieder aus der Schublade zu holen und auf den sich fortschrittlich dünkenden pädagogischen Zeitgeist anzuwenden, der seine Geburt in jener Zeit erlebte(2). Dann könnte sich folgendes herausstellen:
1. Nahezu alles, was die moderne Schulpädagogik für fortschrittlich hält, benachteiligt die Kinder aus bildungsfernem Milieu. Sozial selektiert wird bereits mit dem ersten Schultag. "Offener Unterricht", überhaupt die Demontage des klassischen, lehrerbezogenen Unterrichts, die Wende vom Lehren zum Lernen und damit die übertriebene Subjektorientierung, die Verunklarung der Leistungsansprüche, Großzügigkeit bei der Beurteilung von Rechtschreibschwächen, Mitwirkung der Eltern (welcher wohl?) in Schulkonferenzen – um nur einige Beispiele anzuführen - hindern die Kinder mit von Hause aus geringem kulturellen Kapital daran, ihre Mängel auszugleichen, während sie den anderen kaum schaden. Der von der Familie her vorhandene Vorsprung an "kulturellem Kapitel"(3) in den bürgerlichen Schichten reicht aus, trotz konfusem Schulunterricht den Abstand zu wahren. Wenn also Lehrer etwa bei der Wahl der weiterführenden Schulform Kindern mit wenig kulturellem Kapital trotz formal guter Schulleistungen relativ geringe Weiterbildungschancen prognostizieren, dann ist das generell – nicht im Einzelfall - offensichtlich eine realistische Einschätzung, solange jedenfalls die Schule diesen Mangel nicht kompensiert – etwa durch das
254
Beibringen von Manieren, von geistiger Disziplin, von Verzicht auf unmittelbare Erfolge und auf Spaß an allen Ecken und Enden.
2. Exemplarisch lässt sich diese Kritik an der Grundschule festmachen. Die infantilisierende Unterforderung von Grundschulkindern ist schon Ende der sechziger Jahre entdeckt und heftig diskutiert worden, und der Bildungsrat hat seinerzeit ein ausführliches, wissenschaftlich fundiertes Reformkonzept vorgeschlagen - das aber ist schnell versandet. Weder die Schulbehörden noch die Lehrer oder die Eltern wollten eine solche Grundschule. Alles sollte dort vielmehr weiterhin "spielerisch" sein, systematischer Unterricht gilt bis heute als ebenso kinderfeindlich wie das Erteilen von Zensuren – vom Sitzenbleiben ganz zu schweigen. Klassische Lerntechniken wie Einmaleins, Auswendiglernen von Gedichten, Vorlesen von Texten und vor allem ständiges Üben des Gelernten sind weitgehend verloren gegangen. Hausaufgaben könnten die familiär benachteiligten Schüler diskriminieren. Tatsächlich jedoch trägt all das dazu bei, die Kinder mit geringem kulturellen Kapital auf diesen Status zu fixieren; nur in den ersten Schuljahren gäbe es vielleicht eine Chance zur schulischen Gegenwirkung.
Ideologiekritisch gewendet ergibt sich daraus eine merkwürdige Pointe: Wenn wir das alte Bildungsprivileg hätten erhalten wollen - was uns ja gelungen ist, wie PISA zeigt - dann hätten wir die Grundschule genauso planen müssen, wie wir sie jetzt haben - einschließlich ihrer personellen und materiellen Unterversorgung.
3. Der objektive Sinn, zumindest das Resultat des pädagogischen Zeitgeistes ist: Er hat das Bildungsprivileg der Mittelklasse nach unten hin verteidigt; er ebnete durch die Reduktion der Leistungsansprüche bzw. durch deren Umdefinition auch dem weniger leistungsfähigen Nachwuchs der Bürgerkinder den Weg zum Abitur und zum Hochschulstudium und vergrößerte auf diese Weise den Rückstand der anderen noch mehr.
4. Schule ist unvermeidlich eine Mittelklasseinstitution. Sie begünstigt deshalb notwendigerweise diejenigen Kinder, die aus diesem Milieu kommen. Nicht nur sind sie mit einem besseren sozialen und kulturellen Startkapital ausgestattet, ihre Schulerfahrungen und Schulerfolge werden auch zu Hause selbstverständlicher sozial akzeptiert und unterstützt. "Subjektorientierung" etwa, wie sie durch die psychologisch fundierte Schulreformpädagogik propagiert wird, ist ein Projekt der Mittelschicht, in den unteren Schichten hat sie keinen rechten sozialen Resonanzboden und gilt deshalb von Hause aus wenig. "Lebensweltorientierung" des Unterrichts meint das bürgerliche, nicht das depravierte Ambiente - davon versteht die Schule außer der Vermutung von materieller oder kommunikativer Armut nichts. In diesem Milieu ist man auch nicht "intrinsisch" motiviert - das kann man sich gar nicht leisten. Andererseits ist diese Form der Motivation Voraussetzung für allgemeinbildende, vor allem höhere Schulkarrieren.
5. Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien müssen sich also mit Hilfe der Schule von ihrem Familienhintergrund und von dem dazugehörenden kollektiven sozialen Milieu emanzipieren oder zumindest eine innere Gegenwelt dazu
255
aufbauen, wenn sie das schulische Lernangebot optimal nutzen wollen; das behindert die Gleichheit ihrer Chancen enorm. Das einzige Kapital, das diese Kinder von sich aus – ohne Hilfe ihres Milieus - vermehren können, sind ihr Wissen und ihre Manieren; dafür brauchen sie eine Schule, in der der Lehrer nicht nur "Moderator" für "selbstbestimmte Lernprozesse" ist, sondern die Führung übernimmt und die entsprechenden Orientierungen vorgibt. Gerade das sozial benachteiligte Kind bedarf, um sich aus diesem Status zu befreien, eines geradezu altmodischen, direkt angeleiteten, aber auch geduldigen und ermutigenden Unterrichts. Das gilt erst recht für solche Kinder, die der deutschen Sprache kaum mächtig sind; vielfach werden sie jedoch einfach in die Grundschulen gesteckt, weil es so für die Administration am bequemsten und vor allem am billigsten ist.
Die Hoffnung, man könne solche tief fundierten Benachteiligungen mit ein paar zusätzlichen Förderstunden in den Griff kriegen, verrät schiere Sozialromantik. Erfolgreicher könnten schon Ganztagsschulen sein, aber nur dann, wenn sie möglichst früh, nachhaltig und relativ dauerhaft ein Gegenmilieu bilden würden, das diesen Kindern im Vergleich zu ihrer sonstigen Umgebung attraktiv erscheint. Solche und andere nützliche Angebote speziell für entsprechende Regionen bzw. Stadtteile einzurichten, verteufeln die Sozialromantiker jedoch als Diskriminierung. Die objektiv Benachteiligten sollen sich nicht als solche fühlen - ein klassischer ideologischer Trick, von dem die Betroffenen nichts haben. Es ist ähnlich wie in der Sozialpolitik: Wenn die benachteiligten sozialen Schichten schon etwas bekommen sollen, wie das Kindergeld, dann sollen es alle anderen auch haben. Unter den Bedingungen der Ungleichheit ist aber Gleichbehandlung immer Ungleichbehandlung.
6. Der entscheidende pädagogische Denkfehler, der schon in der Weimarer Zeit bei der pädagogischen Begründung der gemeinsamen Grundschule zu Tage trat, liegt in der Definition des Kindes "als solchem". Da damals die Kinder des Bürgertums gemeinsam mit den anderen die Grundschule besuchen sollten, brauchte man eine pädagogische Idee, die als über den sozialen Klassen stehend angesehen werden konnte; dafür bot sich die reformpädagogische Vorstellung einer gelungenen Gestaltung der Kindlichkeit des Kindes an. So wurde die Grundschule zu einer Kinderschule, die der erzieherisch-pflegerischen Förderung aller kindlichen Kräfte den Vorrang einräumte gegenüber einer für einseitig und kinderfeindlich gehaltenen kognitiven Bildung. Dabei ist es im Wesentlichen bis heute geblieben. Das Kind "als solches" ist aber eine psychologische Fiktion. Sozial gesehen gibt es nur Kinder, die in Blankenese oder in Kreuzberg, in Reichtum oder Armut, mit gebildeten oder ungebildeten Eltern aufwachsen - um nur gröbste Differenzen zu nennen.
Ginge es um das Schulschicksal von Mittelschichtkindern, hätten wir längst eine entsprechende Milieuforschung, die nach lernrelevanten milieuspezifischen Prädispositionen und den Möglichkeiten ihrer Korrektur fahnden würde. So aber begnügen wir uns mit meist irrelevanten Schuldzuweisungen und vergießen Krokodilstränen.
226
Anmerkungen:
1 Basil Bernstein: Soziokulturelle Determinanten des Lernens, in: P. Heintz (Hg): Soziologie der Schule, Köln - Opladen 1959, S. 52-79
2 Dazu ausführlicher H. Giesecke: Wozu ist die Schule da? Stuttgart 1996, vor allem S. 121 ff.
3
Zu
diesem Begriff Pierre
Bourdieu: Wie die Kultur zum Bauern
kommt. Über Bildung, Schule und Politik. Hamburg 2001, vor allem S. 112
ff.

227. PISA
und der pädagogische Zeitgeist (2003)
In: Toni Hansel
(Hrsg.): PISA – und die Folgen?
Die
Wirkung von
Leistungsvergleichsstudien in der Schule. Herbolzheim 2003, S. 106-125
106
anderen Land übertroffen. In keinem anderen Land ist zudem der Abstand zwischen den guten und schwachen Leistungen so groß wie in Deutschland. Zu den Leistungsschwachen gehören insbesondere Ausländer, deren Eltern nicht in Deutschland geboren wurden, sowie Aussiedler und Kinder aus sozial schwachen und bildungsfernen Familien.
Nun muss man, um die Resultate dieser und anderer einschlägiger Untersuchungen richtig zu würdigen, gewiss auch ihre Grenzen sehen.
1. Die Bildungsforscher haben nicht Lehrplanwissen abgefragt, also etwas, was die Schüler eigentlich können müssen – das wäre wegen des internationalen Vergleichs gar nicht möglich gewesen. Vielmehr wurden Anwendungen getestet, die so nicht in den Lehrplänen stehen, für deren Lösung aber ein hinreichendes Leseverständnis erforderlich ist. Nun ist das mit den Anwendungen so eine Sache. Man muss nicht nur lesen können, sondern auch verstehen, worauf die Tester hinauswollen. Wer geübt ist im Beantworten von Testfragen, hat es leichter als jemand, der damit keine Erfahrung hat. Getestet wird dabei so etwas wie ein allgemeines geistiges Potential, das als solches nicht planmäßig trainierbar ist, von dem man jedoch annimmt, dass es durch richtigen Unterricht herauskommen kann – etwa im Sinne einer "Schlüsselqualifikation". Es ist jedoch fraglich, wie weit diese Unterstellung trägt. Jedenfalls waren die Aufgaben hochgradig standardisiert, um international vergleichbar gemacht werden zu können, und sie waren typische Testaufgaben in Laborsituationen, im wirklichen Leben erfolgen Anwendungen meist in kommunikativen Zusammenhängen.
Diese Einschränkung hat die nachfolgende PISA-E-Studie teilweise dadurch kompensiert, dass sie eine auf deutsche Verhältnisse bezogene Zusatzuntersuchung vorgelegt hat, deren Ergebnisse jedoch nicht minder niederschmetternd sind; von ihr ist in der öffentlichen Wahrnehmung im Wesentlichen der innerdeutsche Ländervergleich übrig geblieben.
2. Es handelt sich bei PISA um Durchschnittswerte, die noch nichts über eine bestimmte Schule oder Schulklasse aussagen. Zwar werden den Schulen auf Wunsch
107
ihre eigenen Resultate zur Verfügung gestellt, die ihnen einen Vergleich mit anderen vergleichbaren Schulen gestatten, aber der praktische Nutzen ist nicht besonders hoch. Man erfährt nämlich nicht, worauf der eigene Leistungsstand zurückzuführen ist und wie man ihn verbessern könnte. PISA hat nicht untersucht, was in den Schulen wirklich geschieht, wenn dort "Unterricht" und "Erziehung" abläuft. Jürgen Baumert hat sich zwar mehrfach kritisch über die Übertreibung der so genannte fragend-entwickelnde Methode geäußert, aber wir wissen nicht, wie weit sie in welchen Schulformen verbreitet ist und welche anderen Varianten dort in welchem Umfang eine Rolle spielen. Diese Unkenntnis schränkt den praktischen Nutzen dieser und anderer einschlägiger Untersuchungen ein - was selten von denen gesehen wird, die sich auf sie berufen. Was hat, so könnte man fragen, ein Deutschlehrer oder Mathematiklehrer von der PISA-Studie – im Hinblick auf seinen Handlungsraum in seinem Unterricht? Die Autoren von PISA haben sich immer sehr zurückhaltend über handlungsrelevante Konsequenzen ihrer Ergebnisse – etwa über guten und schlechten Unterricht - geäußert. Das hat seinen guten Grund. Je genauer nämlich die Techniken der Bildungsforschung, aber auch der Lernforschung werden, um so komplexer werden die Ergebnisse und um so weniger lässt sich deshalb aus ihnen für die pädagogische Praxis unmittelbar ableiten. Die PISA-Studie sagt z.B. nicht, was sie eigentlich unter Unterricht versteht. Vermutlich besteht zwischen dem, was in den Schulen wirklich geschieht, und dem, was bildungspolitische und schulpädagogische Veröffentlichungen darüber sagen, eine erhebliche Differenz.
3. Aus der Komplexität dessen, was den Bildungsstand eines Schülers zum Zeitpunkt des Tests ausmacht, wurde nur ein ganz kleiner Teil gemessen. Es ging z.B. nicht um literarische Bildung, also etwa um die Interpretation von Gedichten. Insofern wurde nur eine bestimmte Version von "Leseverständnis" ermittelt.
Selbst wenn man jedoch solche Einschränkungen in Rechnung stellt, beweist PISA, dass sich unser Bildungswesen im Hinblick auf seine Wirksamkeit in einem schlechten Zustand befindet. Dem soll selbstverständlich abgeholfen werden – da sind sich alle Beteiligten einig.
108
Das wäre verhältnismäßig leicht möglich, wenn man einen Schuldigen dafür eindeutig ausmachen könnte - etwa die Kultusminister, ihre Bürokratie, die Lehrer oder die Eltern oder wen sonst immer. Leider ist die Sache so einfach nicht, obwohl sich alle Interessenten immer wieder geäußert haben und im Wesentlichen propagieren, dass man nun noch mehr von dem verwirklichen müsse, was sie immer schon vorgeschlagen und gewollt haben. Alle fühlen sich bestätigt. Die alten Zauberworte voll von wohlklingender Inhaltslosigkeit geben sich weiterhin ein Stelldichein: Schlüsselqualifikationen, das Lernen lernen, Schulautonomie, eine Schule für alle, Teamgeist, neue Unterrichtskultur, vernetztes Denken, Qualitätssicherung, um nur einige zu nennen.
Ohne Zweifel hat PISA eine bildungspolitische und pädagogische Diskussion in Deutschland losgetreten, wie sie lange nicht mehr stattgefunden hat. Eigentlich hätte man deshalb erwarten dürfen, dass dabei eine Bilanz gezogen worden wäre: Worin liegen die Ursachen, was ist in der letzten Jahrzehnten warum falsch gelaufen, wer hat das zu verantworten? Welche Annahmen und Theorien haben sich bestätigt, welche nicht? Ein derartiger Diskurs hat sich aber nur in Ansätzen ergeben. Die Bildungspolitiker gehen vorsichtig miteinander um, weil sie keine alten Gräben aufreißen und den Blick zum gemeinsamen Handeln nach vorne richten wollen. Das ist vielleicht klug, jedenfalls verständlich, aber die sonstige Öffentlichkeit wäre an eine solche Klugheit nicht gebunden, sondern könnte den Diskurs durchaus in Gang bringen. Weil das nicht hinreichend geschehen, eine kritische Bilanz nicht gezogen ist, droht die Gefahr, dass die nötigen Korrekturen ins Leere gehen.
Fetisch "Modernisierung"
Das gemeinsame Schweigen scheint einen gemeinsamen Nenner zu haben, nämlich "Modernisierung". Zu diesem Schlagwort können sich alle bekennen, selbst diejenigen, die in den letzten Jahrzehnten falsche Entscheidungen getroffen haben, können sich mühelos unter sein Dach begeben. Wer will schon gegen Modernität sein?
109
"Modernisierung" legt die Vorstellung nahe, dass alles, was bisher gegolten hat, überholt, neuen Anforderungen nicht gewachsen sei. Modernisierung erscheint als ein schicksalhafter Prozess, der ohnehin abläuft, gegen den sich nichts ausrichten lässt, in den man sich aber einklinken muss, wenn man den Anschluss nicht verpassen will. Dieser Modernisierungszauber hat auch die Schulen erfasst und sich dort vor allem als Computereuphorie und im schwungvollen Hantieren mit ökonomischen Begriffen niedergeschlagen. Die Schule – wie auch die Hochschule - müsse im Hinblick auf ihre Effizienz regelmäßig evaluiert und zu einer lernenden Organisation werden, sie brauche wie ein florierender Industriebetrieb Wettbewerb sowie ein gut funktionierendes Management, müsse für Qualitätssicherung sorgen, die Lehrer müssten nach Leistung bezahlt und deshalb von den Fesseln des Beamtenstatus befreit werden. Als Motor des Unausweichlichen gelten die Globalisierung der Märkte und der daraus resultierende weltweite Wettbewerb, der den Standort Deutschland überrollen werde, wenn nicht auch das Bildungswesen hier zu Lande diesem Trend angepasst werde.
Diese Argumentation ist auf eine eigentümliche Weise geschichtslos und insofern wenig tauglich zur kritischen Reflexion. Das zeigt sich daran, dass real existierende Verhältnisse und Strukturen nicht in ihrem Entstehungszusammenhang analysiert und hinsichtlich ihrer künftigen Tragfähigkeit überprüft werden, so dass man überzeugende Argumente erhielte, was warum und wie zu verbessern sei. Vielmehr wird die nicht aufgeklärte Wirklichkeit lediglich konfrontiert mit Postulaten, die in diesem Sinne für "modern" gehalten werden. Diese geschichtslose Argumentationsfigur hat zur Folge, dass der Modernisierungszauber daherkommen kann mit der Aura des historisch Unausweichlichen, zu dem es ernsthaft keine Alternative geben könne; es scheint so, als müsse alles Wichtige neu erfunden werden.
Dieser Zeitgeist trifft das Bildungswesen, dessen Aufgabe gerade das kritische Tradieren ist, im Kern seines Selbstverständnisses. Was dort gelehrt und gelernt wird und seinen unmittelbaren Nutzen nicht nachweisen kann, unterliegt dem Verdikt, altmodisch, überflüssig oder zumindest veraltet zu sein. Statt dessen verengen sich
110
die Überlegungen zum Lehren und Lernen auf eine zum Fetisch gewordene Praxisorientierung und damit auf unmittelbare Verwertbarkeiten, obwohl diese morgen schon wieder in Frage stehen können. So wird der Weg frei gemacht für eine schier unerschöpfliche Fülle von Einfällen, Plänen und Vorschlägen, die auf die Bildungseinrichtungen niedergehen, sich an nichts jedoch wirklich abarbeiten müssen. Das so verstandene "Moderne" hat keine Geschichte, kennt folgerichtig auch keine Irrtümer, die aufzuklären wären, und muss sich deshalb auch nicht revidieren; es wird nur irgendwann durch etwas, das noch moderner ist, erneut abgelöst
.
Auf dem Hintergrund dieses Zeitgeistes erscheint jede kritische Aufarbeitung als nutzlose intellektuelle Spielerei, die nur das gemeinsame Handeln gefährdet. Was dabei jedoch unter den Teppich gekehrt wird, sollen die folgenden Hinweise wenigstens andeuten.
Was ist Unterricht?
Entscheidend ist die Qualität des Unterrichts - sagen die Forscher. Wäre das nur ein technisches Problem, ließe es sich verhältnismäßig leicht durch eine entsprechende Fortbildung lösen. Tatsächlich jedoch gehen die Meinungen darüber, was unter Unterricht überhaupt zu verstehen sei, inzwischen so weit auseinander, dass sie kaum noch auf einen Nenner zu bringen sind. Es gibt keinen Konsens mehr über die Ziele und Aufgaben der Schule, was die einen für das Idealbild einer Schule halten, halten die anderen für das erklärte Gegenteil. Über diese tiefe Kluft, die es nicht einmal auf dem Höhepunkt des Kampfes für oder gegen die Gesamtschule gab, täuschen die schönen Zauberworte hinweg. Die Lehrer müssten eben einen besseren Unterricht erteilen, wird nun von allen Seiten gefordert. Was aber soll das heißen? Sie erteilen doch den Unterricht, den man ihnen in der Referendarzeit beigebracht hat: entweder konservativ aufgebaut nach einem formalen Schema, das für kreative und von der Planung abweichende Fragen der Schüler kaum Raum lässt; das vorher geplante Er-
111
gebnis muss am Ende der Stunde auch herauskommen, sonst ist die Lehramtsprüfung gefährdet. Oder aber die sich für fortschrittlich haltenden Ausbilder fordern den so genannten "offenen Unterricht", mit viel action und Handlungsorientierung, wenig gedanklicher Systematik, aber großer Beliebigkeit der Stoffe. Im ersten Falle tötet der Schematismus die Eigeninitiative der Schüler, im anderen Falle lässt allzu große Beliebigkeit keine zusammenhängenden Vorstellungen über die Sachverhalte entstehen. Über das, was in den Ausbildungsseminaren, also in der zweiten Phase der Lehrerausbildung, geschieht, wissen wir kaum etwas, niemand scheint sich dafür zu interessieren, obwohl hier, nicht in der so unermüdlich kritisierten Hochschulausbildung, die entscheidenden Weichen gestellt werden.
"Guter Unterricht ist, wenn nicht mehr unterrichtet wird" - so lautet eine oft zu hörende und zu lesende Parole, die den Anspruch der Modernität zu erfüllen verspricht. Darin artikuliert sich eine Gegenposition zur klassischen Vorstellung vom Unterricht. Die geht nämlich vom Lehrer, von den Sachverhalten und vom Lehrplan aus. Der Lehrer hat das Pensum der Grundbildung bereits hinter sich, das die Schüler noch vor sich haben; er hat die Sachverhalte studiert, er kann Wichtiges von weniger Wichtigem unterscheiden und deshalb den Stoff ordnen, er kennt die Methoden des Lernens. Die führende Rolle des Lehrers bleibt auch dort erhalten, wo sie wie bei bestimmten didaktisch-methodischen Arrangements zu verschwinden scheint. Folgerichtig geht traditioneller Unterricht primär von den Sachverhalten aus, erst sekundär auch von den so genannten Bedürfnissen der Schüler. Der Unterricht soll zwar vorhandene Interessen und Motivationen aufgreifen, aber mehr noch neue entstehen lassen. Das schließt durchaus ein, die Didaktik und Methodik zu verbessern, den Umgangsstil zu entkrampfen, aber nicht, die Sachverhalte, um die es gehen muss, einer mehr oder weniger interessierten Schülernachfrage anzupassen oder von einem begrenzten Leistungswillen der Schüler diktieren zu lassen.
Unter dem Eindruck von PISA fordern alle Kultusminister nun einen anspruchsvollen Unterricht schon in der Grundschule, aber sobald sie daran gehen, dafür ein verbindliches Kerncurriculum – altmodisch Lehrplan genannt – zu formulieren, pro-
112
vozieren sie damit erbitterte Debatten. Dabei gehört auch der Lehrplan – ob nun vom Staat verordnet oder vom Lehrer entworfen – ebenfalls zu den klassischen Prinzipien des Unterrichts: Ohne Lehrplan kann es keine aufeinander aufbauenden Lehrgänge geben, schrumpft alles zum Gelegenheitsunterricht – heute dies, morgen das.
Nun kann man natürlich politisch etwas anderes als diesen klassischen Unterricht in den Schulen wollen - es gibt ja außerhalb der Schule viele vernünftige pädagogische Angebote, die mit Schulunterricht nichts zu tun haben – aber dann muss man das auch sagen, damit die Öffentlichkeit sich ein zutreffendes Bild machen kann. Der Öffentlichkeit wird jedoch vorgegaukelt, zur Wahl stünden "altmodischer" oder "moderner" Unterricht.
Die Abneigung gegen jede Art von gedanklich geordnetem und systematischem Unterricht – zusammengefasst unter dem Slogan der "Neuen Lernkultur" – rechtfertigt sich nun mit Hinweis auf PISA: Im klassischen lehrergeleiteten Unterricht lernten unsere Schüler etwas Falsches, nämlich nur "theoretisches" Wissen, weshalb sie bei dessen Anwendung, wie in der PISA-Studie gefordert, scheitern müssten. Aber in der "neuen Lernkultur" erwerben sie gar kein geordnetes Wissen mehr, deshalb können sie angesichts eines besonderen Problems auch nichts davon anwenden. Die Anwendung auf einen besonderen Fall setzt immer ein geistiges Repertoire voraus, das jenseits davon und unabhängig von ihm zur Verfügung steht. Anwenden lernt man nicht nur durch Anwenden – obwohl man es ständig üben muss. Voraussetzung dafür ist vielmehr, dass vorher etwas systematisch begriffen worden ist. Eben dies ist die Aufgabe eines vom Lehrer entsprechend geleiteten Unterrichts, darauf können die Schüler nicht von sich aus kommen - mit einem Lehrer im Hintergrund, der weitgehend lediglich als "Moderator" fungiert.
Auch aktuelle Vorschläge zum Kerncurriculum bewegen sich auf dieser Ebene. Sie konzentrieren sich vornehm auf "Kompetenzen", nicht auf Stoffpläne, und den Schulen soll überlassen bleiben, wie sie diese Ziele erreichen, aber niemand weiß, wie das durch unterrichtliche Operationalisierungen zuverlässig zu realisieren ist - erneut verdeckt ein Zauberwort die sachlichen Schwierigkeiten und Widersprüche. Nachge-
113
rade fragt man sich verdutzt, wie eigentlich frühere Generationen - z.B. die, die die Bundesrepublik aufgebaut haben - ohne das Eintrimmen solcher "Kompetenzen" eine nützliche Schulbildung erlangen konnten.
Pädagogische Gesinnungsorientierung
Über die Gründe, warum die deutschen Schüler so schlecht abgeschnitten haben, wird viel spekuliert. Dabei wird leicht ein Aspekt übersehen, der uns von anderen von PISA untersuchten Ländern unterscheidet: In Deutschland sind über Jahrzehnte hinweg bildungspolitische und schulpädagogische Fragen zu Gesinnungsfragen gemacht worden, deren gegensätzliche Positionen sich institutionell in Lehrerverbänden und Administrationen verfestigt haben. Das hängt zusammen mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und der Art und Weise ihrer primär moralischen Aufarbeitung seit Mitte der sechziger Jahre. Andere Länder haben sich dagegen von pragmatischen und wirtschaftlichen Kriterien leiten lassen und sich unvoreingenommen die voraussichtlichen Effekte verschiedener Planungsvarianten angesehen; deshalb konnten sie unbefangen Wirkungsanalysen und Evaluationen durchspielen, was bei uns weitgehend verfemt war.
Die weltanschauliche Besetzung pädagogischer Fragen hat auch dazu beigetragen, dass das öffentliche Ansehen von Schule und Lehrerschaft im Unterschied zu den erfolgreichen Ländern bei uns auf einem Tiefpunkt angelangt ist. Wenn nämlich die öffentliche Meinung nicht weitgehend geschlossen hinter den Schulen und ihren Lehrern steht und sie als für das Gemeinwesen bedeutsame Einrichtungen und Personen anerkennt, wird den Schülern eine wichtige Motivation genommen, die Ansprüche dieser Institution ernstzunehmen. Hier zu Lande gibt es statt dessen ein inzwischen selbstverständliches Bündnis der Eltern mit ihren Kindern gegen die Lehrer - was in diesem Ausmaß nur auf dem Boden einer diese Haltung unterstützenden öffentlichen Meinung möglich ist.
114
Diese weltanschauliche Prägung hat viele Facetten. Dazu gehört etwa ein antistaatlicher Affekt, der aus der moralisierenden Verarbeitung des Nationalsozialismus entstanden ist und sich gerade im Bildungswesen bis in manche Administration hinein fest verankert hat. Demnach hat der Staat keine Ansprüche zu erheben, sondern die Mittel für das Wohlbefinden seiner Bürger bereit zu stellen. Eine Schule, die Leistungsanforderungen an die Schüler geltend macht, gilt somit als eine Zumutung an deren Persönlichkeit. Nur was der Schüler selbst lernen will, darf auch von ihm gefordert werden – und ohne "Spaß" läuft schon gar nichts. Die Schule habe sich nach den Bedürfnissen des Kindes zu richten, nicht umgekehrt. Folgerichtig hat sich der pädagogische Blick immer mehr auf die subjektive Befindlichkeit des Kindes, auf sein Ich gerichtet und dabei die wünschenswerte Bildung des Subjekts in Subjektivismus verkehrt. Vergessen wurde dabei der politische Charakter der Schule als einer Einrichtung der Gesellschaft bzw. des Staates, die - wenn auch pädagogisch modifiziert - Forderungen an die nachwachsende Generation zu stellen hat. Auf einen wesentlichen Grund dafür weist die PISA-Studie hin: Unsere Gesellschaft kann sich kein soziales Dynamit leisten, das aus massenhafter schlechter Schulbildung resultiert. In Gestalt der Schule bietet die Gesellschaft der nachwachsenden Generation einerseits eine Ausbildung für die optimale Partizipation an ihren Handlungsmöglichkeiten an, andererseits braucht sie diese Fähigkeiten zu ihrer eigenen Reproduktion und Weiterentwicklung. Beide Seiten können nur zusammen gesehen werden, den enormen Investitionen für das Bildungswesen muss eine angemessene Bereitschaft zur Leistung und Anstrengung seitens der Schüler – und ihrer Eltern! - entsprechen. Leistungsfeindlichkeit ist demnach in dreifacher Hinsicht ein Ärgernis: Sie dient nicht der persönlichen Entwicklung, ignoriert die Vorleistungen der staatlichen Gemeinschaft und ist ökonomisch gesehen parasitär.
In diesen Zusammenhang gehört auch das Konzept der "Individualisierung des Lernens". Darin drückt sich in erster Linie die Abneigung gegen eine für alle Schüler einer Klasse gemeinsam geltende Leistungserwartung, also gegen den üblichen, vom Lehrer ausgehenden Unterricht aus – "Frontalunterricht" gilt inzwischen als der Gip-
115
fel schulpädagogischer Ignoranz. Nun muss in der Tat der Unterricht auch die notwendigen Individualisierungsprozesse von Schülern fördern und ermutigen. Die werden allerdings nicht dadurch behindert, dass alle zur gleichen Zeit denselben Stoff bewältigen und am selben Problem arbeiten müssen, wie das im normalen Unterricht geschieht. Individualisierung ist nicht ein im Inneren der Person ruhendes Programm, sondern Ergebnis von Anstrengung, Mühe und Auseinandersetzung mit Ansprüchen, die der Person von außen, etwa aus dem gesellschaftlichen Leben oder auch von den Schulstoffen her aufgenötigt werden. "Individuell" ist in diesem Zusammenhang gewiss das Lerntempo - weshalb in Einzelfällen eine besondere Förderung nötig werden kann.
Individuell ist jedoch vor allem die Art und Weise der subjektiven Aneignung, damit das Gelernte in der Vorstellungswelt des einzelnen eine Bedeutung erhält. Das war früher gemeint, wenn man vom "Bildungswert" eines Faches oder eines Stoffes sprach. Von sich aus ist alles, was man lernt, sinnlos, bloße Information; damit daraus Wissen werden kann, muss der Schüler ihm Sinn geben, indem er es in seine bisherigen Erfahrungen und Vorstellungen einbaut und ihm somit eine Bedeutung gibt. Dabei kann der Lehrer helfen, aber nicht stellvertretend für den Schüler denken.
Nun propagiert aber der Zeitgeist von der Politik über die Wirtschaft bis hin zu den pädagogischen und wissenschaftlichen Einrichtungen ein instrumentelles Verhältnis zum Wissen und zum Lernen. Folgerichtig berührt es also die Person nicht weiter, wird von ihr fern gehalten im Sinne des "cool-bleiben", bleibt ihr insofern äußerlich und kann deshalb auch nicht mit Sinn ausgestattet werden. In dieser Form bleibt Wissen, wenn es denn überhaupt behalten wird, wie eine Häufung bloß auswendig gelernter Informationen unverbunden nebeneinander stehen und ist deshalb nur schwer auf neue Probleme anwendbar. Gegen diese Grundeinstellung ist mit Motivationskünsten und methodischem Einfallsreichtum durch den Lehrer kaum anzukommen. Die von der Schule bis zur Universität und zur Lehrerbildung nicht abreißende Forderung nach mehr "Praxisorientierung" des Wissens ist überhaupt nur auf diesem Hintergrund verständlich. Sie beruht im Wesentlichen auf der inneren Unfä-
116
higkeit zum Studieren und damit zur geistigen Auseinandersetzung. Genau daran - nicht am Intelligenzquotienten - unterscheiden sich die leistungsfähigen Schüler und Studenten von den weniger erfolgreichen.
Individualisierung von Lernprozessen scheitert heute also zunehmend daran, dass die Bearbeitung des Ich durch die Herausforderungen der Außenwelt – repräsentiert in den Schulstoffen – weitgehend verweigert wird - nicht daran, dass wir nicht jeden lernen lassen, was er will und wann er es will. Ob diese tief sitzende und weit verbreitete, wie selbstverständlich verinnerlichte Bildungsfeindlichkeit durch eine andere Unterrichtskultur kurzfristig korrigiert werden kann, ist mehr als zweifelhaft. Die so genannte "Neue Lernkultur" hat sie jedenfalls nicht abgeschafft, sondern durch die Duldung von Beliebigkeit eher verstärkt.
Es ist schon jetzt abzusehen, dass unter dem vor Kritik schützenden Dach der "Modernität" die gegensätzlichen Gesinnungspositionen weiter ihre durch die Wirklichkeit nicht gedeckten Zauberworte und "Hochglanzbroschüren" (Th. Ziehe) propagieren, in ihrem Sinne auf die öffentliche Meinung Einfluss nehmen und dafür sorgen werden, dass sich so schnell nichts Wesentliches ändert.
Wer soll eine Reform tragen?
Zu den nach PISA allseits als "modern" propagierten Forderungen gehören u.a.: bessere Förderung der Leistungsschwachen, vermehrte Fortbildung, wirksamere didaktische Ausbildung der Lehrer, größere Aufmerksamkeit für die Grundschule. Aber was soll daran neu sein?
Haben wir nicht in den letzten Jahrzehnten nahezu das ganze Schulsystem darauf ausgerichtet, die leistungsschwächeren Schüler mit Hilfe von Gesamtschulen, Orientierungsstufen, Förderstufen, verlängerter Grundschulzeit, Leistungskursen und den Methoden des individualisierenden Unterrichts zu fördern? Warum ist das offensichtlich nicht nur erfolglos geblieben, sondern hat die Differenz zwischen leistungsfähi-
117
gen und weniger leistungsfähigen Schülern nur noch vergrößert? Vielleicht lag es daran, dass gar nicht klar war, was "Fördern" eigentlich heißen soll, weil man z.B. zu sehr auf die Innerlichkeit des Schülers setzte anstatt auf klare Anforderungen, auf die hin das Fördern erfolgen soll. Die einzig halbwegs erfolgreiche Förderung scheint der professionell betriebene Nachhilfeunterricht zu sein. Jedenfalls kann es doch wohl nicht zu besseren Resultaten führen, wenn man nur mehr von dem anbietet, was bisher erfolglos war, ohne den Gründen dafür nachzuspüren.
Für die Fortbildung der Lehrer wurde noch nie zuvor so viel Geld ausgegeben, eigene, fast monopolartige Institute mit teurem Personal haben die Kultusminister sich dafür zugelegt - was wurde den Lehrern dort eigentlich über all die Jahre beigebracht? Es gibt Berichte über anrührende Kommunikationsspiele und andere Infantilisierungen sowie über psychische Selbstschutzmaßnahmen gegen renitente Schüler. Wenn man nicht einsieht, dass vielfach gerade die Einrichtungen der Fortbildung als pädagogische Ideologieschmieden mitverantwortlich sind für die nun unübersehbare Misere, wird auch vermehrte Fortbildung keine Besserung erwarten lassen.
Didaktik als wissenschaftliche Disziplin gibt es seit mehr als 40 Jahren an den Hochschulen - warum hat sie den Ruin des schulischen Unterrichts nicht verhindert oder wenigstens öffentlich wirksam rechtzeitig kritisiert? Auch sie ist offensichtlich nicht die Lösung, sondern ein Teil des Problems. So wie es aussieht, ist das Konzept einer Didaktik als eigenständiger wissenschaftlicher Disziplin bisher nicht eingelöst worden. Was bleibt dann übrig außer pädagogischen Weltanschauungslehren - wie gehabt? Zwischen den an den Hochschulen fabrizierten didaktischen Theorien und dem, was in den Schulen praktiziert wird, scheint es kaum noch eine Vermittlung zu geben - was nicht verwundert, wenn man die komplexe und komplizierte und stets auf Vollständigkeit bedachte einschlägige Hochschulliteratur zur Kenntnis nimmt. Jedenfalls wäre die Vermutung abwegig, der Unterricht würde automatisch besser, wenn die Lehrer an den Hochschulen didaktisch besser ausgebildet würden.
Die didaktischen Überlegungen haben zudem in den letzten Jahrzehnten weniger auf die Lehrbarkeit von Wissen gesetzt – also auf Kanon, Lehrplan und Lehrgang -
118
sondern auf Lerntheorie. Die Hoffnung, man könne auf diese Weise allgemeine, möglichst sogar fachunspezifische Regeln oder gar Gesetze des Lernens und damit eben auch entsprechende Strategien des Lehrerhandelns finden, wurden jedoch bisher enttäuscht. Je genauer die Lernforschung wird, um so mehr muss sie vor der Komplexität des Problems kapitulieren und um so weniger gibt sie infolgedessen für die Handlungsorientierung der Lehrer her. Die praktisch relevanten Ergebnisse gehen kaum über das hinaus, was ein Lehrer nach einiger Berufserfahrung ohnehin weiß.
Auch darüber, dass die Bildungsbemühungen im Vorschulbereich und in der Grundschule verstärkt werden müssen, scheint Einigkeit zu herrschen. Aber die infantilisierende Unterforderung von Grundschulkindern ist schon Ende der sechziger Jahre entdeckt und heftig diskutiert worden, und der Bildungsrat hat seinerzeit ein ausführliches, wissenschaftlich fundiertes Reformkonzept vorgeschlagen - warum ist das so schnell versandet? Gewiss gab es damals einige unrealistische szientistische Übertreibungen, aber der wahre Grund war: Weder die Schulbehörden noch die Lehrer oder die Eltern wollten eine solche Grundschule – warum sollten sie sie jetzt wirklich wollen? Um Grundschulkindern z.B. grundlegende naturwissenschaftliche Einsichten zu vermitteln, wie jetzt wieder erwartet wird, müssen die Lehrer neben der didaktischen über eine relativ hohe fachwissenschaftliche Kompetenz verfügen, sonst können sie die notwendigen didaktischen Reduktionen nicht vornehmen und flexibel anwenden; dafür werden sie aber nicht ausgebildet. Jeder didaktischen Analyse muss erst einmal die Sachanalyse vorausgehen - aber wie viele Lehrer können das noch?
Schon damals lag auf der Hand, dass Kinder in diesem Alter besonders empfänglich fürs Lernen und deshalb früh an Leistung heranzuführen sind, was besonders wichtig für diejenigen aus bildungsfernen Schichten ist. Wenn Kinder in der Grundschule systematisch unterfordert werden, schadet das den ohnehin benachteiligten, während Schüler aus dem bildungsnahen Milieu das mit Hilfe des "kulturellen Kapitals" ihrer Familie weitaus besser kompensieren können. Ideologiekritisch gewendet ergibt sich daraus eine merkwürdige Pointe: Wenn wir das alte Bildungsprivileg hät-
119
ten erhalten wollen - was uns ja gelungen ist, wie PISA zeigt - dann hätten wir die Grundschule genauso planen müssen, wie wir sie jetzt haben - einschließlich ihrer personellen und materiellen Unterversorgung. Es ist die Tragik der sozialdemokratischen, auf Chancengleichheit gerichteten Bildungspolitik, dass sie von pädagogischen Illusionisten aus ihren eigenen Reihen torpediert wurde, denen es gelungen ist, über Jahrzehnte einen mehr als problematischen pädagogischen Zeitgeist zum ideellen Leitmotiv der öffentlichen Meinung zu machen. Die Politik kann zwar "Chancengleichheit" als Ziel formulieren, es jedoch nicht selbst in den Schulen realisieren; für die Umsetzung braucht sie pädagogische Fachkompetenz - und das ist ihr zum Verhängnis geworden.
Gerade die Grundschule ist - von der Öffentlichkeit kaum bemerkt, weil sie ihr ohnehin nicht interessant genug erschien - zum Versuchslabor für alle möglichen, meist unausgereiften pädagogischen Ideen geworden; immerhin stellt sie die einzig flächendeckende und konkurrenzlose Gesamtschule dar. Alles soll dort "spielerisch" sein, systematischer Unterricht gilt ebenso als kinderfeindlich wie das Erteilen von Zensuren – vom Sitzenbleiben ganz zu schweigen. Alles zusammen deutet darauf hin, dass Anstrengung und Leistung in der Grundschulkultur keine zentralen Werte darstellen. Klassische Lerntechniken wie Einmaleins, Auswendiglernen von Gedichten, Vorlesen von Texten und vor allem ständiges Üben des Gelernten sind weitgehend verloren gegangen. Hausaufgaben könnten die familiär benachteiligten Schüler diskriminieren. Wie soll eine solche seit Jahren gefestigte und unangefochtene pädagogische Grundeinstellung kurzfristig geändert werden - mit demselben Personal, denselben Ausbildern und Fortbildnern?
Zudem erfolgt der Schuleintritt für immer mehr Kinder zu spät. Nach dem Gesetz sind Kinder einzuschulen, wenn sie mindestens sechs Jahre alt sind; Rückstellungen müssen begründet werden, wurden aber in den vergangenen Jahren immer öfter zur Regel, so daß das durchschnittliche Einschulungsalter auf fast sieben Jahre angestiegen ist. Das schlägt sich auch in der PISA-Studie nieder, insofern in Deutschland die 15-jährigen Schüler auf die Klassen sieben bis zehn in einem Maße verteilt sind wie
120
in keinem anderen untersuchten Land. Unter Eltern in der Mittelschicht ist es üblich geworden, den möglichst späten Schuleintritt ihrer Kinder untereinander als besondere Fürsorge auszugeben, und wenn die Kinder endlich in der Schule sind, werden die Lehrer genervt, sobald die Sprösslinge mit Unlustgefühlen nach Hause kommen.
Krokodilstränen für die Benachteiligten
Vielleicht am meisten überrascht hat gerade reformpädagogisch orientierten Kreise, dass die Leistungsschere zwischen den Kindern aus unterschiedlichen soziokulturellen Milieus trotz aller gegenteiligen Bemühungen nicht kleiner, sondern größer geworden ist und somit das Wunschziel zunehmender Chancengleichheit weit verfehlt wurde. Dieses Resultat wird im Allgemeinen der Dreigliedrigkeit des Schulwesens und der frühen Selektion angerechnet. Abgesehen davon, dass die Gesamtschulen hier auch nicht erfolgreicher waren, wird durchweg übersehen, dass nahezu alles, was die moderne Schulpädagogik für fortschrittlich hält, die Kinder aus bildungsfernem Milieu benachteiligt. Sozial selektiert wird bereits mit dem ersten Schultag. "Offener Unterricht", überhaupt die Demontage des klassischen, lehrerbezogenen Unterrichts, die Wende vom Lehren zum Lernen und damit die übertriebene Subjektorientierung, die Verunklarung der Leistungsansprüche, Großzügigkeit bei der Beurteilung von Rechtschreibschwächen bis hin zur Adaption von medizinischen Erklärungen wie Legasthenie hindern die Kinder mit von Hause aus geringem kulturellen Kapital daran, ihre Mängel auszugleichen, während sie den anderen kaum schaden. Der pädagogische Zeitgeist hat das Bildungsprivileg der Mittelklasse nach unten hin verteidigt; er ebnete dabei ihrem weniger leistungsfähigen Nachwuchs den Weg zum Abitur und zum Hochschulstudium, vergrößerte auf diese Weise jedoch den Rückstand der anderen. Es ist ähnlich wie in der Sozialpolitik: Wenn die benachteiligten sozialen Schichten schon etwas bekommen sollen, wie das Kindergeld, dann sollen es alle
121
anderen auch haben. Unter den Bedingungen der Ungleichheit ist Gleichbehandlung aber immer Ungleichbehandlung.
Schule ist unvermeidlich eine Mittelklasseinstitution. Sie begünstigt deshalb notwendigerweise diejenigen Kinder, die aus diesem Milieu kommen. Nicht nur sind sie mit einem besseren sozialen und kulturellen Startkapital ausgestattet, ihre Schulerfahrungen und Schulerfolge werden auch zu Hause selbstverständlicher sozial akzeptiert und unterstützt. "Subjektorientierung" etwa, wie sie durch die psychologisch fundierte Reformpädagogik propagiert wird, ist ein Projekt der Mittelschicht, in den unteren Schichten gilt sie von Hause aus wenig. "Lebensweltorientierung" des Unterrichts meint das eigene bürgerliche, nicht das depravierte Ambiente - davon versteht die Schule außer der Vermutung von materieller oder kommunikativer Armut nichts. In diesem Milieu ist man auch nicht "intrinsisch" motiviert - das kann man sich gar nicht leisten.
Kinder aus bildungsbenachteiligten Familien müssen sich also mit Hilfe der Schule von ihrem Familienhintergrund teilweise emanzipieren oder zumindest eine innere Gegenwelt dazu aufbauen, wenn sie das schulische Lernangebot optimal nutzen wollen; das behindert die Gleichheit ihrer Chancen enorm. Das einzige Kapital, das diese Kinder von sich aus vermehren können, sind ihr Wissen und ihre Manieren; dafür brauchen sie eine Schule, in der der Lehrer nicht nur "Moderator" für "selbstbestimmte Lernprozesse" ist, sondern die Führung übernimmt und die entsprechenden Orientierungen vorgibt. Gerade das sozial benachteiligte Kind bedarf, um sich aus diesem Status zu befreien, eines geradezu altmodischen, direkt angeleiteten, aber auch geduldigen und ermutigenden Unterrichts. Die Schulreformpädagogik der letzten Jahrzehnte hat entgegen ihren Beteuerungen für diese Kinder gar nichts bewirkt, wie sich jetzt herausgestellt hat. Das gilt erst recht für solche Kinder, die der deutschen Sprache kaum mächtig sind; vielfach werden sie jedoch einfach in die Grundschulen gesteckt, weil es so für die Administration am bequemsten und vor allem am billigsten ist, während andere, erfolgreichere Länder wie Schweden niemanden in die Schule lassen, der nicht hinreichend die Landessprache beherrscht. Die Hoffnung,
122
man könne solche tief fundierten Benachteiligungen mit ein paar zusätzlichen Förderstunden in den Griff kriegen, ist schiere Sozialromantik. Erfolgreicher könnten schon Ganztagsschulen sein, aber nur dann, wenn sie möglichst früh, nachhaltig und relativ dauerhaft ein Gegenmilieu bilden würden. Solche und andere nützliche Angebote speziell für entsprechende Regionen bzw. Stadtteile einzurichten, verteufeln die Sozialromantiker jedoch als Diskriminierung. Die objektiv Benachteiligten sollen sich nicht als solche fühlen - ein klassischer ideologischer Trick, von dem die Betroffenen nichts haben. Der entscheidende pädagogische Denkfehler, der schon in der Weimarer Zeit bei der pädagogischen Begründung der gemeinsamen Grundschule zu Tage trat, liegt in der Definition des Kindes "als solchem". Da damals nämlich auch Kinder des Bürgertums die Grundschule besuchen sollten, brauchte man eine pädagogische Idee, die als über den sozialen Klassen stehend angesehen werden konnte; dafür bot sich die reformpädagogische Vorstellung einer gelungenen Gestaltung der Kindlichkeit des Kindes an. So wurde die Grundschule zu einer Kinderschule, die der erzieherisch-pflegerischen Förderung aller kindlichen Kräfte den Vorrang einräumte gegenüber einer für einseitig und kinderfeindlich gehaltenen kognitiven Bildung. Dabei ist es im Wesentlichen bis heute geblieben. Sozial gesehen gibt es jedoch nur Kinder, die in Blankenese oder in Kreuzberg, in Reichtum oder Armut, mit gebildeten oder weniger gebildeten Eltern aufwachsen - um nur gröbste Kategorien zu nennen.
Was ist zu tun?
Die Kultusminister haben lange gezögert, sich an international vergleichenden Untersuchungen überhaupt zu beteiligen und mussten von den Forschern mühsam dazu überredet werden. Nun wollen sie den Blick nach vorne richten, nicht in die Vergangenheit. Aber vorne wird sich nichts zeigen, was der Mühe wert ist, wenn nicht eine Bilanz gezogen wird, die die Entwicklung der letzten Jahrzehnte kritisch in
123
den Blick nimmt. Dabei gehören alle gegenwärtig gehandelten pädagogischen Konzepte auf den Prüfstand, gerade auch diejenigen, die als besonders fortschrittlich – nämlich als "modern" - gelten. Es gibt keine Patentrezepte und auch keine schnellen Lösungen, weil sich – das sollte unsere Problemskizze zeigen – kaum ein vom pädagogischen Zeitgeist unbeschädigter Ansatzpunkt dafür finden lässt. Übrig bleibt einstweilen nur, den gegenwärtigen Zustand weiterhin möglichst präzise zu erforschen, ihn ungeschönt zu beschreiben, Fehlentwicklungen zu erkennen, sie behutsam zu korrigieren, den wohlklingenden Zauberworten zu misstrauen und nicht wie bisher den Novitäten aus den Wissenschaften, der Wirtschaft oder der Organisationslehre auf den Leim zu gehen, nur weil sie sich gerade marktschreierisch in Szene setzen.
Im Mittelpunkt der Überlegungen sollte eine einfache Leitfrage stehen: Was von alledem, was den Schulen und ihren Lehrern heute und künftig zugemutet werden soll, nützt wirklich den Schülern im Hinblick auf ihre gegenwärtige und vor allem zukünftige gesellschaftliche Teilhabe? Wenn man daraufhin einmal alles sortiert, was in den letzten Jahrzehnten an angeblichem pädagogischem Fortschritt über die Schulen hereingebrochen ist, macht man die erstaunliche Entdeckung, dass die Bedürfnisse der Schüler wenn überhaupt, dann nur eine instrumentelle und legitimierende Funktion gehabt haben. Am Beispiel der von Hause aus benachteiligten Kinder lässt sich das besonders eindrucksvoll zeigen.
Helfen bei einer Neubesinnung werden auch Untersuchungen wie PISA nur dann, wenn ihr praktischer Nutzen richtig eingeschätzt wird. Unterrichten als soziales Handeln ist niemals nur die Anwendung von irgendetwas - auch nicht von noch so bedeutsamen empirischen Forschungsergebnissen - sondern stets ein Schritt ins Ungewisse mit ungewissem Ausgang. Wissenschaftliche Forschungen können dieses Handeln grundsätzlich nicht konstituieren, sondern nur mit vorbereiten und aufklären. Deshalb sind Untersuchungen wie TIMSS und PISA für den Handlungshorizont der Lehrer nur von begrenzter Bedeutung - im Unterschied zu ihrer bildungspolitischen Relevanz. Das gilt übrigens für andere empirische Forschungen wie die Lern-
124
forschung auch; sie überschwemmen inzwischen die Schulen mit immer wieder neuen Fachterminologien, deren Nutzen jedoch relativ begrenzt bleibt, weil die Ergebnisse immer erst in den Standpunkt des Handelns übersetzt werden müssen. Geschieht das nicht, brechen neue Forschungsergebnisse nur wie einander ablösende Moden in das Schulgeschehen ein, ohne es wirklich verbessern zu können. Die grundlegende Handlungsstruktur des Unterrichtens ist der wissenschaftlichen Aufklärung vorgegeben und nicht aus ihr deduzierbar. Wird das übersehen, droht die Gefahr, dass Bildungsforschungen in der Art von PISA zum Maßstab nicht nur für bildungspolitische, sondern auch für didaktische Entscheidungen werden. Deshalb muss man fragen, was sie eigentlich messen und was nicht, und inwieweit das Gemessene mit den pädagogischen Zielen identisch ist oder sein soll - zumal ähnliche Verfahren ja auch für die Evaluation vorgesehen sind.
125

URL dieser
Seite: www.hermann-giesecke.de/werke27.htm
