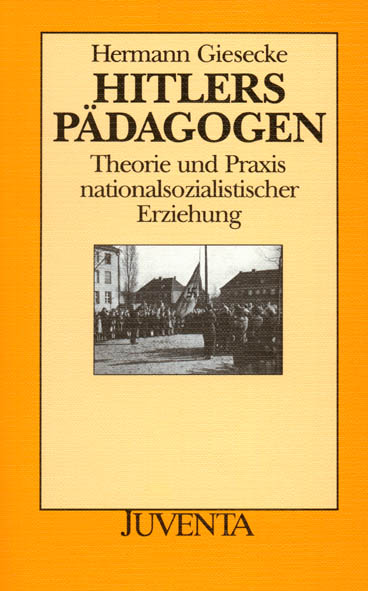 Hermann
Giesecke
Hermann
Giesecke Hitlers Pädagogen
Theorie
und Praxis nationalsozialistischer Erziehung
2.
Überarb. Aufl. Weinheim: Juventa-Verlag 1999
Teil
II: Pädagogische Felder

Zu dieser Edition:
Der Text darf zum persönlichen Gebrauch kopiert und unter Angabe der Quelle im Rahmen wissenschaftlicher und publizistischer Arbeiten wie seine gedruckte Fassung verwendet werden. Die Rechte verbleiben beim Autor.
© Hermann Giesecke

Teil 2: Pädagogische Felder
Die
Entwicklung des Schulwesens
Die
Entwicklung
der Lehrerbildung
Ausschaltung
und
Gleichschaltung
Kritisches
Resümee
5. Der volksgemeinschaftliche Jugendstaat: Die Hitler-Jugend
Baldur von
Schirach
Das
politisch-pädagogische
Konzept
"Einheit
der Erziehung"
Emanzipation
durch
den BDM?
Stichworte
einer
"Gebrauchspädagogik"
Kritisches
zur
HJ-Pädagogik
Die
HJ
im Kontext der
Jugendgeschichte
Teil 2: Pädagogische Felder
4. Zwischen Ideologie und Sachzwang: Das Schulwesen
ßerschulische Jugendarbeit -, zunächst einmal im Rahmen ihrer eigenen Entwicklung untersucht werden.
Als die
Nationalsozialisten
1933 an die Macht kamen, fanden sie beide pädagogische Felder in
einer
bestimmten Verfassung vor. Was haben sie warum daraus gemacht?
Zunächst
soll von der Schule die Rede sein.
Die Entwicklung des Schulwesens
Im Jahre 1933 war die bildungspolitische Zuständigkeit aufgeteilt auf die Länder und auf das Reich - hier im Innenministerium verankert. Erst am 1.5.1934 wurde das "Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung" (REM) eingerichtet, das Bernhard Rust übernahm, ein ehemaliger Studienrat, der zu dieser Zeit preußischer Kultusminister war und dieses Amt auch beibehielt, also als Doppelminister fungierte. Durch das "Gesetz zur Neuordnung des Reiches" (30.1.34) wurden die bisherigen Rechte der Länder weitgehend ausgeschaltet; sie konnten nur noch insoweit tätig werden, als das Reich keine Verfügungen erließ.
Rust vereinheitlichte 1937 das höhere Schulwesen, was schon in der Weimarer Zeit angestrebt worden war. Es gab eine Vielzahl gymnasialer Oberstufenformen, die nun auf drei reduziert wurden: das humanistische Gymnasium, das allerdings nur dort erhalten bleiben sollte, wo die Schule über eine besondere Tradition verfügte, und die naturwissenschaftliche sowie die neusprachliche Oberschule. Für die Mädchen blieb übrig ein neusprachlicher und ein hauswirtschaftlicher Oberschulzweig. Vor allem in ländlichen Gebieten gab es Aufbauschulen in Oberschulform - für Mädchen nur in hauswirtschaftlicher Form. Diese Neuregelung sorgte geraume Zeit für Verwirrung, weil Übergangsregelungen nötig waren.
Die bis dahin in Preußen eingerichteten grundständigen, also mit dem fünften Schuljahr beginnenden sechsklassigen Mittelschulen führte Rust für das ganze Reich ein. Als diese Schulform sich einigermaßen konsolidiert hatte, mußte auf "Führerbefehl" von 1940 nach österreichischem Vorbild
126
1941 die Hauptschule als Pflichtschule eingeführt werden, der begabtere Volksschüler zugewiesen werden sollten. Hitler wünschte die Einführung dieses neuen Schultyps zunächst nur für die dem Reich angegliederten neuen Reichsgaue, aber Bormann drängte auf sofortige Einführung im ganzen Reich. Diese Schule sollte eine Bildungsgrundlage vermitteln, "auf der die Ausbildung für alle mittleren und gehobenen praktischen Berufe in Landwirtschaft, Handel, Handwerk, Technik, Industrie und Verwaltung sowie alle hauswirtschaftlichen, pflegerischen, sozialen und technischkünstlerischen Frauenberufe aufbauen kann". (Ottweiler 1980, 202). Dazu waren aber nun Fachlehrer nötig, die im Kriege so schnell und so zahlreich nicht zu beschaffen waren, so daß der Ausbau dieses neuen Schultyps bald stagnierte. Im Grunde handelte es sich hier um eine Aufteilung der Volksschule: die begabteren Schüler - man rechnete mit einem Drittel - sollten von den Leitern der Volksschulen für die Hauptschule ausgesucht werden. Offenbar war damals das Begabungsprofil der Volksschüler sehr differenziert, wenn man etwa bedenkt, daß 40 Prozent von ihnen den Volksschulabschluß nicht erreichten. Die Parteikanzlei hielt die Einführung der Hauptschule für das Kernstück der NS-Bildungsreform, weil sie eine Mobilisierung von Begabungsreserven ermögliche - eine Hoffnung, die angesichts des Mangels an Facharbeitern verständlich war.
In der Praxis führte die Einführung dieses Schultyps vor allem in den südlichen Reichsländern, die gerade auf Anweisung Rusts die Mittelschule einigermaßen flächendeckend eingeführt hatten, zur Verwirrung, zumal das Verhältnis zwischen diesen beiden Schultypen ungeklärt blieb. Beide bauten auf der vierjährigen Grundschule auf, aber die Hauptschule sollte nur vier Klassen umfassen, die Mittelschule war dagegen auf sechs Klassen angelegt.
Im Zuge dieser Vereinheitlichung des Schulsystems wurde auch das Privatschulwesen erheblich zurückgedrängt zugunsten der "Deutschen Heimschulen", die auf Anordnung Hitlers insbesondere für Kinder von Offizieren und anderer Berufe eingerichtet wurden, die mit häufiger Versetzung zu rechnen hatten. Die Privatschulen befanden sich überwiegend in kirchlicher Trägerschaft und stellten insofern eine ideologische Konkurrenz zum staatlichen Schulwesen dar.
127
Neue, reichseinheitliche Richtlinien für die einzelnen Schulformen erschienen verhältnismäßig spät, nämlich ab 1937. Bis dahin waren die Länder in unterschiedlicher Weise tätig geworden. Einige ordneten an, den bestehenden Geschichtsunterricht zu unterbrechen zugunsten eines mehrwöchigen Kurses über die "nationale Revolution", für die bis in die Sprachregelung hinein Vorgaben gemacht wurden.
An einer Neufassung des gesamten Geschichtsunterrichts wurde besonders aktiv gearbeitet, weil er zum Kernfach der gewünschten politischen Erziehung werden sollte. Die Gesamtkonzeption des gewünschten Geschichtsunterrichts hat Eilers treffend zusammengefaßt:
"Geschichtsunterricht bedeutete von nun an Betrachtung der deutschen Geschichte bzw. der Geschichte der nordischen Rasse. Der gesamte Geschichtsverlauf wurde zur Exempelsammlung für ihren Wert und ihre Bedeutung. Als bestimmender Faktor alles Geschehens wurde neben der rassischen Substanz nur noch die Führerpersönlichkeit anerkannt. Das pädagogische Ziel dieser Art der Geschichtsbetrachtung wurde mit 'Weckung einer begeisterten, heldischen Weltanschauung, planmäßige Förderung des Wehrgedankens und Rassebewußtseins' umrissen. Der Stoff konzentrierte sich zunächst in der Urgeschichte bei der Entstehung der Rassen. Über den Nachweis der politischen und kulturellen Bedeutung nordischer Völker in allen Kulturen des Altertums ging der Weg zur Erkenntnis, daß Rassenmischung zum Kulturverfall führe (Spätantike). Die rassenreinen, germanischen Völker traten als Gegenbild zu den degenerierten Südländern auf. Völkerwanderung, Italienpolitik und Kreuzzüge wurden zu sinnlosen Blutverlusten der hochwertigen Rasse, die Ostsiedlung zur Erweiterung ihres Lebensraumes. Nach den unter 'Niedergang und Auflösung' geführten Zeiten wandte sich die Aufmerksamkeit dem heroischen Aufstieg Preußens zu. Der 'Preußengeist' erschien als eine neue Ausformung des echten deutschen Wesens. Nach dem Zeitalter der Revolution rettete dann Bismarck Deutschland und führte es zu Einheit und Größe. Den gigantischen Aufstieg Deutschlands - so setzte sich diese Betrachtungsweise fort -, der nun auf allen Lebensgebieten einsetzte, neideten uns 'die Erbfeinde', die Deutschland systematisch einkreisten, bis es dann im Ersten Weltkrieg gegen eine Welt von Feinden in heldenmütigem Kampf unterlag,
128
zwar unbesiegt im Feld, doch zu Boden geworfen durch den Dolchstoß der marxistischen Revolution. Vom Diktat von Versailles mit seinen demütigenden und ausbeuterischen Bedingungen, von der Herrschaft des volksfremden Parteienstaates erlöste Hitler Deutschland" (15).
Ferner wurde - Hitlers Forderung in "Mein Kampf` entsprechend - Rassenkunde eingeführt - zugeordnet dem Fach Biologie, als Unterrichtsprinzip auch für die Fächer Deutsch, Geschichte und Erdkunde vorgeschrieben. Der Deutschunterricht sollte "volkhafte Dichtung" in den Mittelpunkt stellen, und "psychologisierende und ästhetisierende Literatur" ausschließen.
Eine Aufwertung erfuhr der Schulsport. Die Turnstunden wurden auf drei, später auf fünf erhöht. Auch Boxen wurde wie Fußball und Geländesport in die "Leibesübungen" aufgenommen. Die sportliche Leistungsfähigkeit spielte bei Aufnahme- und Abschlußprüfungen eine immer größere Rolle. Schweres körperliches Leiden sowie ständige Leistungsunfähigkeit in den "Leibesübungen" hatten den Verweis von der höheren Schule zur Folge.
Derartige noch nicht in allen Fällen reichseinheitliche Teilregelungen durch Erlasse oder Richtlinien der Länderkultusminister versuchten offensichtlich, Hitlers bereits beschriebenen pädagogischen Vorstellungen gerecht zu werden. Im übrigen aber galten die in der Weimarer Republik in Kraft gesetzten Richtlinien weiter. Erst 1937 erschienen aus dem REM die ersten umfassenden Richtlinien, und zwar für die Grundschule, die aber 1939 durch neue Richtlinien für die gesamte Volksschule ersetzt wurden.
Diese Richtlinien bestehen aus einem allgemeinen Teil und aus grundlegenden Hinweisen für zehn Unterrichtsfächer (Leibeserziehung; Deutsch; Heimatkunde; Geschichte; Erdkunde; Naturkunde; Musik; Zeichnen und Werken; Hauswirtschaft; Rechnen und Raumlehre), sowie aus Stundentafeln für Jungen bzw. Mädchen.
Der allgemeine Teil begründet zunächst die Erziehungsaufgabe der Volksschule im Rahmen der übrigen NS-Erziehungsmächte:
"Die Aufgabe der deutschen Schule ist es, gemeinsam mit den anderen nationalsozialistischen Erziehungsmächten,
129
aber mit den ihr gemäßen Mitteln die Jugend unseres Volkes zu körperlich, seelisch und geistig gesunden und starken deutschen Männern und Frauen zu erziehen, die, in Heimat und Volkstum fest verwurzelt, ein jeder an seiner Stelle zum vollen Einsatz für Führer und Volk bereit sind. Im Rahmen dieser Aufgabe trägt die Volksschule die Verantwortung dafür, daß die Jugend mit den grundlegenden Kenntnissen und Fertigkeiten ausgerüstet wird, die für den Einsatz ihrer Kräfte in der Volksgemeinschaft und zur Teilnahme am Kulturleben unseres Volkes erforderlich sind" (5).
In diesem Sinne soll die Volksschule den Gedanken der Volksgemeinschaft lebendig werden lassen und selbst lebensnah repräsentieren.
"Eine Erziehung zur Gemeinschaft kann nur in der Gemeinschaft erfolgen. Die Volksschule empfängt die Kinder aus dem Elternhause. Sie soll den Kindern ihre Familiengemeinschaft bewußt machen, die Beziehung zum Elternhaus pflegen und dem Familienleben dienen. Zum anderen aber sollen die Kinder schon in den ersten Jahren in der Schule lernen, sich als Angehörige einer anderen größeren Gemeinschaft zu fühlen. In den oberen Jahrgängen der Volksschule sollen die Kinder allmählich über die Sippengemeinschaft hinaus in die große politische Volks- und Wohngemeinschaft aller Deutschen hineinwachsen. Dabei sollen sie sich schon mit Stolz bewußt werden, zu dem Teil der Volksgemeinschaft zu gehören, in dem sie später als Schaffende die Verantwortung für das Ganze mit zu tragen haben" (5).
Um ihren Platz in der Volksgemeinschaft finden zu können, müssen die Kinder über "sicheres Wissen und Können" verfügen, soweit dies nötig ist, um "alle Kräfte der Jugend für den Dienst am Volk und Staat zu entwickeln und nutzbar zu machen". Damit ist auch eine Beschränkung auf das Wesentliche gemeint, denn diese Schule soll sich "von all den Stoffen freimachen, die auf Grund überwundener Bildungsvorstellungen in sie eingedrungen sind" (6).
Grundlegendes didaktisches Prinzip ist die Heimatkunde; der Unterricht soll ansetzen beim aktuellen Leben der Schüler, ihren altersgemäßen Erfahrungen und ihren sozialen Bindungen, wobei Unterschiede zwischen Stadt und Land durchaus einkalkuliert werden. Der Unterricht soll also das Älterwerden der Kinder einerseits begleiten, andererseits
130
aber auch verweisen auf das Volksganze, das als oberster sozialer Horizont die Bildung des Volksschülers auch begrenzen sollte.
Die Schule bzw. Klasse müsse eine lebendige Gemeinschaft sein, wenn sie die Idee der Volksgemeinschaft repräsentieren wolle, wobei der Lehrer "Führer" ist - eine Absage an anderslautende Vorstellungen der Reformpädagogik. Als Gemeinschaft soll sie einerseits "Führerauslese und Führerbildung" betreiben, andererseits aber auch den schwächeren Schülern helfen.
"Lehrer und Schüler sollen ihren Stolz darin sehen, auch schwächere Schüler zu unterstützen, um sie der Gemeinschaft zu erhalten" (7).
Anteil nehmen soll die Schule ferner "an allen großen heimatlichen und völkischen Geschehen" sowohl im Sinne "einer frühzeitigen und planmäßigen Einführung in das Geschehen der Gegenwart" als auch durch "Schulfeiern".
Die didaktische Struktur des Unterrichts soll in der ersten Klasse vom Gesamtunterricht ausgehen, um dann zunehmend fachorientiert zu werden. Allerdings wird dabei in den Richtlinien ein Widerspruch erkennbar zwischen der Fachorientierung einerseits und der weltanschaulichen Beeinflussung andererseits.
"Bei den im engeren Sinne erziehlich wirkenden, insbesondere den nationalpolitischen Stoffen hat sich der Lehrer davor zu hüten, ihre Gesinnung und Willen bildende Wirkung durch Zerreden, Zerfragen, abstrakte Lehre oder gedächtnismäßigen Drill abzuschwächen oder zu vernichten. Die freudige Bejahung der nationalsozialistischen Weltanschauung durch den Lehrer und sein überzeugendes Vorbild sind für die erfolgreiche Vermittlung der nationalpolitischen Stoffe entscheidend. Das klare, begeisternde Lehrerwort wird als schlicht-anschauliche Erzählung und Darstellung von besonderer Wirkung sein" (8).
Die NS-Weltanschauung ist offenbar einem rationalen Unterricht nicht zugänglich. Gleichwohl wird sie im zweiten Teil der Richtlinien, der die Grundlagen der einzelnen Fächer charakterisieren soll, immer wieder eingefügt. Von der Heimatkunde wird erwartet, daß sie "in den vier unteren Jahrgängen nicht nur Kenntnisse vermittelt, sondern auch
131
den festen Grund legt für den Stolz auf Heimat, Stamm, Volk und Führer" (13). Noch deutlicher beim Geschichtsunterricht:
"Die politische Erziehung in der Volksschule gründet sich in erster Linie auf den Geschichtsunterricht, der die Kinder mit Ehrfurcht vor unserer großen Vergangenheit und mit dem Glauben an die geschichtliche Sendung und die Zukunft unseres Volkes erfüllen soll. Er richtet den Blick auf den schicksalhaften Kampf um die deutsche Volkwerdung, bahnt das Verständnis für die politischen Aufgaben unseres Volkes in der Gegenwart an und erzieht die Jugend zum freudigen, opferbereiten Einsatz für Volk und Vaterland" (15).
Der Unterricht soll "die im deutschen Volke wirksamen rassischen Grundkräfte vorwiegend nordischer Artung" herausstellen.
"Heldischer Geist und der Gedanke des Führertums in germanisch-deutscher Ausprägung sollen den gesamten Geschichtsunterricht erfüllen, die Jugend begeistern und den Wehrwillen wecken und stärken" (15).
"Mit besonderer Sorgfalt ist das Bild des Führers zu zeichnen" (16).
Die Ideologisierung dieses Schulfaches wird offen eingestanden, wenn auch mit unfreiwilliger Ironie.
"Das vorzugsweise erziehliche Ziel dieses Unterrichts schließt die Gewinnung bleibender unterrichtlicher Ergebnisse nicht aus" (16). So sollen "auch einige wenige Geschichtszahlen" dauerhaft gelernt werden. Im übrigen entsprechen die Richtlinien für den Geschichtsunterricht dem erwähnten Urteil von Eilers.
"Leitgedanke" der Erdkunde ist "die Wechselwirkung von Volk und Raum, von Blut und Boden (18). "Dabei ist die Verschiedenheit der Rassen und die besondere Leistung der nordischen Rasse darzustellen". Ferner sind "die kolonisatorischen Leistungen unseres Volkes in aller Welt und unser Anspruch auf kolonialen Raum" "besonders herauszustellen" (19).
Die "Naturkunde" soll im Rahmen der "Erblehre" "Verständnis" wecken für die "Wesensverschiedenheit der Rassen" und die "Gefahren der Rassenmischung" (20).
132
Es wäre jedoch falsch, die Richtlinien lediglich unter dem Gesichtspunkt ihrer ideologischen Sätze zu sehen, zumal zweifelhaft bleiben muß, inwieweit sie in der Schulpraxis eine Rolle gespielt haben; denn immerhin waren die Volksschulen noch weitgehend konfessionell bestimmt. Zudem sind Richtlinien damals wie heute politische Willenserklärungen, aus denen keineswegs einfach auf die Praxis in den Schulen geschlossen werden darf. Bemerkenswerter ist vielleicht, daß die Richtlinien das Bild einer Volksschule zeigen, die milieuverhaftet bleiben soll und von deren Abgängern offenbar keine nennenswerte Mobilität erwartet wird. Deshalb verzichteten die Richtlinien auch auf verbindliche Stoffpläne; diese sollten vielmehr von den Leitern der Volksschulen gemäß den allgemeinen Vorgaben der Richtlinien entwickelt werden; auf Bezirksebene sollte dann für eine gewisse Einheitlichkeit gesorgt werden. Die Stoffpläne sollten also von der Basis her entwickelt werden und dabei den volksgemeinschaftlichen Besonderheiten der Regionen angepaßt werden können.
Bayern als einziges Reichsland hielt sich jedoch nicht an diese Vorgaben, sondern stellte einen dezidierten Lehrplan auf, der als "Mindestanforderung" deklariert wurde, also von allen Volksschulen erfüllt werden mußte.
Schon ein Jahr vorher - 1938 - waren ausführliche Richtlinien für die höheren Schulen mit teilweise sehr ausführlichen Lehrplänen für die einzelnen Fächer erschienen. Der allgemeine Teil beginnt mit einer Rückschau auf die preußische Gymnasialreform, die Hans Richert, Ministerialrat im preußischen Kultusministerium, im Jahre 1925 durchgeführt hatte. Ihr lag der Gedanke zugrunde, daß den deutschen Gymnasien eine neue Sinnmitte gegeben werden müsse, nämlich ein nationalorientiertes "deutsches Bildungsgut". Dieses sollte für alle Formen des Gymnasiums im Mittelpunkt stehen und sich präsentieren in der "deutschkundlichen Fächergruppe" (Deutsch, Geschichte, Erdkunde, Staatsbürgerkunde, Religion). In einem neu eingerichteten Gymnasialtyp, der "Deutschen Oberschule", sollte diese Deutschkunde sogar zum zentralen Bildungsinhalt werden.
Von diesem Reformkonzept, das in den Richtlinien durchaus auch positiv gewürdigt wird, setzen diese sich gleichwohl
133
ab. Es sei "in seinem Wesen sowohl wie in seinen geschichtlichen Voraussetzungen grundverschieden von dem, was der Nationalsozialismus unter politischer Erziehung begreift" (9). Das Reformkonzept habe auf den "deutschen Idealismus als Bildungsgut zurückgegriffen in der Hoffnung, auf diese Weise eine neue Volksgemeinschaft begründen zu können. Dieser Gedanke beruhe jedoch auf der "Illusion, daß geistige Bildung einem Volke das schenken könne, was nur durch die politische Tat einer großen Persönlichkeit dem Schicksal abgetrotzt wird" (9 f.). Das tatsächliche Verhältnis von Politik und Pädagogik sei hier verwechselt worden. Die Erziehungstätigkeit könne keine politischen Ziele setzen, müsse vielmehr umgekehrt von der Politik ihre Aufgabe empfangen. "Man glaubte, durch eine Reform des Bildungswesens das einholen zu können, was wir an politischer Macht verloren hatten; man glaubte, die Einbuße des Staates an Ansehen gegenüber den Mächten der Gesellschaft durch den Aufbau einer im Grunde unverbindlichen staatsbürgerlichen Unterweisung ausgleichen ... zu können" (10). Eine neue Erziehung setze aber eine neue politische Ordnung voraus und die habe der Nationalsozialismus nun geschaffen. "Alle planende Erziehung ist ausgerichtet nach einer gegebenen Ordnung. Das nationalsozialistische Erziehungssystem ist seinem Ursprung nach nicht ein Werk der pädagogischen Planung, sondern des politischen Kampfes und seiner Gesetze" (11). SA und SS seien zunächst als Kampforganisationen entstanden und präsentierten sich nun als neue Lebensordnung, in der auch ein neues Erziehungsprinzip wirksam sei. Die nationalsozialistische Revolution habe den "Vorrang der Politik vor der Pädagogik" (11) bewiesen. Sie "hat an die Stelle des Trugbildes der gebildeten Persönlichkeit die Gestalt des wirklichen, d.h. durch Blut und geschichtliches Schicksal bestimmten deutschen Menschen gesetzt und anstelle der humanistischen Bildungsideologie, die bis in die jüngste Vergangenheit fortgelebt hatte, eine Erziehungsordnung aufgebaut, die sich aus der Gemeinschaft des wirklichen Kampfes entwickelt hatte" (12). Aus diesen politischen Prozessen sei eine neue Bildungsidee entstanden, die noch ausgeformt werden müsse. "Auch das nationalsozialistische Zeitalter wird die Schule hervorbringen, die Geist von seinem Geiste ist, aber wir müssen uns bewußt sein, daß wir am Anfang der neuen Bildung stehen" (12).
134
Unschwer sind in diesem grundsätzlichen Teil die im vorangehenden Kapitel vorgestellten Argumentationen Baeumlers erkennbar, und seine Spuren sind auch sichtbar, wenn nun der Platz der Schule in diesem Bildungsverständnis markiert wird, nämlich "daß ihr Weg wesentlich über die Entwicklung der geistigen Fähigkeiten führt" (13 f.). Die Aufgabe der Schule sei Unterricht, also "die Zucht des Geistes, die Entwicklung der Verstandeskräfte und die Vermittlung lebendiger Bildungsstoffe" (14). Speziell die höhere Schule solle denjenigen Teil der Jugend bilden, "der später zur selbständigen Lösung von Lebensaufgaben der Nation herangezogen werden soll" (15). Diese Führungsschicht soll aber "aus allen Kreisen des Volkes" nach dem "Gedanken der Auslese und Leistung" gewonnen werden.
Der Erziehung zur Verantwortungsfähigkeit müsse auch die Unterrichtsgestaltung entsprechen. Die spezifische Erziehung durch die höhere Schule müsse mit den "Mitteln des Erkennens" angestrebt werden. "Indem der Schüler nicht nur fertige Ergebnisse übermittelt bekommt, indem er veranlaßt wird, den Vorgang des Erkennens und Verstehens in sich selbst zu vollziehen, soll in ihm die Fähigkeit zu eigener, selbstverantwortlicher Entscheidung geweckt werden" (16). Nie dürfe aber "Wissensvermittlung, zum Selbstzweck" werden. Didaktisch soll der Unterricht "an die Umwelt des Schülers, an seiner Erlebnis- und Vorstellungswelt anknüpfen", woraus sich unter anderem die Folge ergibt, "daß die Mädchenerziehung sich nach anderen Gesetzen vollziehen muß als die Jungenerziehung" (17). Die Berücksichtigung der bereits vorliegenden Erfahrungen der Schüler dürfe aber keinen Verzicht auf Leistung bedeuten. "Die neue Höhere Schule wird den jungen Menschen in eine strenge Zucht des Geistes nehmen, sie wird nicht davor zurückscheuen, den jugendlichen Geist durch den Zwang, Tatsachen, Regeln und Zahlen zu lernen, zu kräftigen und geschmeidig zu erhalten, aber sie wird immer darauf achten müssen, daß nicht ein totes Wissen, sondern ein lebendiges Verstehen und Können das Ziel allen Unterrichts ist" (18).
Die Richtlinien versuchen offensichtlich, eine Balance zwischen der Subjektivität des Schülers und der Objektivität der Unterrichtsstoffe herzustellen und damit das Konzept einer leistungsorientierten Lernschule , mit bestimmten Ideen der
135
Reformpädagogik zu verbinden. Dazu gehört auch die Klarstellung der Rolle des Lehrers im Unterricht.
"Unterrichtsgrundsatz ist ein maßvoller, gebundener Arbeitsunterricht, bei dem der Lehrer das Ziel setzt und die Führung fest in der Hand behält. Alles, was die Selbsttätigkeit des Schülers fördert, ihn zu eigenem Denken und Urteilen führt, ist Arbeitsunterricht, mithin das lebendige Lehrgespräch und der zur Mitarbeit anspornende Lehrervortrag ebenso wie die richtig vorbereitete und geleitete Gemeinschaftsarbeit mit Arbeitsteilung und -vereinigung und die sinnvoll gestellte Hausaufgabe.
Der Arbeitsunterricht darf nicht zu verantwortungslosem Kritteln und Zerreden führen oder in überheblicher Rechthaberei und bloßem Meinungsstreit steckenbleiben. Er muß vielmehr in einem Ergebnis, in einer Wertung und Entscheidung sein Ziel sehen. Dafür trägt der Lehrer die Verantwortung" (19 f.).
Dieser Grundsatz schließt aber durchaus "lebendigen Wechsel der Arbeitsweise" ebenso ein wie die Anerkennung der Individualität des Schülers.
"Ein Sichverlieren in stoffliche Nichtigkeiten und eine unnötige Breite des Unterrichtsganges sind Zeitvergeudung und lähmen die Arbeitslust. Nicht minder schädlich ist eine Unterrichtsweise, die den Schüler, anstatt ihm Mut zu machen und sein Selbstvertrauen zu heben, durch kleinliche Zwischenfragen und vermeintliche Hilfen dauernd bevormundet und ihm Selbstvertrauen und Freude an der eigenen Leistung raubt. Jede selbständige Denkleistung ist als solche zu würdigen. Wachsenlassen und Führen sind die sich ergänzenden Grundsätze aller planvollen Erziehung" (20).
Zweifellos lassen diese Richtlinien das Bild einer für die damalige Zeit relativ fortschrittlichen Oberschule erkennen, die Einsichten der Reformpädagogik mit relativ hohen Unterrichtsanforderungen verbindet. Auffallend ist auch, daß im Unterschied zu den Volksschul-Richtlinien diese in ihrem allgemeinen Teil kaum spezifische ideologische Passagen enthalten. Die offizielle Ideologie wird lediglich als fundierende und integrierende Sinnstiftung verstanden.
"Die nationalsozialistische Weltanschauung ist nicht Gegenstand oder Anwendungsgebiet des Unterrichts, sondern sein
136
Fundament. Sie ermöglicht, daß die Schlagbäume zwischen den einzelnen Fachgebieten fallen und auf eine ungezwungene Weise ein Unterricht in Querverbindung und Konzentration betrieben werden kann. Mit ihr lösen sich alle Lehrplan- und Stundenplanschwierigkeiten, die im Zeitalter des Bildungspluralismus unüberwindlich schienen. Denn die Weltanschauung gibt dem Unterricht nicht so sehr neue Bildungsstoffe, als vielmehr eine neue Sicht, ein neues Erziehungsverfahren und ein neues Ausleseprinzip für das Bildungsgut" (19). In den Lehrplänen für die einzelnen Fächer, vor allem für die Gesinnungsfächer und für Biologie sind entsprechende ideologische Verkürzungen allerdings durchaus zu finden. Hier wirkt sich die NS-Weltanschauung tatsächlich als "neues Ausleseprinzip für das Bildungsgut" zum Teil nachhaltig aus. Im ganzen jedoch versuchen diese Richtlinien, das sachorientierte Leistungsprinzip gegen allzu starke ideologische Beeinträchtigungen durchzuhalten. Ein Beispiel dafür, aber auch zugleich ein Hinweise darauf, daß offensichtlich auch in den Schulen die "Weltanschauung" bereits verkitscht wurde, ist folgende Bemerkung über den Schulaufsatz:
"Der Schulaufsatz ist weder der geeignete Prüfstein für eine propagandistische Begabung des Schülers, noch der Ort, wo er seine Gesinnung zu Markte tragen soll. Vielmehr ist jedem eitlen und berechnenden Verschleiß nationaler Werte schonungslos entgegenzutreten: für die großen nationalen Kundgebungen muß ein unverbrauchter Wortschatz zur Verfügung stehen, die Phrase, wo und wie immer sie sich hervorwagt, ist rücksichtslos zu entlarven: Worte wie heldisch, Blut, Ehre, Volksgemeinschaft und andere müssen ihren tiefen Sinn verlieren, wenn sie im Alltag des Unterrichts leichtfertig verbraucht werden" (44).
Die Richtlinien versuchen also, fachliche Leistung in den Oberschulen zu erhalten und die Abstraktheit und Lebensfremdheit des traditionellen Gymnasiums zu vermeiden. Die "Lebensnähe" der Schule ist aber eben immer auch Hinwendung zum tatsächlichen gesellschaftlichen Leben und damit auch zu dessen offizieller ideologischen Bewertung, und die war damals eben nationalsozialistisch.
Die Richtlinien zeigen, daß ein deutlicher Unterschied zwischen Volksschule und höherer Schule gemacht wird. Ob-
137
wohl Begabten aus den unteren Volksschichten ausdrücklich der Weg in die höhere Bildung freigemacht werden sollte, war die Volksschule als Massenschule des Volkes gedacht. Deshalb sollte sie wie früher wieder im völkischen Leben verankert werden, an dessen aktuellen Ereignissen wie an den entsprechenden Festen und Feiern teilnehmen. Diese lokale wie volksgemeinschaftliche Eingebundenheit erschien den Richtlinien-Machern wichtiger als dezidiertes Wissen, das sich in Schulbüchern fand, die zum Teil noch aus der Weimarer Zeit stammten.
Die Oberschule war dagegen als Leistungsschule gedacht. Andererseits bemühte sich das Regime durchaus, erkennbaren Begabungen "aus dem Volk" gerecht zu werden mit Angeboten unterhalb der Oberschule. Die reichsweite Einführung der Mittelschule durch Rust diente auch diesem Zweck, ebenso die damit konkurrierende Einführung der Hauptschule, die für die besten Volksschüler zur Pflichtschule werden sollte. Auch die Aufbauschulen, die in ländlichen Gebieten eingerichtet wurden, sollten Begabte mobilisieren, und die im Krieg eingeführten Lehrerbildungsanstalten machten den Volksschullehrer wieder zu einem Aufstiegsberuf für Volksschulabgänger, für Abiturienten war er zu einem Abstiegsberuf geworden - ein wesentlicher Grund für den Lehrermangel.
Bei der Beurteilung dieser Schule und Bildungspolitik muß man bedenken, daß es damals - anders als heute - noch eine verhältnismäßig tiefe Kluft gab zwischen Bürgertum und Arbeiterschaft bzw. Landbevölkerung, die sich unter anderem auch im Schulzugang ausdrückte. Selbst für ein unzweifelhaft begabtes Arbeiter- oder Bauernkind war der Besuch einer Oberschule ein schwieriges Unterfangen - nicht nur, weil dafür Schulgeld gezahlt werden mußte, sondern vor allem auch, weil damit eine soziale Entfremdung verbunden war. Deshalb war es keineswegs abwegig, für solche Kinder Schulformen anzubieten, die näher an ihrem sozialen Status und gesellschaftlichen Selbstverständnis lagen als die Oberschulen.
Zu den seit 1937 einsetzenden Schulreformmaßnahmen gehört auch das "Reichsschulpflichtgesetz" (6.7.38). Es setzte den Beginn der Schulpflicht auf das vollendete 6. Lebensjahr des Kindes und eine achtjährige Volksschulpflicht fest. Zwar
138
hatte schon die Weimarer Verfassung im Artikel 145 eine Schulpflicht von mindestens acht Jahren vorgesehen, aber die Länder hatten diese Forderung unterschiedlich erfüllt. Bayern und Württemberg hatten die achtjährige Volksschule nur teilweise eingeführt, während in Hamburg und Schleswig Holstein eine neunjährige Schulpflicht bestand.
Die wichtigste Bestimmung dieses Gesetzes war jedoch die Neuordnung des Berufsschulwesens. Zwar hatte auch in dieser Frage der Artikel 145 der Weimarer Verfassung eine einheitliche Regelung vorgesehen, doch ein entsprechendes Reichsberufsschulgesetz kam ebenso wenig zustande wie ein Reichsschulgesetz. Das Ergebnis war eine Fülle von verwirrenden Bestimmungen, die teilweise nur lokale Geltung hatten, und die vor allem darauf zurückzuführen waren, daß die Zuständigkeiten von Handels- und Kultusministerien sich vielfach überschnitten. Etwa ein Viertel der an sich berufsschulpflichtigen Jungen und Mädchen zwischen 14 und 18 Jahren konnten keine Berufsschule besuchen. Nun wurde die "Berufsschulpflicht" reichsweit eingeführt. Sie begann für jeden Schüler nach dem Ende der Volksschule und dauerte drei Jahre, für landwirtschaftliche Berufe zwei Jahre. Die Kommunen wurden verpflichtet, entsprechende Schulen einzurichten, so daß auch das in Mittel- und Kleinstädten bisher vernachlässigte Berufsschulwesen ausgebaut werden konnte. Die praktische Berufsausbildung erfolgte in den Betrieben und war bisher eine Domäne des Handwerks. Nun wurde die Industrie gedrängt, sich ebenfalls an der Berufsausbildung zu beteiligen. So entstand innerhalb weniger Jahre eine vom Handwerk unabhängige Berufsausbildung. Für die einzelnen Lehrberufe wurden Berufsbilder festgelegt, aus denen dann die für nötig erachteten Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten abgeleitet wurden. Auf diese Weise entstanden bis 1943 dreihundertvierzehn anerkannte Lehrberufe, die allerdings sehr spezialistisch konzipiert waren.
Es hat verschiedene Versuche gegeben, die NS-Ideologie in einem eigenen Schulfach zu lehren. Einer davon war der 1934 eingerichtete "Staatsjugendtag", der zwischen HJ und Schule aufgeteilt wurde. Die 10- bis 14jährigen Schüler, die dem Jungvolk angehörten, sollten ihre nationalpolitische Erziehung in der HJ erhalten, die übrigen blieben in der Schule, wo ein zweistündiger weltanschaulicher Unterricht, ergänzt
139
durch Sport, Basteln und Wandern abgehalten wurde. Dieses Projekt scheiterte aber einerseits an der Unfähigkeit der HJ, diese Aufgabe geistig und organisatorisch zu bewältigen, zum anderen auch am Widerstand der Schule, die auf ihr Niveau nicht verzichten wollte; der "Staatsjugendtag" wurde 1936 wieder abgeschafft.
Lediglich in Württemberg wurde die NS-Weltanschauung als Schulfach eingeführt ("weltanschaulicher Unterricht" = WAU). Nach einem 1938 veröffentlichten Stoffplan-Entwurf sollte der WAU folgende Themenkreise behandeln:
"Für die Grundschule sieht der Entwurf zwei große Themenkreise vor: 1. 'Vom Erahnen Gottes in der Natur', wobei Stoffe zu den Themen 'Die Ordnung der Natur' sowie 'Die Jahreszeiten' vorgesehen sind und 2. 'Vom Erleben der Blutsgemeinschaft', wobei es um Stoffe zu den Themen 'Das Kind als Glied der Familie', 'Das Kind in der Schulgemeinschaft', 'Das Kind in der Stadt- und Dorfgemeinschaft', 'Das Kind in der Volksgemeinschaft' geht. Für die Mittelstufe (5.8. Schuljahr) werden Stoffe aus folgenden Themenkreisen vorgeschlagen: 'Göttermythen und Heldensagen', 'Aus der deutschen Geschichte', 'Deutsche Glaubens- und Lebenskunde', 'Vorbilder deutschen Wesens in Leben und Denken', 'deutsche Kunst', 'Weltanschauliche Auseinandersetzung mit anderen Mächten', 'Besprechung weltanschaulich wichtiger Tagesereignisse'. In der höheren Schule steht vor allem die nationalsozialistische Weltanschauung sowie ihre historischen und rassischen Grundlagen im Zentrum des ,Entwurfs'. Die Auseinandersetzung mit den Kirchen fand vor allem unter der Überschrift 'Weltanschauliche Auseinandersetzungen mit anderen Mächten' statt. Für das siebte Schuljahr waren da u.a. folgende Stoffe vorgesehen: 'Jüdische Weltanschauung', 'Das Wesen des Christentums', 'Der politische Katholizismus'. Schon die Untertitel zum letzten Thema wie 'Das politische Machtstreben der Kirche im Mittelalter', 'Die Beherrschung der Seelen durch Lohn und Strafe', 'Das Unfehlbarkeitsdogma' deuteten auf eine sehr gehässige, einseitige Darstellung der (katholischen) Kirche und ihrer Geschichte hin. Noch deutlicher war das im achten Schuljahr zu spüren, wo unter dem Oberthema 'Gegenbewegungen gegen den deutschen Geist' Themen wie: 'Die Jesuiten', 'Die Politik des Zentrums', 'Die katholische Aktion und ihre Tarnung im Dritten Reich', 'Protestantische Rompilger'
140
zur Behandlung vorgeschlagen wurden ... (Thierfelder, S.244).
Die evangelische Kirche des Landes gestand dem Staat zwar das Recht zu, einen staatsbürgerlichen Unterricht zu erteilen, wandte sich aber scharf gegen die anti-christlichen Partien dieses Lehrplans. Der Streit zog sich bis in die letzten Kriegsjahre hin, und Bischof Wurm forderte die Pfarrer auf, Kinder nicht zu konfirmieren, die am WAU teilnahmen. Diese Auseinandersetzung bewog schließlich das REM, die geplante Einführung des WAU in Sachsen zu verbieten.
Bei den Versuchen, die NS-Weltanschauung in den Schulen zu lehren, erwies sich schnell, daß dieses "ldeengut" dafür zu diffus war bzw. daß niemand die Kompetenz hatte, es allgemeingültig zu definieren. Lediglich in den von den Nazis eingerichteten Eliteschulen (NPEA und Adolf-Hitler-Schulen) war der Spielraum dafür offener, weil die Definitionsmacht derer, die diese Schulen betrieben, entsprechend größer war.
Dem Programm der "Volksgemeinschaft" widersprachen die Bekenntnisschulen. Ihre Beseitigung stieß jedoch auf rechtliche Schwierigkeiten. Das Konkordat von 1933 sicherte den Bestand und die Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen, und die evangelische Kirche ging davon aus, daß diese Regelung aus Gründen der Parität auch für sie gelten würde. Für Preußen galt zudem immer noch das "Volksschulunterhaltungsgesetz" von 1906, das die Bekenntnisschulen ebenfalls garantierte. Bis 1935 änderte sich in dieser Frage auch nichts, obwohl die Einführung der "Gemeinschaftsschule" zum Programm des "Nationalsozialistischen Lehrerbundes" (NSLB) seit 1930 gehörte. Für die Abschaffung der Bekenntnisschulen gab es nicht nur ideologische Gründe, insofern sie das Erziehungsmonopol der Nazis gefährdeten, sondern auch praktische; die Unterhaltung vieler Zwergschulen war unökonomisch. Voll gegliederte Volksschulen waren nur in den großen Städten zu finden und im ganzen in der Minderheit. Im Jahre 1940 waren nur circa zehn Prozent der Volksschulen im Reich voll ausgebaut, vierzig Prozent aller Schulen waren einklassig, zwanzig Prozent waren zweiklassig, zehn Prozent dreiklassig, acht Prozent vierklassig.
Der Kampf für die Gemeinschaftsschule begann 1935 in Bayern und dauerte bis Ostern 1941; erst dann waren die letz-
141
ten Konfessionsschulen beseitigt. Die Kampagne ging nicht von einer zentralen Weisung des Reiches aus, sondern von lokalen Parteiinstanzen bzw. von den Kultusministerien der Länder. Vor allem der "Nationalsozialistische Lehrerbund" (NSLB) setzte sich dabei in Szene. Gearbeitet wurde mit Haken und Ösen. Im Grunde mußte der Anschein erweckt werden, als wolle die Mehrheit der Bevölkerung selbst die Gemeinschaftsschule. Abstimmungen unter den Eltern wurden in Schulen veranstaltet, wobei die Anwesenden kurzerhand als Repräsentanten der Gesamtbevölkerung definiert wurden. An anderen Orten wurden die Bürgermeister einfach als Vertreter des Volkswillens angesehen. Die katholische Kirche veranstaltete in ihren Gottesdiensten Gegen-Abstimmungen und veröffentlichte deren Ergebnisse. Diese Auseinandersetzung brachte teilweise erhebliche Unruhe in die Bevölkerung, so daß Heydrich die Abstimmungen 1937 verbot.
Wie bereits gesagt, ging die Initiative zu dieser Kampagne nicht vom REM aus. Im Gegenteil versuchte Rust diese Aktivitäten mit dem Hinweis zu stoppen, er bereite eine reichseinheitliche Regelung vor. Die Kampagne ist ein Beispiel dafür, daß in der NS-Zeit Schulpolitik keineswegs nur von den dafür zuständigen staatlichen Instanzen gemacht wurde, sondern auch von Parteidienststellen. Das war möglich, weil Hitler keine klaren Direktiven für die Schulpolitik erlassen hatte. Statt dessen griff er mit "Führerbefehlen" ein. Das waren oft nur Äußerungen im Kreise seiner Unterführer, die von diesen dann in ihrem Sinne ausgelegt und durchgeführt wurden. Zunehmende Bedeutung gewann dabei Martin Bormann, der zunächst Sekretär des Hitler-Stellvertreters Hess, dann Hitlers Sekretär war. Vor allem von ihm gingen die religions- und kirchenfeindlichen Tendenzen aus. Er unterstützte die erwähnte Einführung des WAU in Württemberg nachdrücklich. Er wollte Schulgebete und Schulandachten durch NS-Morgenfeiern ersetzen und eine Art von NS-Katechismus anstelle einer christlichen Sittenlehre einführen. Für die restlose Beseitigung der Bekenntnisschulen setzte er Rust schließlich ein Ultimatum.
Während Rust und sein Ministerium immerhin versuchten, eine sachorientierte Schulpolitik zu betreiben und dabei die staatliche Administration von Parteieingriffen nach Möglichkeit freizuhalten, verfolgten führende Persönlichkeiten der Partei entgegengesetzte Ziele. Baldur von Schirach, der "Reichs-
142
jugendführer", verwickelte Rust nicht nur in zahllose Konflikte, die die Beziehungen der HJ zur Schule betrafen, er versuchte auch bis in die Kriegsjahre hinein ein Jugendministerium unter seiner Leitung durchzusetzen, dem auch das Schulwesen unterstellt werden sollte. Gemeinsam mit Robert Ley, dem Führer der "Deutschen Arbeitsfront" (DAF) gründete er 1936 ohne Wissen Rusts, aber gedeckt durch einen "Führerbefehl", die "Adolf-Hitler-Schulen" als reine Parteischulen, die nicht mehr der staatlichen Schulaufsicht unterstanden. Davon wird im nächsten Kapitel noch zu sprechen sein.
Die schon erwähnten "Deutschen Heimschulen" unterstellte Hitler dem SS-Gruppenführer August Heißmeyer, Chef des Hauptschulungsamtes der SS, der auch ab 1936 die Leitung der 1933 gegründeten "Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" (NPEA) übernommen hatte. Ab 1942 bekam er auch die Leitung der "Reichsvereinigung deutscher Privatschulen" in die Hand; in diesem Verband waren die noch verbliebenen Privatschulen zusammengefaßt worden.
Die "Nationalpolitischen Erziehungsanstalten" (NPEA) waren ähnlich wie die später zu behandelnden Adolf-HitlerSchulen" als Eliteschulen des Regimes vorgesehen. Am 20.4.33 wurden die staatlichen Bildungsanstalten in Potsdam, Plön und Köslin, die früher preußische Kadettenanstalten waren, in NPEA umgewandelt. In diesen Schulen sollte das Modell einer NS-Erziehung entwickelt werden. Der Lehrkörper setzte sich zusammen aus Lehrern, die für den Unterricht zuständig waren, und aus Erziehern. Als Lehrer wurden junge, unverheiratete Studienassessoren auf drei Jahre verpflichtet, die Erzieher waren durchweg überzeugte Nationalsozialisten. Neben dem Unterricht in den üblichen Fächern - wozu hier auch ein "nationalpolitischer Unterricht" gehörte - nahm der Sport einen breiten Raum ein, einschließlich damals elitärer Sportarten wie Rudern, Segeln, Segelflug, Motorsport. Hinzu kam Geländesport im Sinne einer vormilitärischen Ausbildung. Im Herbst fanden mehrwöchige, manöverähnliche geländesportliche Übungen statt, an denen alle preußischen Anstalten beteiligt waren und die von ranghohen Offizieren begutachtet wurden. Auf dem Programm standen auch Fahrten durch Deutschland. In der Untersekunda mußte jeder Schüler sechs bis acht Wochen bei einem Bauern oder Siedler arbeiten, im nächsten Schuljahr in einer Fabrik. Längere Auslandsaufenthalte wurden durch
143
einen
Austauschdienst organisiert.
Der Alltag im Internatsbetrieb wurde durch die typische
NS-Lagererziehung
bestimmt: Frühsport, Fahnenappell, Feiergestaltung, Lagerdienst,
Gemeinschaftsleben.
Das ganze Arrangement sollte den Schülern das Bewußtsein
vermitteln,
zu einer privilegierten Gruppe und zur späteren Elite zu
gehören.
Deshalb waren Schulplätze für diese Schulen sehr begehrt.
Rust
hatte die Lehrer des dritten und vierten Schuljahres angewiesen,
besonders
begabte Jungen dem Kreisschulrat zu melden, der dann die Eltern zu
einer
Bewerbung aufforderte. Vorbedingung waren Mitgliedschaft in der HJ,
gute
Gesundheit, sportliche Leistungsfähigkeit, Nachweis der arischen
Abstammung
der Eltern und ein politisches Gutachten des zuständigen
Kreisleiters.
Die vorgeschlagenen Jungen nahmen acht Tage am Dienst einer NPEA teil,
wurden dabei beobachtet und danach endgültig ausgewählt. Im
Unterschied
zur Adolf-Hitler-Schule, die kein Schulgeld verlangte, mußte
für
die NPEA ein nach Elterneinkommen gestaffeltes Schulgeld zwischen 200
und
1.200 RM pro Jahr gezahlt werden. Allerdings gab es eine ganze Reihe
von
Freiplätzen, die vorzugsweise an Kinder von bewährten
Nationalsozialisten
vergeben wurden. Hitler wollte, daß aus diesen Schulen der
Offiziersnachwuchs
hervorging. Deshalb verfügte der Reichskriegsminister über
eine
Reihe von Stipendien für die Söhne aktiver Offiziere. Im
Kriege
gab es in Deutschland und in den annektierten Gebieten 35 NPEA, etwa
ein
Prozent der Abiturienten wurde in ihnen ausgebildet. Das war nicht
viel,
aber für die Zeit nach dem Kriege war an einen zügigen Ausbau
dieses Schultyps gedacht.
Die Entwicklung der Lehrerbildung
144
Grundlage gestellt - im Unterschied zu der vorher gültigen Seminarausbildung, die mit Volksschulabschluß absolviert werden konnte; diese Art der Ausbildung hatte auch Ernst Krieck genossen. Die Weimarer Verfassung hatte im Artikel 143, 2 festgelegt, daß die unterschiedlichen Ausbildungen der Lehrergruppen angeglichen werden sollten. "Die Lehrerbildung ist nach den Grundsätzen, die für die höhere Bildung allgemein gelten, für das Reich einheitlich zu regeln". Nun sollte also das Abitur zur Eingangsvoraussetzung für die Ausbildung der Volksschullehrer werden. Aber zu einer reichseinheitlichen Regelung kam es nicht.
Das durch die Weimarer Verfassung vorgegebene Prinzip der Verwissenschaftlichung wurde in den einzelnen Reichsländern jedoch unterschiedlich realisiert. Braunschweig, Hamburg, Sachsen und Thüringen bildeten die Lehrer an der Universität bzw. Technischen Hochschule aus; Bayern und Württemberg hielten an der Seminarausbildung fest, die nur unwesentlich modifiziert wurde. Preußen hatte die "Pädagogische Akademie" eingeführt, eine Hochschule eigenen Typs außerhalb der Universität. Sie beruhte im wesentlichen auf einem Gutachten, das Eduard Spranger verfaßt hatte ("Gedanken über Lehrerbildung", 1920). Spranger befürchtete einerseits eine Pädagogisierung der Universität, wenn sie die Lehrerbildung übernehmen würde, andererseits glaubte er, daß der Volksschullehrer für seinen Beruf anderes brauche als ein wissenschaftliches Universitätsstudium. Die Akademie sollte eine "Bildnerhochschule", eine "Stätte der Begegnung mit den Kulturinhalten" sein. Dort sollte der angehende Lehrer sich selbst bilden können, um danach auf seine Schüler entsprechend einzuwirken. Gemäß der "Denkschrift" über "Die Neuordnung der Volksschullehrerbildung in Preußen" (1925) wurde vom Studium an den neuen Akademien "Pädagogische Schulung, Vertrautheit mit den zu vermittelnden geistigen, religiösen, sittlichen, technischen und künstlerischen Bildungswerten, Verwurzelung im heimatlichen Volkstum und eine ausgeprägte Berufsgesinnung" erwartet (7). Aus diesen Formulierungen wird erkennbar, daß die "Volksnähe" des Volksschullehrers, wie sie sich in den Richtlinien für die Volksschulen von 1939 zeigt, im Prinzip keine Erfindung der Nationalsozialisten war.
Die preußischen Akademien verwandelte Rust am 6.5.33 in "Hochschulen für Lehrerbildung" (HFL) mit der Absicht,
145
diesen Typus für das ganze Reich einzuführen, was aber wegen der erwähnten unterschiedlichen Ausgangsbedingungen erst 1937 voll gelang. Auch die neuen HFL setzten das Abitur voraus und das Studium dauerte wie bisher zwei Jahre. Aber Rust verlegte die Anstalten in ländliche Gebiete und in Grenzgebiete, um so die völkisch-gemeinschaftsorientierten Erwartungen an den NS-Lehrer zu unterstreichen. Von 1936 bis 1939 mußten auch Anwärter für das höhere Lehramt zunächst zwei Semester an einer HFL studieren - im Sinne einer "Ausrichtung der gesamten Erzieherschaft auf ein einheitliches politisch-weltanschauliches Ziel". Am Ende dieses Studienabschnitts entschied der Direktor der Anstalt darüber, ob der Student zu einem weiteren Studium an der Universität zugelassen werden sollte. Mit Kriegsbeginn wurde dieser Studienanteil jedoch nicht zuletzt auf Einspruch der Rektorenkonferenz wieder zurückgenommen.
Von Anfang an gab es einflußreiche Kreise in der NSDAP, die den Ausbildungsstandard der HFL für unangemessen hoch hielten angesichts der Erwartungen, die an den Beruf des Volksschullehrers zu stellen seien. Vor allem kritisierten sie die Reifeprüfung als Zulassungsvoraussetzung. Eine ihre Argumentation stützende Tatsache sahen sie in dem eklatanten Lehrermangel, der Mitte der 30er Jahre einsetzte, nachdem Ende der 20er Jahre noch "Überfüllung" geherrscht hatte. Trotz intensiver Werbung für den Volksschullehrerberuf konnten die HFL 1938 nur etwa die Hälfte des Bedarfs decken. Im Jahre 1940 konnten die Hochschulen nur etwa 2.300 Junglehrer bereitstellen, benötigt wurden aber etwa 7.000.
Die Gründe für den Mangel lagen vor allem darin, daß das Ansehen dieses Berufes nicht zuletzt durch die Angriffe der HJ, wegen der vor allem auf dem Lande vielfach immer noch geltenden kirchendienstlichen Pflichten der Lehrer und wegen der schlechten Bezahlung auf einem Tiefpunkt angelangt war. Die Abiturienten hatten damals weit bessere berufliche Alternativen vor Augen. Aufschlußreich zu diesem Thema ist ein Bericht des Kreisleiters von Cloppenburg vom November 1940:
"Wir alle wissen, wie schwer es ist, Lehrernachwuchs zu bekommen, und eingehende Umfrage in den Ortsgruppen hat denn auch ergeben, daß wir diese Schwierigkeiten noch lange nicht überwinden werden. Ein Hauptübel ist, daß gerade
146
Junglehrer miserabel bezahlt werden. Auch darüber habe ich früher schon einmal berichtet und ihr Gehalt mit den hauptamtlich angestellten Führern der HJ verglichen. Das Ergebnis war ein Entrüstungsschrei der HJ, die sich einfach verbat, daß ein Jugendführer mit einem Junglehrer auf eine Stufe gestellt werden sollte. Heute ist es nun so weit, daß kein Junge mehr Lehrer werden will; denn 16jährige Jungens verdienen genausoviel wie ein studierter Junglehrer. Auf dem Ammerland erzählt man sich z.B., ein Junglehrer bekäme das Gehalt eines Knechtes.
Es kommt hinzu, daß man den Lehrern sehr viele Nebeneinkünfte genommen hat, und das Endergebnis ist, daß heute kein Mensch mehr darum rennt, Lehrer zu werden.
Ich habe ja auch das Gefühl, als wenn man sich deshalb nicht so sehr zum Nachwuchs drängt, weil man weiß, daß der Lehrer seine ursprüngliche beherrschende Position eingebüßt hat und weil man weiter weiß, daß er heute in hervorragendem Maße für die Mitarbeit in der Partei herangezogen wird, so daß ihm bei einer gewissenhaften Ausübung seines Berufes kaum noch Freizeit bleibt ... .
Zu allerletzt führe ich dann noch einen Grund an, den man auch nicht außer acht lassen soll: Hier in unserem Bezirk machen auch die Eltern nicht mit, denn sie fürchten, daß die Jungens in der Aufbauschule ohne Religion aufgezogen werden, und dann scheidet der Lehrerberuf in den meisten Fällen aus" (zit. n. Willenborg, 96).
Auf dem Hintergrund dieses Mangels forderte die von Bormann geleitete Parteikanzlei den Abbau der akademischen Lehrerbildung, und Rust wurde erheblich unter Druck gesetzt. Er wehrte sich heftig und trat mit Entschiedenheit für eine wissenschaftsorientierte Ausbildung auch der Volksschullehrer ein. Aber Hitler verfügte Ende 1940 die Auflösung der HFL und die Schaffung von "Lehrerbildunganstalten" (LBA). Er hielt es für "völlig abwegig", "Lehrer, die ABC-Schützen zu unterrichten haben, mit Hochschulbildung auszustatten" (Ottweiler, in: Heinemann 1980, Bd.1, 206). Er wünschte außerdem, ehemalige Unteroffiziere nach einer pädagogischen Zusatzausbildung als Volksschullehrer unterzubringen.
Die LBA, die nun nicht mehr wie noch die HFL nach Konfessionen getrennt waren, nahmen Volksschule und Haupt-
147
schulabgänger auf, die Ausbildung dauerte fünf Jahre bis zur ersten Lehrerprüfung. Sie war straff schulmäßig orientiert und fand unter Internatsbedingungen statt, was - unter maßgeblicher Beteiligung der HJ - eine intensive Lagererziehung ermöglichte. Ende 1942 gab es im Reich 160 LBA. Ihr Leistungsniveau war so niedrig, daß selbst aus Kreisen der NSDAP bei der Parteikanzlei - vergeblich - interveniert wurde mit dem Ziel einer Erhöhung des geistigen Niveaus. Ein Grund für diesen intellektuellen Verfall war die permanente Inanspruchnahme der Studierenden und der Lehrenden für Aufgaben der Partei bzw. für den "Einsatz" im Rahmen kriegsbedingter Aufgaben; schließlich galt es ja, das Studium nicht akademisch-lebensfremd, sondern "volksgemeinschaftlich" zu gestalten.
Rust hatte den Lehrermangel Ende der 30er Jahre durch Notmaßnahmen überbrücken wollen, ohne das Konzept der HFL im Grundsatz anzutasten. So wurden in Preußen Anfang 1939 "staatliche Aufbaulehrgänge für das Studium an den Hochschulen für Lehrerbildung" eingerichtet, in denen Volksschulabgänger vier und Mittelschulabgänger zwei Jahre lang auf ein Studium an der HFL vorbereitet wurden. Die Auswahl der Bewerber erfolgte - analog dem Verfahren für die NPEA - in Musterungslagern, in denen sich die Jungen und Mädchen zu bewähren hatten. Eine weitere Maßnahme war die Verkürzung des Studiums an der HFL, von vier auf drei, schließlich auf zwei Semester. Anfang 1940 wurde mit den "Schulhelfern" ein ganz neues Konzept auf den Weg gebracht: 19-30jährige Männer und Frauen mit einem Mittelschul- oder gutem Volksschulabschluß wurden in dreimonatigen Kurzlehrgängen an zwei HFL als "Schulhelfer" für eine zweijährige Unterrichtspraxis vorbereitet; danach sollte ein einjähriges Studium an einer HFL folgen. Vor allem Frauen machten von diesem Angebot Gebrauch, weil die Hochschulpolitik vor dem Kriege Frauen sehr benachteiligt hatte und das Studium mit hohen Kosten verbunden gewesen wäre. Nun bekamen sie eine Ausbildungsvergütung und während der Schulhelferzeit Dienstbezüge. Aber der "Führerbefehl" zum Wechsel von der HFL zur LBA machte solche Ansätze zunichte.
Ein wesentliches Instrument der weltanschaulichen Ausrichtung waren die "Lager". Entweder waren sie von vornherein Bestandteil der Ausbildung wie bei den LBA, oder sie
148
wurden immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten als eine Art von Intervention in den Ausbildungsprozeß eingeschaltet. So war im zweiten Referendarjahr die weltanschau
liche Grundlage der NS-Erziehung das allgemeine Ausbildungsthema, das durch ein Lager abgerundet wurde. In Lagern wurden auch die Ausbilder weltanschaulich auf Linie gebracht. Die weltanschauliche Grundlage dafür bildeten vor allem Schriften von Krieck und Baeumler.
Ein weiteres Kontrollinstrument war der freiwillige "Einsatz im Rahmen der NS-Formationen. Bei der Prüfung hatte der Kandidat darüber Rechenschaft abzulegen, und die "Reichsordnung für die pädagogische Prüfung" (7.6.37) schrieb Stellungnahmen zur politischen Einstellung ausdrücklich vor. Die bloß fachliche Qualifikation reichte nicht aus.
Der Mangel an Lehrkräften, der Mitte der 30er Jahre bemerkbar wurde, betraf nicht nur die Volksschule, sondern auch die Oberschule. Um das Jahr 1933 jedoch war das Gegenteil der Fall-, in dieser Zeit gab es für beide Schularten sehr viel mehr Lehramtsbewerber, als eingestellt werden konnten.
Schon 1930 hatte der preußische Kultusminister Adolf Grimme darauf hingewiesen, daß 1934 etwa sieben- bis achttausend Studienassessoren keine Anstellung finden würden (Nath 1988, 177). Die Nationalsozialisten übernahmen 1933 also eine "Überfüllung" nicht nur der Hochschulen, sondern auch der Oberschulen, und sie versuchten, dieser Überfülle durch restriktive Maßnahmen Herr zu werden. Im "Gesetz gegen die Überfüllung der deutschen Schulen und Hochschulen" (1933) wird festgelegt, daß die Zahl der Oberschüler und Studenten durch rigide Prüfungsauslese dem beruflichen Bedarf angepaßt werden soll. Außerdem werden Richtzahlen für die Aufnahme in Oberschulen und Hochschulen vorgegeben, die jedoch in der Praxis überschritten wurden. Leidtragende dieser rigiden Bildungspolitik waren vor allem die Studentinnen, deren Zahl auf zehn Prozent der Gesamtstudentenzahl begrenzt wurde, und die jüdischen Studenten, deren Zahl dem jüdischen Bevölkerungsanteil entsprechend auf 1,5 Prozent gesenkt wurde.
Dieses Gesetz entsprang dem Geist einer "Numerus-clausus-Fraktion" (Nath 1988, 198) unter den Nationalsozialisten, zu
149
der auch der bereits erwähnte Wilhelm Hartnacke gehörte, mit dem Ernst Krieck später eine Fehde austrug; diese Gruppe hielt den Andrang zur weiterführenden Bildung und zum Hochschulstudium für einen "Bildungsfimmel". Sie verlor jedoch an Einfluß, als aus der "Überfüllung" innerhalb kurzer Zeit ein Mangel wurde. Der Bedarf an Akademikern stieg ab 1936 stark an, weil der wirtschaftliche Aufschwung und vor allem der Aufbau der Wehrmacht qualifiziertes Personal erforderten. Deshalb wird die Oberschulzeit ab Ostern 1937 um ein Jahr auf zwölf Jahre verkürzt, um zwei Abiturientenjahrgänge auf einmal zur Verfügung zu haben. Schon Ende 1936 erklärt das REM das höhere Lehramtsstudium als "aussichtsreich", und im Wintersemester 1937 blieben Studienplätze unbesetzt. Nun versuchte das REM, durch Schulgeldermäßigung, Begabtenförderung, "Begabtenprüfungen" für Berufstätige und "Sonderreifeprüfungen" für Fachschüler sowie durch "Gebührenerlaß" für begabte, aber bedürftige Studenten Oberschule und Studium attraktiver zu machen (die Studiengebühren für die Universitäten betrugen je nach Fach zwischen 157 und 250 Reichsmark pro Semester, was etwa dem Monatsgehalt eines Facharbeiters entsprach). Ferner wurden die Gehälter und die Aufstiegsmöglichkeiten verbessert. Auch die Frauenquote steigt wieder an, 1941 sind mehr als ein Viertel aller Vollzeitlehrer an höheren Schulen Frauen - ein Anteil, der erst Mitte der 60er Jahre überboten wird (Nath 1988, 156). Ab 1938 wurde allgemein unter den Abiturientinnen für das Hochschulstudium nicht nur im Hinblick auf frauenspezifische Studiengänge geworben, sondern auch für andere Fächer wie Jura und Technik. Das Reifezeugnis der Oberschulen für Mädchen, hauswirtschaftlicher Zweig, berechtigte bisher nicht zum Studium, diese Beschränkung wurde nun aufgehoben.
Während also das Niveau der Volksschullehrerausbildung erheblich absank und die materielle Lage der Lehrer sich kaum verbesserte, wurde ernsthaft versucht, das Niveau der Oberschulen auch unter Kriegsbedingungen möglichst zu erhalten, obwohl im Kriege das Studium auf sechs Semester und die Referendarzeit auf ein Jahr (statt zwei Jahre) verkürzt und auf die schriftliche Hausarbeit verzichtet wurde.
150
Ausschaltung und Gleichschaltung
Nachdem die Nationalsozialisten 1933 an die Macht gekommen waren, versuchten sie diese vor allem durch zwei Strategien zu festigen: durch die Ausschaltung der für Gegner gehaltenen Personen und Organisationen und durch die Gleichschaltung von Einrichtungen und Organisationen, um sie auf diese Weise für das eigene Machtstreben nutzbar zu machen. Beide Strategien betrafen auch den uns hier interessierenden Bereich des Bildungswesens.
Eine wichtige Maßnahme in diesem Zusammenhang war das "Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums" vom 7.4.33. Es galt für alle Beamten des Reiches, der Länder und Kommunen. Danach konnten alle Beamten entlassen werden, die nicht über die nötige Qualifikation verfügten ("Parteibuchbeamte"); nichtarische Beamte mußten in den Ruhestand versetzt werden; Beamte, die aufgrund ihrer früheren politischen Tätigkeit keine Gewähr dafür boten, für den neuen Staat einzutreten, konnten ohne Ruhegehalt entlassen werden; Beamte konnten in eine niedrigere Gehaltsstufe versetzt werden, wenn "das dienstliche Bedürfnis" dies erforderlich machte; "zur Vereinfachung der Verwaltung" konnten Beamte vorzeitig in den Ruhestand versetzt werden. Die vagen Begründungen wie "dienstliches Bedürfnis" machten es möglich, praktisch gegen jeden Beamten vorzugehen. Mitglieder kommunistischer Parteien oder Organisationen wurden auf diese Weise entlassen. Als auch die SPD verboten wurde, mußten die Beamten, die Mitglieder dieser Partei waren, innerhalb von drei Tagen eine Erklärung abgeben, daß sie ihre Bindungen zu dieser Partei gelöst hätten. Das preußische Kultusministerium verlangte von allen seinen Beamten die Ausfüllung eines entsprechenden Fragebogens. Die Regierungspräsidenten und Oberpräsidenten mußten Dreierkommissionen einsetzen - im Volksmund "Mordkommissionen" genannt -, die von den Gauleitern mit genehmen Personen besetzt wurden; die Zusammensetzung dieser Kommissionen blieb geheim, ihre Berichte über die einzelnen Lehrer gingen an das Kultusministerium.
Aber nicht nur unter den Lehrern wurde "gesäubert". Von 527 Schulräten in Preußen wurden 115 (=22 Prozent) entlassen. Besonders hart betraf es die HfL, 60 Prozent der Lehr-
151
kräfte mußten gehen. Diejenigen Lehrer, die die Säuberungen überstanden hatten, wurden einer systematischen "Umschulung" unterworfen. Allerdings ließen sich Pläne des REM, jährlich die ganze Lehrerschaft in Schulungslagern mit der NS-Weltanschauung zu konfrontieren, schon aus Kostengründen nicht verwirklichen.
Träger der Umschulung waren das "Zentralinstitut für Erziehung" und der "Nationalsozialistische Lehrerbund" (NSLB). Das Zentralinstitut bestand schon in der Weimarer Zeit und hatte unter anderem die Aufgabe der fachlichen Weiterbildung der Lehrer aller Schularten in Kursen und Tagungen. Diese Arbeit wurde nun fortgesetzt unter besonderer Berücksichtigung der neuen Themenschwerpunkte wie Volkskunde, Rassenkunde, Heimatkunde. Diese Ausweitung weckte jedoch den Widerstand des NSLB, der die weltanschauliche Schulung für sich allein beanspruchte. Beide Träger verständigten sich 1936 über eine Aufgabenteilung: die fachliche Weiterbildung sollte das Zentralinstitut übernehmen, die weltanschauliche Schulung der NSLB. Wie jedoch in der NS-Zeit üblich, wurden solche Absprachen nicht eingehalten, der NSLB griff auch in die fachliche Weiterbildung ein, was auch deshalb nicht weiter verwunderlich ist, weil ja die "weltanschauliche Schulung" schlecht abstrakt, ohne den Bezug zu den Schulfächern erfolgen konnte. Der NSLB baute seine Schulungsarbeit schnell aus zu einem Netz von Schulungslagern. Davon gab es 41 im Jahre 1937, bis 1939 wurden davon 215.000 Mitglieder erfaßt, wobei besonders diejenigen Lehrer herangezogen wurden, die nicht Mitglieder der NSDAP waren.
Der NSLB war 1927 in Hof (Bayern) von dem Volksschullehrer Hans Schemm gegründet worden, der 1933 Kultusminister in Bayern wurde. Der Verband forderte die Beseitigung der Lehrervereine und die akademische Ausbildung der Volksschullehrer, seit 1930 auch die Einführung der Gemeinschaftsschule ( = eine nicht nach Konfessionen getrennte Volksschule) und die Beseitigung der Privatschulen. Diese Forderungen weisen darauf hin, daß der NSLB durch die Volksschullehrerschaft bestimmt wurde. Er hatte 1932 erst 6.000 Mitglieder, und nach der Machtergreifung erwies es sich als schwierig, die "Einheitsfront aller Erzieher" in einer einheitlichen Lehrerorganisation durchzusetzen, also die anderen Lehrerverbände gleichzuschalten. Eine besondere
152
Schwierigkeit war steuerlicher Art: bei einer Überführung anderer Verbände in den NSLB wären hohe Schenkungssteuern angefallen. So betrieb Schemm eine korporative Lösung: er gründete im Mai/Juni 1933 die "Deutsche Erziehergemeinschaft" (DEG), der 44 Verbände beitraten. Diese Gründung war insofern ein Trick, als diese Verbände davon ausgingen, daß sie sich im Rahmen eines Dachverbandes befänden, im übrigen aber weiterhin autonom seien. Das sah Schemm jedoch ganz anders, nämlich nur als Durchgangsstadium auf dem Weg zur Einheitsorganisation NSLB. Er versuchte nun, die Mitglieder der anderen Verbände abzuwerben, und Mitglieder des NSLB übten dabei unter Ausnutzung ihrer amtlichen Stellung großen Druck auf einzelne Lehrer aus. Nachdem mehrere Verbände sich daraufhin bei ihrem "Dienstherrn", Innenminister Frick, beschwerten (das REM war noch nicht gegründet), verbot dieser alle Angriffe auf die Lehrerverbände und jede Benachteiligung ihrer Mitglieder. Immerhin war die Mitgliederzahl des NSLB von Ende 1932 bis Ende 1933 von 6.000 auf 220.000 gestiegen. Die Lage änderte sich durch die Einrichtung des REM als Ausgliederung aus dem Innenministerium. Rust setzte die Politik Fricks nicht fort, der die Macht des NSLB begrenzen wollte. Er duldete z.B. eine scharfe Kampagne des NSLB gegen den Philologenverband, wozu auch gehörte, daß die Schulbehörden den Lehrern verboten, an Veranstaltungen des Philologenverbandes teilzunehmen. Anfang 1935 wurde das "Deutsche Philologenblatt" verboten, wodurch die Verbandsarbeit praktisch zum Erliegen kam. Der Widerstand des Philologenverbandes war weniger weltanschaulich-ideologischer Art als vielmehr verbandspolitisch bestimmt. Als Verband der Gymnasiallehrer wollte er Distanz zu den Volksschullehrerverbänden wahren, zumal deren Kernforderungen sich gegen sein Selbstverständnis und gegen seine Interessen richteten. Eine Nivellierung der Lehrerschaft, wie sie in der Forderung nach akademischer Ausbildung für alle Lehrer zum Ausdruck kam, wurde als Angriff auf die herausgehobene Position der Gymnasiallehrer betrachtet. Gegenüber einigen kleineren konfessionellen Lehrervereinen, die Ende 1934 noch selbständig waren, wandte der NSLB einen Kunstgriff an, den auch die HJ zeitweilig benutzte: er verbot die Doppelmitgliedschaft im NSLB und in einem anderen Lehrerverein. Daraufhin lösten sich diese Vereine entweder auf, oder gaben ihren Charakter
153
als Standesorganisationen zugunsten einer religiösen Gemeinschaft auf.
Nach dem Tode von Hans Schemm - er kam 1935 bei einem Flugzeugabsturz ums Leben - übernahm Fritz Wächtler - Thüringischer Volksbildungs- und Innenminister und ebenfalls ein Volksschullehrer - den NSLB. Er klärte in Verhandlungen mit dem Finanzminister die Möglichkeit einer steuerfreien Übergabe des Vereinsvermögens der anderen Verbände beim Übertritt in den NSLB. Die de jure innerhalb des NSLB noch selbständigen Lehrervereine wurden aufgelöst. Wächtler wollte das Vermögen möglichst aller Lehrervereine in die Hand bekommen, was ihm nicht durchweg gelang. Der Philologenverband z.B. hatte sein Vermögen wissenschaftlichen Institutionen vermacht und konnte mit Unterstützung des REM dem NSLB seine Gelder bis auf einen kleinen Rest vorenthalten (Eilers, 84). Nun war der NSLB zur Nachfolgeorganisation der alten Lehrerverbände geworden. Dabei hatte er aber auch deren Fonds und Selbsthilfeeinrichtungen übernommen, für die die Mitglieder der nun vereinnahmten Vereine ihre Beiträge gezahlt hatten. In den Genuß dieser Sozialmaßnahmen konnte künftig aber nur noch kommen, wer Mitglied des NSLB wurde und blieb. Bei Austritt oder Ausschluß verfielen diese Rechte. Wächtler wehrte sich wie Rust hartnäckig gegen die Abschaffung der akademischen Lehrerbildung, was ihm in der Parteiführung den Vorwurf "gewerkschaftlichen Verhaltens" eintrug. Im November 1941 wurde der NSLB durch den Schatzmeister der NSDAP unter Zwangsverwaltung gestellt, weil offensichtlich seine finanziellen Verhältnisse unübersichtlich geworden waren. Am 2.3.43 wurde seine Arbeit aus kriegsbedingten Gründen gegen den Widerstand Wächtlers stillgelegt. Er war eine der nutzlosesten NS-Organisationen.
"In seinem immensen leeren Aktivismus hat er wesentlich zur Aushöhlung der Schulerziehung beigetragen, indem er die pädagogische Diskussion lähmte und die Lehrerschaft für Aktionen, Programme und Einsätze in Dienst nahm" (Eilers, 134).
154
Kritisches Resümee
155
Man kann darüber spekulieren, ob etwa nach einem gewonnenen Kriege dieser pluralistische Totalitarismus, der ja immerhin gewisse Handlungsspielräume offenließ, weiter bestehen geblieben wäre. Nach der Logik eines solchem Systems pflegen sich auf Dauer nur einige wenige Personen bzw. Institutionen durchzusetzen. Man darf nicht vergessen, daß der Hauptgrund für die Pluralität darin bestand, daß 1933 Personen mit teilweise sehr unterschiedlichen Motiven und Zielvorstellungen zur "Bewegung" gestoßen waren die ihrerseits diese unterschiedlichen Vorstellungen aus dem national-konservativen Spektrum der Zeit davor gebündelt hatte, aber auf die Dauer wären diese Unterschiede wohl nach den Regeln des Sozialdarwinismus beseitigt worden.
2. Eine besondere Rolle spielten einige NS-Organisationen, die nach der Machtergreifung eigentlich überflüssig geworden waren. Alle NS-Organisationen - ob SA, Studentenbund, HJ, NSLB - die vor 1933 gegründet wurden, hatten zunächst nur eine Aufgabe: Anhänger und Wähler zu mobilisieren und so die Machtergreifung vorzubereiten. Nachdem dies nun gelungen war, waren Organisationen wie die SA oder der NSLB zunächst einmal aufgabenlos. Aber sie lösten sich nicht etwa auf - was gerade für die SA eigentlich nach der "Röhm-Affäre" nahegelegen hätte -, sondern suchten sich neue Aufgaben und fanden sie unter anderem in der "weltanschaulichen Schulung". Das galt in besonderem Maße auch für den NSLB: Er hatte die zahlreichen Lehrervereine, die es vor 1933 gab, aufgesogen und aufgelöst. Da er selbst aber keine Standesinteressen mehr vertreten durfte - was der hauptsächliche Zweck der alten Lehrervereine gewesen war -, blieb ihm wenig mehr als die "weltanschauliche Schulung" für möglichst alle möglichst oft.
Diese "Schulung", wie sie dann tatsächlich stattfand, nämlich mit ständiger Tendenz zur Expansion, war also keine irgendwie "von oben" angeordnete Dauereinrichtung, sondern gehört in den Zusammenhang der eben beschriebenen Tat-Philosophie, des ständigen "Einsatzes" als Selbstzweck. Die "weltanschauliche Schulung" resultierte also insofern aus dem Handlungsbedürfnis überflüssig gewordener Verbände, und da diese Verbände relativ machtlos waren, kompensierten sie dies mit besonderem Aktivismus - gelegentlich auch Fanatismus - auf diesem neuen Tätigkeitsfeld.
156
3. Auf der anderen Seite brachten sich in der Bildungspolitik die alten bzw. neuen Machteliten zur Geltung. Dazu sind die Wirtschaftselite, die Bildungselite und vor allem die neue militärische Elite zu rechnen. Sie waren überwiegend konservativ-nationalorientiert, dem Nationalsozialismus selten weltanschaulich fanatisch verbunden, sondern eher insofern, als er nationale Machtpolitik betrieb. Von diesen Kreisen ging eine leistungs- und technokratisch orientierte Erwartung an das Bildungswesen aus, das den bewußten, gewiß weltanschaulich disziplinierten, aber in erster Linie fachlich qualifizierten Nachwuchs hervorbringen sollte. Ihr Interesse konzentrierte sich naturgemäß auf die höhere Bildung und also auch auf die Oberschule und die Hochschulen, und vielleicht ist dies ein Grund dafür, daß dem Volksschulwesen weit weniger Beachtung geschenkt wurde.
4. Sieht man von den politisch-ideologischen und machtpolitischen Zusammenhängen ab, wie sie eben erwähnt wurden, dann werden allerdings auch Sachzwänge erkennbar, denen sich die NS-Bildungspolitiker gegenüber sahen. Dazu gehörten eine Reihe von Problemen, die sie vorfanden und deren Lösung bzw. Nicht-Lösung man von heute aus auch rein fachlich erörtern kann, zumal es sich ja dabei um einen Teil der Vorgeschichte unseres gegenwärtigen Bildungswesens handelt.
a) Die Vereinheitlichung der Oberschulen auf drei Typen für Jungen und zwei für Mädchen läßt sich sachlich durchaus rechtfertigen - allerdings nur mit der Einschränkung, daß die Benachteiligung der Mädchen - die dann, wie das Beispiel der weiblichen Studienassessoren zeigt, später korrigiert werden konnte - ideologisch bedingt war. Eine Vereinheitlichung war abgesehen davon schon im Hinblick auf ein modernes Berechtigungswesen und im Hinblick auf berufliche Mobilität im ganzen Reichsgebiet nötig. Damit wurde zwar eine bunte Vielfalt geschichtlich entstandener Formen und Variationen beseitigt, aber es handelte sich dabei doch auch teilweise um einen Wildwuchs, der für die Bevölkerung nicht mehr durchschaubar war. Allerdings hat diese Maßnahme bis heute ein sehr vereinheitlichtes, staatsmonopolistisches Schulwesen zur Folge, und man kann mit vergleichendem Blick auf andere westliche Industriegesellschaften wie England und USA durchaus fragen, ob Modernität wirklich nur so realisiert werden kann, oder ob uns eine größere Vielfalt von Schulkonzepten, die untereinander in Wettbewerb stünden, nicht gut täte.
157
b) Auch die Beseitigung der Konfessionsschulen zugunsten der konfessionsneutralen Gemeinschaftsschulen stand nicht nur aus ökonomischen Gründen auf der Tagesordnung. Die Argumente, die Krieck schon in der Weimarer Zeit gegen die Konfessionsschulen ins Feld geführt hatte, waren nicht mehr zu übergehen. Auf einem anderen Blatt stehen natürlich die Methoden, mit denen dann die Gemeinschaftsschule durchgesetzt wurde. Aber man mußte wahrlich kein Nazi sein, um einer konfessionellen Spaltung dieser Art ein Ende bereiten zu wollen, die vor allem in der Weimarer Zeit viel zur innenpolitischen Polarisierung beigetragen hatte und für die es eigentlich keine plausible pädagogische Begründung mehr gab. Konfessionsschulen waren vielmehr nur solange einleuchtend, wie die entsprechenden kirchlichen Milieus eine gewisse Geschlossenheit aufwiesen, so daß außerschulische Lebenswelt der Kinder und schulische Orientierung einigermaßen übereinstimmten. Spätestens aber nach dem Ersten Weltkrieg zerbrachen diese Milieus, und die Hartnäckigkeit, mit der die Kirchen, vor allem die katholische, in der Weimarer Zeit sich für ihre konfessionelle Bildungspolitik engagierten, verrät, daß sie sich längst in der Defensive befanden. Die Stabilität solcher Milieus setzt nämlich unter anderem das Fehlen von weltanschaulicher Pluralität und von Mobilität voraus. Gewiß waren diese Entwicklungen unterschiedlich weit gediehen, in den großen Städten z.B. weiter fortgeschritten als auf dem Lande, in evangelischen Regionen weiter als in katholischen, aber tendenziell waren sie nicht mehr zurückzudrängen unter den Bedingungen einer modernen Industriegesellschaft. Insofern wäre die Kritik an den "völkischen" Vorstellungen bei Krieck hier sinngemäß zu wiederholen. Das muß dann aber auch gelten für jene andere Milieuverhaftung, die die Nationalsozialisten selbst im Sinne einer heimatlich verbundenen Volksschule restaurieren wollten; die war nicht minder unzeitgemäß.
Allerdings hätte die Einführung der überkonfessionellen Gemeinschaftsschule auch eine Befriedung der Konfessionen zur Folge haben müssen - etwa dergestalt, daß den Kirchen weiterhin Religionsunterricht in diesen Schulen zugestanden worden wäre und daß auf einen anti-kirchlichen bzw. anti-christlichen Weltanschauungsunterricht verzichtet
158
worden wäre. Eine Lösung in dieser Richtung hatte Rust wohl auch im Sinn, aber die Parteikanzlei - Hitler selbst hat die Auflösung der Konfessionsschule nie durch einen "Führerbefehl" verfügt -, also Bormann, aber auch Hess und Rosenberg stemmten sich dagegen. Sie wollten die Abschaffung nicht nur der Konfessionsschulen, sondern auch des Religionsunterrichts und setzten dies schließlich auch durch.
c)
Die
restriktiven, unter
der Panik der "Überfüllung" hastig ins Leben gerufenen
bildungspolitischen
Maßnahmen der Jahre 1933 und 1934 durch die "NC-Fraktion"
verhinderten
eine rechtzeitige Umstellung auf den von Fachleuten bereits 1934
vorausgesagten
Mangel an Facharbeitern wie an Akademikern. So verging nicht nur
wertvolle
Zeit, bis diese Einsicht die Verantwortlichen erreichte; vielmehr
dauerte
es dann auch noch eine Weile, bis die Bevölkerung, die durch die
Kassandrarufe
der Überfüllung aufgeschreckt sich der höheren Bildung
gegenüber
distanziert verhielt, nun vom Gegenteil überzeugt werden konnte.
Der
Volksschullehrermangel zeigte an, daß die Zahl der Abiturienten
auf
kurze Sicht nicht erheblich vermehrbar war, obwohl die Nachfrage nach
ihnen
bzw. nach den daraus zu erwartenden Hochschulabgängern
ständig
stieg. In dieser Lage konnte es durchaus als vernünftig
erscheinen,
die "Begabungsreserven" - wie man später in den 60er und 70er
Jahren
sagen wird - in der Volksschule zu mobilisieren, die immerhin mehr als
neunzig Prozent der Kinder besuchten. Da der Sprung zur höheren
Schule
für viele Arbeiter- und Landkinder sozio-emotional wie finanziell
zu groß war, lag es nahe, Angebote zu machen, die am
Volksschul-Abgang
anknüpften. Insofern war es - von der dahinterstehenden Ideologie
einmal abgesehen - durchaus einleuchtend, durch die Einführung der
LBA den Volksschulabgängern wieder den Weg zur Lehrerbildung zu
öffnen.
Rust versuchte dies durch Zusatzangebote unter Beibehaltung der HFL als
Norm zu erreichen und reagierte damit wesentlich flexibler als die
ideologisch
orientierte Parteikanzlei um Bormann; denn man konnte ja zumindest in
Rechnung
stellen, daß der Mangel an Abiturienten demnächst behoben
sein
könnte, so wie sich ja ab 1933 Überfüllung und Mangel
schon
einmal innerhalb weniger Jahre abgelöst hatten. Auch die
Einführung
der Hauptschule war unter dem Aspekt der Mobilisierung von
"Begabungsreserven"
so abwegig nicht, wenn man bedenkt, daß damit
159
auch das Fachlehrerprinzip eingeführt und der Allroundlehrer abgelöst wurde, der alle Fächer unterrichten mußte. Für die begabteren Volksschüler - man rechnete etwa mit einem Drittel - bot diese Schule sicher eine bessere Grundlage zur Vorbereitung auf eine solide Berufsausbildung im gewerblichen Bereich. Dafür wiederum waren die Mittelschulen insofern weniger geeignet, als ihre Absolventen in erster Linie Berufsperspektiven im kaufmännischen und mittleren Angestelltenbereich im Auge hatten.
Die Bildungspolitik der Nationalsozialisten begann unter dem Eindruck der Überfüllung mit einem radikalen "Ausleseprinzip", das ihrer sozialdarwinistischen Gesellschaftsvorstellung entgegenkam, aber schnell mußten sie erkennen, daß die Berufswelt in einer modernen Industriegesellschaft nicht nur "die Besten" benötigt, sondern auch die Zweit- und Drittbesten und überhaupt möglichst viele Menschen mit einer möglichst hohen Ausbildung. Nur eine hochentwickelte Allgemeinbildung - das wußte schon Humboldt - befähigt zur beruflichen Flexibilität und Disponibilität.
5. Der geistige Niedergang der Volksschullehrerbildung in den Kriegsjahren war nicht nur eine Folge des anti-intellektuellen Affektes vieler Nazi-Führer oder derer, die - wie Hitler selbst - Animositäten gegen den Lehrerberuf überhaupt hatten, sondern auch der permanenten Inanspruchnahme der Lehrer, Schüler und Studenten durch den inhaltslosen Aktivismus von Parteistellen. An und für sich mußte ein solcher Niedergang mit der Konzeption der LBA nicht unbedingt verbunden sein, und er ist um so bemerkenswerter, als der Bedarf der Wirtschaft nach qualifizierten Facharbeitern ständig stieg. Über den Rückgang des Niveaus der Volksschulabgänger gab es schon früh Klagen. So kam 1937 eine Untersuchung des NSLB zu dem Ergebnis, daß die Volksschulen "seit vier Jahren von Jahr zu Jahr in ihren Leistungen zurückgehen". Ein Jahr später war in einer weiteren Denkschrift davon die Rede, daß "das Bildungsniveau der Schule nicht mehr dem Stand vor 1933 entspricht". Bemerkenswert ist, daß als Gründe dafür die Beanspruchung der Schüler durch die HJ und der Lehrer durch Parteiaufgaben genannt werden. Ende 1942 teilte die Industrie- und Handelskammer Münster mit, daß "54,37 Prozent der Berufsanfänger im Deutschen und 58,45 Prozent im Rechnen den Anforderungen nicht genügen, die die Wirtschaft im Durchschnitt an
160
Lehrlinge und Anlerninge stellen muß" (zit. n. Ottweiler 1980,212).
Allerdings spielte wohl auch eine Rolle, daß das Konzept der Volksschullehrerbildung in sich selbst eine besondere Anfälligkeit für ideologische Indoktrinationen enthielt. Bei der alten Seminarausbildung vor dem Ersten Weltkrieg, wie sie Ernst Krieck noch erlebt hatte, war das offensichtlich; denn sie wirkte obrigkeitlich disziplinierend auf die angehenden Lehrer mit dem Ziel, diese Haltung und Gesinnung auch auf die Schüler zu übertragen. In gewisser Weise fand sich dieser Geist in den LBA wieder. Aber auch die "Pädagogische Akademie", wie sie in Preußen in der Weimarer Zeit etabliert wurde, blieb ihrer ganzen Konstruktion nach ideologisch anfällig. Diese Gefahr resultierte vor allem aus der Verbindung des Unterrichts mit bestimmten Erziehungszielen. Die Volksnähe und Heimatverbundenheit, die auch damals schon vom Volksschullehrer erwartet wurden, war ja nichts Naturwüchsig-Selbstverständliches oder ein Resultat wissenschaftlicher Erkenntnisse, sondern wurde nur greifbar im Rahmen einer im Prinzip beliebigen Definition, und die konnte nur eine ideologische bzw. weltanschauliche sein. Und sie war leicht austauschbar. Die "Pädagogische Akademie" war nur wissenschaftsorientiert, nicht, wie das Universitätsstudium der Studienräte, wissenschaftlich fundiert. Das hieß im Klartext, daß die Wissenschaft im Rahmen dieser Akademie-Ausbildung nur eine instrumentelle Bedeutung hatte, keine intellektuell disziplinierende. Sie wurde gleichsam nur "abgemolken" im Hinblick auf Erziehungs- bzw. Selbsterziehungsziele, um die es in der Ausbildung eigentlich ging. Dieser Geist wurde dann auch auf den Unterricht in der Volksschule übertragen, er diente nicht einfach der Aufklärung des Kindes über seine Welt, sondern der Herausbildung eines erwünschten Verhaltens, einer Gesinnung, einer Einstellung. Derartige erzieherische Programmierungen sind aber austauschbar, und es gibt dann - außer vielleicht einer moralischen - keine Instanz bzw. kein Kriterium mehr, das zur Abwehr eines solchen Ansinnens geeignet wäre. Räsonieren läßt sich dann nur noch über "bessere" und "schlechtere" Erziehungsziele. Warum also sollte es auf diesem Hintergrund nicht als plausibel erscheinen, daß die Nationalsozialisten nun die auch schon vorher gewünschte "Volksnähe" weltanschaulich für die Volksschulen präzisier-
161
ten, sie auf Führer, Volk und Nation bezogen und ihr einen Touch ins Heroische gaben, wie es in den Richtlinien von 1939 zum Ausdruck kommt?
Die wissenschaftliche Ausbildung bietet immerhin die Möglichkeit der methodischen Disziplinierung. Auch sie schützt nicht unbedingt vor Ideologisierung und Indoktrination, wie gerade die Wissenschaft im Nationalsozialismus allenthalben gezeigt hat. Aber sie vermag noch am ehesten eine unmittelbare Instrumentalisierung von Sachen und Menschen zu relativieren. Es ist also die erzieherische Intention als solche, die Aufklärung durch Unterricht nicht als Selbstzweck zu sehen vermag, sondern sie bestimmten Zwecken unterwirft, die das Tor öffnet für ideologische Okkupationen. Welche das dann sind, ist eine reine Machtfrage.
6.
Wenigstens mit
einem kurzen
Hinweis muß zum Abschluß dieses Kapitels daran erinnert
werden,
daß die deutschen Schüler jüdischer Abstammung Zug um
Zug
aus dem öffentlichen Schulwesen verdrängt wurden. Ende 1938,
nach dem Pogrom, durfte kein jüdischer Schüler mehr eine
deutsche
Schule besuchen. Die jüdischen Gemeinden wurden somit gezwungen,
durchweg
auf eigene Kosten ihr Privatschulwesen entsprechend zu erweitern. "Im
Jahre
1933 gingen von 60.000 jüdischen Schülern 15.000, also 25 %,
auf jüdische Schulen. Im Jahr der Nürnberger Rassengesetze
1935
besuchten 45 % von insgesamt 44.000 jüdischen Schülern die
ca.
130 jüdische Schulen. 1937 erreichte die Schülerzahl in
jüdischen
Schulen ihren Höchststand mit 23.670 schulpflichtigen
jüdischen
Kindern (61 %)" (Scharf, 1). Am 1. Juli 1942 wurden die jüdischen
Schulen auf Anordnung der deutschen Behörden geschlossen - die
"Endlösung"
nahm Gestalt an.
162
5. Der volksgemeinschaftliche Jugendstaat: Die Hitler-Jugend
Er wurde am 9.5.1907 als jüngstes von vier Geschwistern in Berlin geboren. Ein Jahr später übernahm sein Vater Carl die Leitung des Großherzoglichen Hoftheaters in Weimar, nachdem er zuvor im Königlich Preußischen Garde- Kürassier-
163
Regiment gedient hatte, das er als Rittmeister verließ. Baldurs Mutter war Amerikanerin, die zeitlebens die deutsche Sprache mehr schlecht als recht beherrschte und deshalb Englisch zur Muttersprache ihrer Kinder machte, so daß Baldur noch mit 6 Jahren kaum deutsch konnte.
Da die Schirachs über genügend privates Vermögen verfügten, konnten sie sich in Weimar einigermaßen repräsentativ einrichten. Materielle Not war kein Erlebnis, das den Sohn Baldur hätte prägen können, so daß er auch später zu den sozial-revolutionären Tendenzen der HJ und des NS-Studentenbundes von sich aus zunächst keinen Zugang fand.
Prägend wurden für ihn aber zwei Schicksalsschläge innerhalb der Familie. Nach dem Krieg wurde sein Vater aus dem Amt des Intendanten entlassen, und im Oktober 1919 erschoß sich sein älterer Bruder Karl, an dem er sehr gehangen hatte und der ihm in vieler Hinsicht Vorbild gewesen war. Als Grund für seinen Selbstmord gab der Bruder das "Unglück Deutschlands" an, das ihn persönlich insofern betraf, als ihm durch den Versailler Vertrag die ersehnte Offizierslaufbahn verschlossen war. Beide Ereignisse haben wohl Schirachs Republikfeindschaft wesentlich mitbestimmt.
Das kulturelle Leben Weimars war damals stark antisemitisch orientiert, und als 17jähriger las Schirach die entsprechende Literatur. Vor allem Hitlers "Mein Kampf` - 1925 erschienen -verschlang er in einem Zuge. Hitler selbst lernte er ebenfalls im Jahre 1925 in Weimar kennen, er war von ihm fasziniert, wurde von nun an sein kritikloser Gefolgsmann und trat im selben Jahr in die NSDAP ein.
Für sein späteres Konzept der HJ waren wohl auch die Erfahrungen bedeutsam, die er einige Jahre als Schüler des "Waldpädagogium" in Bad Berka machen konnte; diese Schule war nach den pädagogischen Leitmotiven des Reformpädagogen Hermann Lietz gestaltet: neben der Wissensvermittlung sollte die körperliche und charakterliche Bildung zum Zuge kommen, den Schülern wurde Mitbestimmung zugestanden, das Lehrer-Schüler-Verhältnis war kameradschaftlich gehalten, Lehrer und Schüler verkehrten per Du miteinander - eine Anrede, die Schirach später auch in die HJ einführte.
Im Frühjahr 1927 begann er sein Studium in München, um in Hitlers Nähe zu sein; er interessierte sich unter anderem für
164
Germanistik, Anglistik und Kunstgeschichte, aber zu einem Abschluß kam es nicht, weil er sich sofort politisch betätigte. Er stieß zum "Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund" und wollte mit ihm die Studenten für Hitler gewinnen. Aber Hitler blieb zunächst skeptisch, weil er nicht glaubte, daß diese "Intellektuellen" für seine Bewegung im nennenswerten Maß zu gewinnen seien. Nur widerwillig und nur unter der Bedingung, daß der Saal gefüllt sein müsse, gab er Schirachs Drängen nach, vor Studenten in München zu sprechen. Nachdem dieser erste Auftritt vor einem derartigen akademischen Publikum für Hitler sehr erfolgreich verlaufen war, setzte Schirach seinen ganzen Ehrgeiz daran, seinen Teil zur Machtergreifung beizutragen. 1928 trat er an die Spitze des NS-Studentenbundes, und es gelang ihm, mit einer Serie von Wahlerfolgen bis zum Sommer 1931 die Mehrheit im Rahmen der deutschen Studentenschaft zu gewinnen. So wenig wie er selbst den NS-Studentenbund gegründet hatte, war er der Initiator der HJ. Im Jahre 1931 gab es sie längst, ihr Führer hieß Kurt Gruber, aber sie fand in der Gymnasialjugend wenig Resonanz. Kaum besser erging es dem 1929 gegründeten "NS-Schülerbund" unter Adrian von Renteln; auch er stagnierte.
Am 30.10.1931 ernannte Hitler den - nunmehr 24jährigen - Schirach zum "Reichsjugendführer der NSDAP", ein Jahr später übernahm er auch persönlich die HJ und gliederte ihr den Schülerbund ein. Sein Ziel war, möglichst rasch diese Jugendorganisation auszubauen - immer im Hinblick auf die erwartete Machtübernahme Hitlers.
Mit einem Schlage gelang es Schirach, die HJ aus ihrer Kümmerexistenz herauszuführen, als er sie am 1. und 2. Oktober 1932 zum "Reichsjugendtag" nach Potsdam rief. Mit 40.000 Teilnehmern aus dem ganzen Reich hatten die Veranstalter gerechnet, aber bis zum Abend des 1. Oktober - einem Sonnabend - kamen ca. 70.000, zu denen Hitler in einer nächtlichen Kundgebung im Stadion sprach. Am darauf folgenden Sonntag marschierten etwa 100.000 Jungen und Mädchen siebeneinhalb Stunden lang an Hitler vorbei - dreimal mehr, als die HJ damals Mitglieder zählte.
Die Idee, auf diese Weise eine Jugendorganisation öffentlichkeitswirksam in Szene zu setzen, stammte nicht von Schirach. Erfunden und praktiziert hatte sie die Sozialisti-
165
sche Arbeiterjugend (SAJ), die Jugendorganisation der SPD. Ihre "Reichsjugendtage" standen jeweils unter einem Motto und fanden zum ersten Male 1920 in Weimar ("Das Weimar der arbeitenden Jugend") und 1931 ("Gegen den Krieg") zum letzten Mal in Frankfurt statt. Mehr als 30.000 Teilnehmer konnte die SAJ allerdings nie mobilisieren.
Bis zur Machtergreifung Hitlers ging es Schirach nur darum, zunächst die Studenten und dann einen möglichst großen Teil der übrigen Jugend für die "Bewegung" zu gewinnen. Irgendwelche darüber hinausgehenden pädagogischen Ziele oder Konzepte sind in dieser Zeit nicht erkennbar. Sie gewinnen vielmehr erst nach der Machtergreifung allmählich Konturen.
Schirachs Bindung an Hitler war inzwischen auch privat enger geworden. Im Jahre 1932 hatte er Henriette Hoffmann geheiratet, die Tochter von Heinrich Hoffmann, der als Hitlers "Leibfotograf" zu seiner engsten Umgebung gehörte.
Am 17.6.33 - also nach der Machtübernahme - ernannte Hitler den jetzt 26jährigen Schirach zum Jugendführer des Deutschen Reiches". Nun stand er an der Spitze aller Jugendverbände, Neugründungen mußten von ihm genehmigt werden. Am 1.12.1936 wurde das Hitlerjugend-Gesetz erlassen; es etablierte die HJ als eigenständige Erziehungsinstanz neben Elternhaus und Schule, die "Reichsjugendführung" wurde obere Reichsbehörde mit Schirach als Staatssekretär und einigen wenigen weiteren Beamten. Dennoch wurde die HJ nicht im strengen Sinne Staatsjugend, sondern blieb eine Gliederung der Partei, Schirach wurde Hitler unmittelbar unterstellt. Die HJ stand nun gewissermaßen auf zwei Beinen. Als Reichsbehörde war sie eingebunden in den Staatsapparat und konnte in diesem Rahmen tätig werden. Als Gliederung innerhalb der Partei blieb sie Parteijugend und finanziell abhängig vom Schatzmeister der NSDAP.
Nach Kriegsausbruch bat Schirach Hitler, sich freiwillig zur Wehrmacht melden zu dürfen. Nach anfänglichem Zögern stimmte Hitler Anfang 1940 zu, aber schon im August dieses Jahres holte er ihn zurück und machte ihn zum Gauleiter und Reichsstatthalter in Wien. Sein Nachfolger als Reichsjugendführer wurde auf seinen Vorschlag hin Artur Axmann, der das Sozialreferat der HJ geleitet und unter anderem den "Reichsberufswettkampf" initiiert hatte; er war freiwillig zur
166
Wehrmacht gegangen, aber mit einer Kriegsverletzung (Verlust eines Armes) wieder an die "Heimatfront" zurückgekehrt. Schirach blieb aber der HJ verbunden, insofern Hitler ihn zum "Beauftragten für die Inspektion der gesamten HJ' ernannte.
In Wien gelang es ihm, eine beachtliche kulturelle Aktivität zu entfalten; er holte namhafte Künstler (wieder) in die Stadt, die in seinem Hause ein- und ausgingen. Sein Verständnis von moderner Musik und Kunst war weitaus liberaler und toleranter, als es dem Geschmack der Parteigrößen und auch Hitler sonst entsprach. Als er 1943 eine Kunstausstellung mit Arbeiten junger Künstler zuließ, von denen einige den Maßstäben "entarteter Kunst" nahekamen, zitierte ihn Hitler wütend zu sich. Er zeigte ihm eine Ausgabe der HJ-Zeitschrift "Wille und Macht", die einige der Arbeiten reproduziert hatte; besonders ärgerlich war Hitler über einen grün gemalten Hund. Die Ausstellung mußte geschlossen werden. Schirach hielt irrtümlich den Dissens zu Hitler in Kunstfragen für generationsbedingt, in Reden hatte er mehrfach betont, daß Kunst mehr und anderes sei als das Abfotografieren der Wirklichkeit.
Das Jahr 1943 brachte ihn auch aus anderen Gründen in Ungnade bei Hitler. Schon bei Kriegsausbruch war Schirach skeptisch im Hinblick auf den militärischen Erfolg. Der Angriff auf die Sowjetunion bestärkte bei ihm diesen Eindruck. Spätestens seit dem Kriegseintritt der Amerikaner war er davon überzeugt, daß der Krieg nicht mehr zu gewinnen sei. Deshalb forderte er eine Änderung der Besatzungspolitik in den Ostgebieten mit dem Ziel, den dort lebenden Völkern eine relative Autonomie zu gewähren und sie so zum Kampf gegen den Bolschewismus zu gewinnen; dafür sollten auch die Amerikaner motiviert werden. Schirach hatte diese Überlegungen Hitler in einem Brief mitgeteilt, sie aber auch im Kreise seiner Vertrauten geäußert. Abgesehen von der Frage, ob solche Überlegungen - jedenfalls im Hinblick auf die USA - politisch überhaupt eine Chance gehabt hätten, wußte Schirach noch nicht, daß Hitler mit der längst begonnenen Ermordung der europäischen Juden alle Brücken für diplomatische Alternativen abgebrochen hatte. Insofern hatte Hitler nicht unrecht, wenn er anläßlich einer Tafelrunde auf dem Berghof - Ostern oder Fronleichnam 1943, das ist umstritten - Schirach anherrschte, er solle sich nicht
167
um Dinge kümmern, von denen er nichts verstehe. Als seine Frau Henriette bei dieser Gelegenheit auch noch die Judendeportationen zur Sprache brachte, die sie aus einem Hotel in Amsterdam beobachtet hatte - in der Hoffnung, Hitler würde für eine würdevollere Behandlung sorgen -, fragte Hitler sie wütend, was sie denn diese "Judenweiber" angingen. Seit diesem Tag entstand eine Distanz zwischen Schirach und Hitler, die sich zunehmend vergrößerte.
Hitlers Völkermord an den Juden sollte auch Schirach zum Verhängnis werden. Als er Gauleiter von Wien wurde, gab es dort noch etwa 60.000 Juden. Diese sollte er nach Hitlers ausdrücklichem Willen in den Osten deportieren lassen, für das Verfahren selbst sei Himmler zuständig. Schirach ging zunächst davon aus, daß es sich dabei um eine Umsiedlung handele in Gebiete, wo die Juden dann relativ autonom würden leben können. Diese Einschätzung ist insofern glaubhaft, als Schirachs Antisemitismus - den er auch später im Nürnberger Kriegsverbrecherprozeß nicht ableugnete - kein rassistischer, sondern ein kultureller war, wie wir ihn bei Krieck schon kennengelernt haben: wie das deutsche Volk so sollte auch das jüdische einen eigenen Lebensraum haben, in dem es nach seinen eigenen kulturellen Maßstäben leben konnte. Eine Vermischung der Völker jedoch sei abzulehnen. Diese völkisch-nationalistische Position war auch vor 1933 unter normalen "gebildeten" Deutschen weit verbreitet. Der Gedanke einer physischen Vernichtung war damit nicht verbunden, er konnte vielmehr nur auf dem Hintergrund einer biologistisch-rassistischen Grundannahme sich entfalten, wie sie Hitler vertrat und ernst meinte.
Von solchen Vorstellungen war Schirach weit entfernt. Das zeigte sich u.a. darin, daß er schon 1933 der HJ die Lektüre des "Stürmer" verbot - des von Julius Streicher herausgegebenen antisemitischen Hetzblattes. Als 1938 - von Goebbels inszeniert - die SA den Pogrom gegen die in Deutschland lebenden Juden beging, drohte Schirach jedem HJ-Führer den Rausschmiß an, der sich daran beteiligte. Schirach hielt die ganze Sache für ein Bubenstück von Goebbels und glaubte ernsthaft, daß damit dessen Karriere beschädigt werde.
Was wirklich mit den Juden geschah, auch mit denen, die er aus Wien deportieren ließ, erfuhr Schirach zum ersten Mal am 15. Mai 1942. Routinemäßig hatte er den Gauleiter des
168
Warthegaues" (das Gebiet um Posen, das von deutschen Truppen erobert worden war und als deutsches Gebiet reklamiert wurde) Arthur Greiser eingeladen, vor den oberen Parteifunktionären Wiens über seine Arbeit zu berichten. Greiser schilderte nun das Verfahren, die Juden auf abgedichteten Lastwagen zu verladen und sie während der Fahrt zum Massengrab durch die eingeleiteten Abgase zu töten. Endgültige Klarheit verschaffte ihm dann die berühmt-berüchtigte Rede Himmlers vor den Gauleitern in Posen im Oktober 1943, in der dieser das Programm der "Endlösung" ungeschminkt vortrug und die Ermordung von Frauen und Kindern damit rechtfertigte, daß man künftiger Rache entgegenwirken müsse. Nun war Schirach zum Mordkomplizen geworden.
Als die Rote Armee Wien besetzte, setzte er sich ab und hielt sich unter falschem Namen als vorgeblicher Schriftsteller versteckt; die Alliierten hielten ihn für tot. Als er jedoch erfuhr, daß die Alliierten im Nürnberger Prozeß die HJ als "verbrecherische Organisation" (wie die SS) anklagen wollten und deshalb damit begannen, die höheren HJ-Führer zu verhaften, stellte er sich den Amerikanern. Es gelang ihm, das Gericht davon zu überzeugen, daß die HJ keine verbrecherische Organisation gewesen sei und auch nicht kriegsvorbereitend gewirkt habe. Verurteilt zu zwanzig Jahren Haft wurde er nicht wegen der HJ, sondern wegen "Verbrechen gegen die Menschlichkeit". Dazu zählte das Gericht seine Mitverantwortung an der Deportation der Juden, vor allem aber einige antisemitische Reden, die er in Wien gehalten hatte.
Schirach erklärte diese Äußerungen damit, daß er wegen seiner politisch angeschlagenen Position sich nach Berlin hin habe absichern müssen. So hatte er im September 1942 - ein halbes Jahr nach der Rede Greisers, die die Ermordung der Juden beschrieben hatte - die Vertreter faschistischer Jugendorganisationen aus dreizehn europäischen Ländern nach Wien eingeladen, um mit ihnen einen europäischen Jugendverband zu gründen. Das Vorhaben stieß in Berliner Parteikreisen auf Ablehnung und auch Hitler verhielt sich reserviert. In Schirachs Eröffnungsrede am 14.9.42 findet sich nun folgende Passage:
"Die Nachkriegszeit war für ganz Europa eine Epoche skrupelloser jüdischer Geldgeschäfte, eine Hoch-Zeit des jüdi-
169
schen Schiebertums. Damals hat das Judentum mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln versucht, die gesunde Jugend zu verderben. Alle Ideale, die unserem Kontinent heilig sind, wurden öffentlich beschmutzt, lächerlich gemacht und als unzeitgemäß verworfen. Durch die korrupten Gazetten kursierte das jüdische Wort: 'Es gibt kein dümmeres Ideal als das des Helden'. Der jungen Generation wurde dafür schrankenlose Freiheit im sexuellen Genuß gepredigt. Je grauer der Alltag wurde, um so strahlender entwickelte sich das Nachtleben. Der amerikanische Film und die amerikanische Revue, drüben von Juden geschaffen, hier von Juden importiert, appellierten immer von neuem an die Sinne halbwüchsiger junger Menschen, diese verderbend und in den Strudel des Chaos hineinziehend, aus dem sie nie mehr zu ihrer Nation zurückgekehrt sind. Wo immer der Jude versucht hat, ein Volk in seiner nationalen Substanz zu verletzen, hat er das durch die Erweckung der niedrigsten Instinkte, durch die Propagierung einer ungezähmten Geschlechtsgier und Verächtlichmachung jeder sittlichen und ethischen Zucht getan ... . Jeder Jude, der in Europa wirkt, ist eine Gefahr für die europäische Kultur! Wenn man mir den Vorwurf machen wollte, daß ich aus dieser Stadt, die einst die europäische Metropole des Judentums gewesen ist, Zehntausende und Aberzehntausende von Juden ins Getto abgeschoben habe, muß ich antworten, ich sehe darin einen aktiven Beitrag zur europäischen Kultur" (Zit. n. Wortmann, 212).
Als einziger Angeklagter in Nürnberg distanzierte er sich unmißverständlich von Hitlers Nationalsozialismus und vom Antisemitismus; er hatte nämlich durch den Zeugen Rudolf Höß - Kommandant des KZ in Auschwitz - nun auch noch die technischen Details über die Massenmorde erfahren. Unter dem Eindruck dieser Zeugenaussage erklärte er vor dem Gericht:
"Es ist der größte und satanischste Massenmord der Weltgeschichte... . Es ist ein Verbrechen, das jeden Deutschen mit Scham erfüllt. Die deutsche Jugend trägt daran keine Schuld. Sie dachte antisemitisch, aber sie wollte nicht die Ausrottung des Judentums. Sie wußte und ahnte nichts davon, daß Hitler diese Ausrottung durch tägliche Morde an Tausenden von unschuldigen Menschen durchführte. Die jungen Menschen, die heute ratlos zwischen den Trümmern ihrer Heimat stehen, haben von diesen Verbrechen nichts gewußt und haben sie nicht gewollt. Sie sind unschuldig an dem, was Hitler dem jüdischen und dem deutschen Volk angetan hat... . Ich habe diese Generation im Glauben an Hitler und in der Treue zu ihm erzogen. Die Jugendbewegung, die ich aufbaute, trug seinen Namen. Ich meinte, einem Führer zu dienen, der unser Volk und die Jugend groß, frei und glücklich machen würde. Mit mir haben Millionen junger Menschen das geglaubt und haben im Nationalsozialismus ihr Ideal gesehen. Viele sind dafür gefallen. Es ist meine Schuld, die ich fortan vor Gott, vor meinem deutschen Volk und vor unserer Nation trage, daß ich die Jugend dieses Volkes für einen Mann erzogen habe, den ich lange, lange Jahre als Führer und als Staatsoberhaupt als unantastbar ansah, daß ich für ihn eine Jugend bildete, die ihn so sah wie ich. Es ist meine Schuld, daß ich die Jugend erzogen habe für einen Mann, der ein millionenfacher Mörder gewesen ist. Ich habe an diesen Mann geglaubt, und das ist alles, was ich zu meiner Entlastung und zur Erklärung meiner Haltung sagen kann. Diese Schuld ist aber meine eigene und meine persönliche. Ich trug die Verantwortung für die Jugend. Ich trug den Befehl für sie und so trage ich auch allein für diese Jugend die Schuld. Die junge Generation ist schuldlos. Sie wuchs auf in einem antisemitischen Staat mit antisemitischen Gesetzen. Die Jugend war an diese Gesetze gebunden, sie verstand deshalb unter Rassenpolitik nichts Verbrecherisches. Wenn aber auf dem Boden der Rassenpolitik und des Antisemitismus ein Auschwitz möglich war, dann muß Auschwitz das Ende der Rassenpolitik und das Ende des Antisemitismus sein" (Zit. n. Wortmann 13 f.).
Er wurde aus dem Spandauer Gefängnis als gebrochener Mann entlassen, das eigens für die in Nürnberg Verurteilten von den vier Alliierten eingerichtet worden war; er war auf einem Auge erblindet, das andere Auge war geschädigt. Er diktierte für die Illustrierte STERN seine Memoiren, die dann unter dem Titel "Ich glaubte an Hitler'' 1967 auch als Buch herauskamen. Seine letzten Lebensjahre verbrachte er in einem bescheidenen Hotel in Kröv an der Mosel, das von zwei ehemaligen BDM-Führerinnen betrieben wurde, die den fast Erblindeten pflegten. Seine Frau hatte sich schon im Jahre 1950 von ihm scheiden lassen. Er starb am 8.8.1974. Auf seinem Grabstein steht: "Ich war einer von Euch".
171
Das politisch-pädagogische Konzept
Bis zur Machtergreifung Hitlers ist kein besonderes pädagogisches Konzept in den Handlungen und Äußerungen Schirachs zu erkennen. Die HJ war eine jener zahlreichen Jugendverbände, wie sie in der Weimarer Zeit entstanden. Jeder Erwachsenen-Verband, der etwas auf sich hielt, versuchte, eine Jugendabteilung zu gründen, um seinen Nachwuchs zu sichern. Auf diese Weise wurden die ursprünglichen Ideen des Wandervogel, der seinen Höhepunkt in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg erreichte, popularisiert und zugleich für die Zwecke der jeweiligen Erwachsenenorganisation instrumentalisiert. Wenn die HJ gerade nicht in Wahlkämpfe und andere politische Aktivitäten verwickelt war, betrieb sie wie die anderen Jugendorganisationen auch ein "Jugendleben", d.h. ihre Mitglieder trafen sich auf Heimabenden, machten Umzüge zur Eigenwerbung oder "gingen auf Fahrt".
Was sich nach dem 30. Januar 1933 aus der HJ entwickelte, beruhte zweifellos in erster Linie auf den Ideen Schirachs, er war der führende Kopf. Allerdings verfügte er, der ein unregelmäßiger Arbeiter war und bürokratischer Tätigkeit lieber aus dem Wege ging, über einen Mitarbeiterstab, der ihn offensichtlich gut ergänzte und seine Schwächen kompensierte. Die weibliche HJ, also der BDM, wurde von den beiden "Reichsreferentinnen" Trude Mohr und Jutta Rüdiger geprägt, letztere löste ihre Vorgängerin 1937 ab, als diese wegen Heirat ausschied. Sie waren die höchsten Führerinnen des BDM, formell Schirach unterstellt, tatsächlich jedoch weitgehend selbständig.
Schirachs Ziele, die nach 1933 offenbar werden, lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen:
1. Die Jugend auf die Person Hitlers zu verpflichten.
2. Eine die ganze deutsche Jugend umfassende Organisation aufzubauen.
3. Das Prinzip der Selbst-Führung durchzusetzen ("Jugend muß von Jugend geführt werden").
4. Verbesserung der sozialen Lage der Jugend.
5. Musische und kulturelle Differenzierung.
Die ersten vier Ziele sind von Anfang an erkennbar (vgl. Schirach 1934), das fünfte kommt im wesentlichen erst nach 1936 dazu.
172
Verpflichtung auf die Person Hitlers
Dieses Ziel ist von heute aus gesehen wohl am schwersten zu verstehen, aber es ist das ursprünglich erste und vielleicht das einzige, das in den Jahren vor 1933 eine bedeutende Rolle gespielt hat. Es hat einen biographischen und einen politischen Aspekt. Hitler war ja Schirach als 17jährigem wie eine Offenbarung erschienen, und zweifellos entstand zwischen ihnen eine besondere persönliche Beziehung - auch von Hitlers Seite aus. Vielleicht sah Hitler in ihm so etwas wie einen Sohn, jedenfalls galt er noch bis in die Kriegsjahre hinein als Kronprinz - bis zu jenem bereits erwähnten Auftritt auf dem Berghof 1943. Politisch gesehen war ihm Hitler als Person wie als Symbol die schlechthin unantastbare Integrationsfigur des deutschen Volkes, die garantieren sollte, was er sich erhoffte: Wiederherstellung der "Ehre" des deutschen Volkes, die durch den Versailler Vertrag verloren gegangen sei, und die volksgemeinschaftliche Einigung des Volkes als Rettung aus der erlebten inneren Zerrissenheit. Die Verpflichtung der Jugend auf Hitler war - so gesehen - identisch mit ihrer Verpflichtung auf das deutsche Volk überhaupt. Nationale Integrationsfiguren sind ja an sich nichts außergewöhnliches, wenn man etwa an die Rolle des britischen Königshauses oder auch des deutschen Kaisers vor 1914 denkt. Aber ihre persönliche Unantastbarkeit ist normalerweise eingebunden in eine komplexe politische Kultur von Regierung und Opposition, von pluralistischen Normen und Organisationen, von liberalen gesellschaftlichen Freiheitsspielräumen. Gerade diese politischen Voraussetzungen aber hatten die Nazis außer Kraft gesetzt, so daß nun das an sich legitime Bedürfnis nach einer personalen Repräsentanz das Wir-Gefühl ins Kultisch-Mystische abdriften ließ. Gerade die inszenierte Entrückung der Person Hitlers erwies sich später - vor allem auch in den Kriegsjahren - als wichtiges Bindemittel, wenn es galt, Kritik herunterzuschlucken oder gar die längst fällige Distanzierung vom Regime dann doch wieder zu vertagen. "Wenn das der Führer wüßte!" war bis in die letzten Kriegsjahre ein verbreiteter Seufzer. Und auch im Führerkorps der Hitlerjugend war bis zum Schluß die Idee im Schwange, nach dem Kriege gemeinsam mit Hitler unter den Partei-Bonzen aufzuräumen. In der geschilderten Szene auf dem Berghof 1943 hatten auch die Schirachs noch entsprechende Illusionen im Hinblick auf die Juden-Deportationen.
173
Daß gerade Hitler der Täter, der millionenfache Mörder war - wenn auch nicht allein - und eben nicht die Integrationsfigur, wofür man ihn jahrelang gehalten und als den man ihn geradezu verehrt hatte, mußte wie ein tiefer Schock wirken, dem ja Schirach auch vor dem Nürnberger Tribunal Ausdruck verliehen hat. Nicht alle seine HJ-Kameraden sind ihm da übrigens gefolgt. Manche haben das nicht wahrhaben wollen - vielleicht, um auf solche Weise ihre Identität wie mühsam auch immer zu retten. Auch Baeumler und Krieck sind ja - wenn auch weniger leidenschaftlich als Schirach - dieser Faszination durch die Integrationsfigur Hitler erlegen.
Von heute aus gesehen - und das heißt: gerade auch aufgrund der Erfahrungen mit der NS-Zeit - mag es ganz unverständlich erscheinen, wie man ohne jede demokratische Absicherung einen einzelnen Menschen in eine solche jeder Kritik und moralischen Grenzsetzung enthobene Position nicht nur versetzen, sondern ihn geradezu enthusiastisch immer wieder darin bestätigen kann. Aber mit dieser katastrophalen Fehleinschätzung befand sich Schirach damals sozusagen "in bester Gesellschaft", denn nicht wenige Kirchenführer, Gelehrte, Industrielle und andere Personen des öffentlichen Lebens taten es ihm gleich. Daß dieser Wunsch nach einer "reinen" Integrationsfigur so massenhaft anzutreffen war, lag einerseits sicher an der mangelnden politischen Erfahrung der meisten Menschen, andererseits aber wohl auch daran, daß viele die Weimarer Demokratie nach ihren Alltagserfahrungen für abgewirtschaftet hielten, sich vor dem Kommunismus fürchteten und ihre Zukunftshoffnungen mit emotionaler Intensität auf Hitler projizierten, von dem man sich Rettung aus der Not versprach.
Jedenfalls profitierte Schirach von seiner besonderen persönlichen Beziehung zu Hitler insofern, als er weitgehend freie Hand bekam, seine Konzeption der HJ zu realisieren und alle Einmischungen von außen - Partei, Wehrmacht - abzuwehren.
Volksgemeinschaftliche Einheitsorganisation
Dieses zweite Ziel hing mit dem ersten aufs engste zusammen: Wollte Schirach die deutsche Jugend auf Hitler verpflichten, so brauchte er dafür eine einheitliche Organisa-
174
tion. Aber dies war nicht der einzige Grund. Eines der politischen Ziele, mit dem die Hitler-Bewegung angetreten war, war die Herstellung der "Volksgemeinschaft", als deren Garant und Symbol die Integrationsfigur ja dienen sollte. Auf diese Weise sollte die parteipolitische, konfessionelle und klassenmäßige Zerrissenheit des Volkes überwunden werden. Diese Sehnsucht war in der Weimarer Zeit weit verbreitet, und der Begriff "Volksgemeinschaft" findet sich im politischen Spektrum von rechts bis links - wenn auch natürlich in unterschiedlichen politischen Versionen.
Nach der Machtergreifung ging Schirach sofort dazu über, die "Volksgemeinschaft" in einer einheitlichen Jugendorganisation - seiner HJ - zu realisieren. Dazu mußten aber die anderen Jugendorganisationen erst einmal beseitigt oder eingegliedert werden. Zur Zeit der Machtergreifung hatte die HJ etwa 100.000 Mitglieder. Das war nicht viel im Vergleich zu anderen Organisationen. Etwa 600.000 waren in evangelischen, über 800.000 in katholischen Verbänden organisiert, die meisten, nämlich etwa 1.5 Millionen, machten in Sportverbänden mit. Die Jugendverbände hatten sich in der Weimarer Zeit im "Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände" auf Reichsebene zusammengeschlossen - dem Vorläufer des heutigen Bundesjugendrings. Nach den Angaben des Reichsausschusses waren 1927 etwa 40 Prozent der Jugendlichen, also etwa 3,6 Millionen von insgesamt 9,1 Millionen, in den ihm angeschlossenen Verbänden organisiert.
Am 5.4.33 ließ Schirach durch einen Trupp Hitlerjungen die Geschäftsstelle des Reichsausschusses in Berlin besetzen, die Akten beschlagnahmen und den Geschäftsführer Maaß - einen Sozialdemokraten - entlassen. Dieser Schritt war rechtswidrig, aber Widerstand blieb aus. Am 22.7.33 löste er den Reichsausschuß offiziell auf. Die beschlagnahmten Akten gaben ihm Einblicke in den Mitgliederstand und die Führerschaft der Verbände. Gefährlich werden für seinen Monopolanspruch konnten ihm jedoch nur drei Gruppen: die rechten Bünde, die evangelische und die katholische Jugend.
Schirach kam jedoch recht schnell ans Ziel. Nach dem Reichstagsbrand und dem daraufhin beschlossenen "Ermächtigungsgesetz" ging der Kommunistische Jugendverband in den Untergrund, die sozialistische Jugend wurde durch die Polizei ausgeschaltet. Die rechten bündischen
175
Gruppen - im wesentlichen Oberschüler und Studenten - schlossen sich Ende März 1933, um ihre Selbständigkeit zu erhalten, zum "Großdeutschen Bund" zusammen und versuchten, die HJ mit Ergebenheitsadressen rechts zu überholen. Ihr Führer war Admiral von Trotha, der über gute Beziehungen zur Reichswehr verfügte. Aber das nutzte nichts, denn am 7.6.33, an dem Tag, an dem Schirach zum Reichjugendführer ernannt wurde, löste er diesen Bund auf. Das war wiederum rechtswidrig, Trotha protestierte auch beim Reichspräsidenten von Hindenburg, aber Hitler konnte diesen überzeugen, daß es dabei doch um eine gemeinsame nationale Sache gehe. Noch reibungsloser verlief die Eingliederung der meisten evangelischen Jugendverbände - einige lösten sich lieber auf -, die Anfang 1934 per Vertrag erfolgte. Die rein religiöse Arbeit durfte weiter in den Kirchengemeinden betrieben werden, für alle andere Jugendarbeit war nun die HJ zuständig.
Mehr Schwierigkeiten bereitete die katholische Jugend. Im Frühjahr/Sommer 1933 verhandelte die Reichsregierung mit dem Vatikan - erfolgreich - über ein Konkordat, das zunächst der katholischen Jugendarbeit noch einen gewissen Schutz bot, aber spätestens 1938 war auch sie wie die evangelische reduziert auf die bloße kirchliche Unterweisung bzw. die Meßdiener-Schulung. Das schon erwähnte Hitlerjugendgesetz von 1936 erhob die HJ in den Rang einer dritten Erziehungsinstitution neben Elternhaus und Schule.
Von heute aus gesehen mag überraschen, wie einfach es für Schirach war, die anderen Jugendverbände auszuschalten bzw. einzugliedern. Gewiß gab es auch Übergriffe von HJ-Kommandos gegen andere Jugendverbände, vor allem gegen die katholische Jugend, und auch Polizei und Gestapo erzeugten durch Verhaftungen, Hausdurchsuchungen usw. eine Atmosphäre des Terrors und der Einschüchterung. Aber das reicht zur Erklärung nicht aus. Vielmehr muß man den Eindruck gewinnen, daß Schirach gleichsam ein morsch gewordenes Gebäude mit einigen Fußtritten zum Einsturz gebracht hatte. Abgesehen von der katholischen Jugend zeigte sich kaum Widerstand, und auch aus deren Reihen gab es Ergebenheitsadressen an Hitler, die Zweifel aufkommen lassen mußten, warum sie sich eigentlich noch gegen einen Übertritt zur HJ wehrte. Zudem hatte gerade die katholische Kirche bzw. ihre politische Partei - das Zentrum - in der
176
Weimarer Zeit nicht wenig zur "Zerrissenheit" des Volkes beigetragen, weil sie ihre bildungs- und kulturpolitischen Eigeninteressen einigermaßen rücksichtslos durchzusetzen trachtete. Aus nahezu allen Jugendorganisationen liefen 1933 ohne jeden Zwang Scharen von Jugendlichen zur HJ über, deren Mitgliederzahl innerhalb eines Jahres von 100.000 auf über 3 Millionen anstieg. Der Sog der "nationalen Erhebung" war offensichtlich unwiderstehlich. Zudem muß man bei der Betrachtung der Jugendverbände am Ende der Weimarer Republik den Eindruck gewinnen, daß ihr Elan weitgehend erloschen war, daß sie sich irgendwie überlebt hatten, jedenfalls stagnierten. Entweder waren sie zu reinen Freizeitvereinen geworden, oder sie hatten sich wie die politischen Jugendverbände bürokratisiert, oder sie schmorten - wie die Bünde - im eigenen Saft.
Wollte die HJ nun eine volksgemeinschaftliche einheitliche Jugendorganisation und insofern eine wirklich integrierende Größe sein, so hätte sie eigentlich politisch und weltanschaulich neutral bleiben müssen, um mit bestimmten Gruppen der Bevölkerung nicht von vornherein im Konflikt zu liegen - so wie heute etwa unsere Schulen parteipolitisch und konfessionell neutral sind, um ebenfalls möglichst niemanden von vornherein auszuschließen. Diesem Grundsatz blieb die HJ nach dem Willen Schirachs auch im Prinzip treu - jedenfalls so, wie sie es selbst verstand. Sie sah sich nicht als politische Jugendorganisation im Sinne etwa der NSDAP als Partei, sondern als Jugendorganisation des gesamten deutschen Volkes. Politik im Sinne von Außen- oder Innenpolitik sollte bei ihr keine Rolle spielen. Was sie als "weltanschauliche Schulung" betrieb, bezog sich auf die nationalsozialistische Weltanschauung, insofern sie als ideelle Integration des ganzen Volkes gemeint war.
Besonders deutlich wird das im Umgang mit den christlichen Kirchen. Eigentlich hätten diese - vor allem die katholische - im schroffen Gegensatz zur NS-Weltanschauung stehen müssen, und Konflikte gab es auch genug. Aber das, was von der NS-Weltanschauung in die Arbeit der HJ einging, war gleichsam pädagogisch gefiltert. Rassenhetze, Agitation gegen bestimmte Gruppen des Volkes - z.B. gegen die Kirchen - oder ähnliche polarisierende Strategien wurden vermieden, so daß vor allem nach den organisatorisch etwas chaotischen Anfangsjahren auch bei den Kirchen der Eindruck ent-
177
stehen konnte, die Weltanschauung der HJ sei wirklich nur auf Integration der Volksgemeinschaft angelegt, so daß auch der Widerstand der Kirchen gegen die HJ immer weniger plausibel wurde.
Zudem hatte Schirach wiederholt betont, daß die HJ die kirchlich-religiöse Einstellung ihrer Mitglieder respektiere und bereit sei, den Dienst so zu organisieren, daß Teilnahme am Gottesdienst für jeden möglich sei, der es wolle.
Anläßlich des Hitlerjugend-Gesetzes von 1936 wandte er sich "An deutsche Eltern" und sagte unter anderem, daß er keine Konfession für die Jugend verbindlich machen könne, "da wir nun einmal mehrere Konfessionen besitzen, ... wie ich überhaupt alles vermeiden muß, was in die Jugend Zwiespalt und Uneinigkeit hineintragen könnte. Ich überlasse es also den Kirchen, die Jugend im Sinne ihrer Konfessionen religiös zu erziehen und werde ihnen auch in dieser Erziehung niemals hineinreden. Mein Auftrag wurde mir vom Deutschen Reich gegeben. Ich bin dem Reich dafür verantwortlich, daß die gesamte Jugend im Sinne der nationalsozialistischen Staatsidee körperlich, geistig und sittlich erzogen wird. Für die Durchführung dieser erzieherischen Aufgabe wird ein bestimmter Dienst angesetzt werden. Und ich habe nichts dagegen, daß außerhalb dieses Dienstes jeder Jugendliche religiös dort erzogen wird, wo das seine Eltern wollen oder er selbst will. An den Sonntagen wird während der Kirchzeit grundsätzlich kein Dienst angesetzt werden, so daß jedem Gelegenheit gegeben ist, die Kirchen seiner Konfession besuchen zu können" (Schirach 1938, 62 f.).
Von dieser grundsätzlichen - keineswegs praktisch immer befolgten - Einstellung hing die Glaubwürdigkeit der HJ als einer der "Volksgemeinschaft" dienenden Organisation ab. Sie hätte es sich nicht leisten können, ihre minderjährigen Mitglieder etwa in einen offenen Kirchenkampf zu manövrieren. Selbst in den KLV-Lagern - von denen noch zu sprechen sein wird -, in denen Kinder und Jugendliche weitab von ihren Eltern in den Kriegsjahren untergebracht waren, hielt Schirach - nicht ohne Konflikte mit anderen Parteigrößen wie Bormann - dieses Prinzip durch: Gottesdienstbesuche wie auch persönliche Gespräche mit Priestern sollten ohne Diskriminierung möglich sein.
178
Natürlich lag diesem Konzept eine enorm reduzierte Vorstellung von Religiosität bzw. Kirchenmitgliedschaft zugrunde, die die Kirchen eigentlich nicht akzeptieren konnten und die schon beim Kampf gegen die kirchlichen Jugendverbände erkennbar war: Religion als reine Privatsache bzw. als seelische Tankstelle ohne jede kritische öffentliche Relevanz und Konsequenz. Andererseits war natürlich auch bekannt, daß viele HJ-Führer persönlich durchaus kirchenfeindlich eingestellt waren und daraus keinen Hehl machten, und daß gelegentlich in der Führerzeitschrift "Wille und Macht" pointierte Angriffe gegen Maßnahmen und Handlungen von Kirchenführern zu lesen waren.
Auf der politischen Ebene ging die HJ durchaus - auch mit Hilfe von Polizei und SS - gegen die Kirchen bzw. gegen deren Jugendführer vor, wenn sie ihren Monopolanspruch bedroht sah. Das galt vor allem für die katholische Kirche, die zunächst nicht nur in begrenztem Rahmen weiter Jugendarbeit betreiben, sondern auch weiterhin Zeitschriften für ihre Mitglieder mit teilweise beachtlicher Auflage vertreiben durfte. Aber in der pädagogischen Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen - z.B. in dem dafür geschaffenen Schulungsmaterial - wurden religions- und kirchenfeindliche Propaganda vermieden. Das wäre "Politik" gewesen, und dafür waren die entsprechenden Organe der Erwachsenen zuständig.
So jedenfalls war es im Prinzip, als offizielle Linie verkündet. Da aber auch in der HJ die Tat-Philosophie galt, gab es auf der unteren Ebene nicht selten Übergriffe, wurde z.B. "Dienst" zur Kirchgangszeit angesetzt, aber immerhin konnten Eltern sich in solchen Fällen auf Schirachs öffentliche Erklärungen berufen.
Aus dem Konzept einer einheitlichen, volksgemeinschaftlich gedachten Jugendorganisation folgte aber noch ein weiteres Problem, das schwieriger zu lösen war und das dann ab 1937 zur "kulturellen Wende" führte. In einer solchen Einheitsorganisation, die für alle Jugendlichen gedacht war, konnte nur das zum Veranstaltungsprogramm werden, was alle auch ohne besondere Vorkenntnisse und Fertigkeiten zu tun in der Lage waren. Jeder, ob nun Lehrling oder Gymnasiast, ob mit höherer oder nur mittlerer Intelligenz ausgestattet, mußte also von vornherein einen chancengleichen Zugang
179
zum Programm der HJ haben können. Die Möglichkeiten dafür waren jedoch beschränkt auf Marschieren, Singen, sportliche Spiele und auf Themen in den Heimabenden, die die anwesenden Oberschüler nicht sofort zu Lehrern der ungelernten Jungarbeiter oder der Lehrlinge machte. Das Erlebnis der Volksgemeinschaft ließ sich also nicht auf der sachlich-intellektuellen, sondern nur auf der emotional-erlebnishaften Ebene herstellen. Die dafür möglichen Inszenierungen wie Aufmärsche, Feiern usw. verlieren jedoch durch ständige Wiederholung leicht ihre Wirkung, und das Interesse an dem, was alle gleichermaßen können, geht ebenfalls bald zurück. Ab etwa 1937 zeigte sich diese Entwicklung in zunehmenden Klagen von Führern über Disziplinlosigkeit und Desinteresse an den Angeboten der HJ.
Diese Schwierigkeit hatten zumindest diejenigen Jugendorganisationen vor 1933 auch erfahren, die wie die politischen oder kirchlichen eine Massenorganisation sein, also möglichst viele Jugendliche erreichen wollten. Sie mußten dafür mehr bieten als nur ihr weltanschauliches oder politisches Credo, nämlich davon im Prinzip unabhängige Freizeitangebote. Im übrigen hatten die jungen Leute damals ja die Möglichkeit, einen Bund oder eine andere Jugendorganisation ihres politischen, weltanschaulichen, kulturellen oder sportlichen Standards zu wählen. Demgegenüber hatte die HJ als monopolisierte Freizeitorganisation die Last sich aufgeladen, derartige innere Differenzierungen im Rahmen einer Einheitsorganisation anzubieten, was sie dann auch versuchte. Doch davon später.
Das Prinzip der Selbstführung
Vor der Machtergreifung - bis 1932 - war die HJ der SA unterstellt und wurde mit dieser auch von Fall zu Fall verboten. Sie war also eine reine Parteijugend. Nach 1933 jedoch konnte Schirach in Übereinstimmung mit Hitler, der in "Mein Kampf" festgestellt hatte, daß Jugend von Jugend geführt werden müsse, die HJ zu einer von anderen Partei- und Staatsinstanzen relativ unabhängigen Organisation entwickeln.
Allerdings hatte dieses Prinzip vor 1933 - wie Schirach (1934) selbst eingestand - auch einen praktischen Hintergrund. "Das fast gleichzeitige Entstehen der großen nationalsoziali-
180
stischen Organisationen band alle Führungskräfte in ihre eigenen Altersklassen. Politische Organisation, SA und SS waren außerstande, Führer an die entstehende Jugendorganisation abzugeben" (60).
Das Prinzip der Selbstführung der Jugend war nicht neu. Seitdem die bürgerliche Jugendbewegung in Gestalt des Wandervogel es mit Beginn des Jahrhunderts für sich reklamiert und praktiziert hatte, war es selbst dort zur Geltung gekommen, wo es sich um Jugendverbände von Erwachsenenorganisationen wie etwa der politischen Parteien handelte. In diesen Fällen jedoch war der Autonomiespielraum begrenzt durch die jeweiligen Interessen des Erwachsenenverbandes. Aber gegen Ende der Republik war bei großen Teilen der Bevölkerung alles verdächtig, was nach "Partei" roch. Auch die HJ verdankte ihren Zulauf 1933 nicht der Tatsache, daß sie eine Partei-Jugend war, sondern daß sie sich als Teil einer weit darüber hinausgehenden völkisch-nationalen "Bewegung" verstand, die Hitler in seiner Person repräsentierte. Mit einer Partei-Jugend hätte Schirach keine öffentliche Legitimation gehabt, andere Jugendverbände aufzulösen und eine einheitliche Jugendorganisation zu fordern.
Unter Berufung auf das Prinzip der Selbstführung gelang es Schirach tatsächlich, fast bis zum Ende des Krieges Einwirkungen anderer Parteidienstellen oder der Wehrmacht zurückzuweisen. Dies wäre jedoch ohne die besondere persönliche Beziehung, die Schirach zu Hitler hatte, nicht möglich gewesen.
So konnte Schirach seine Idee eines eigenen Jugend-Staates realisieren: Jugend gestaltet ein eigenes Jugendleben, nach eigenen Ritualen und Regeln, durch Jugend geführt. Politik im Sinne von Außen- und Innenpolitik hat dort nichts zu suchen, ist eine Sache der dafür zuständigen Partei- und Staatsorgane der Erwachsenen. Jugend organisiert sich in diesem Sinne selbst als pädagogische Provinz. Zweifellos spielten hier Erfahrungen eine Rolle, die Schirach im reformpädagogischen Waldpädagogium Bad Berka machen konnte. Für die erwachsenen Mitglieder des Führerkorps galt die politische Abstinenz natürlich nicht, wie ein Blick in ihre Zeitschrift "Wille und Macht" zeigt. Hier wurden allgemeine politische Fragen durchaus diskutiert.
Die Selbstführung wurde auch in zahlreichen Einzelheiten durchgesetzt. Es gab Uniformen für verschiedene Ränge,
181
Rangabzeichen, eine eigenständige Disziplinargewalt, die Verstöße gegen die HJ-Disziplin ahndete - im schlimmsten Falle durch Ausschluß aus der HJ. Ein "Streifendienst" überwachte, ob HJ-Mitglieder sich in der Öffentlichkeit korrekt verhielten, ob die Jugendschutzgesetze z.B. in Gaststätten eingehalten wurden usw. Polizeilich-exekutive Gewalt hatte er jedoch nicht.
Die in HJ und BDM verbrachte Lebenszeit sollte sinnlich erfahrbar eine eigentümliche biographische Phase sein, bevor dann die nächste begann. Dem diente auch die Aufteilung in Altersgruppen. Für die Jungen gab es die Altersklassen "Jungvolk" (10-13 Jahre) und "Hitler-Jugend" (14-18 Jahre), für die Mädchen deren drei: "Jungmädel" (10-13 Jahre), "BDM" (14-18), und "Glaube und Schönheit" (17-21 Jahre) als freiwilliges Angebot. Die Aufteilung in Jahrgangsgruppen hatte die HJ nicht erfunden, sie geht auf die Neupfadfinder in der Weimarer Zeit zurück. Ab 1936 wurden die Mitglieder jahrgangsweise erfaßt, und analog einem schulischen Lehrplan versuchte die HJ, das Aufwachsen der Jungen und Mädchen zu begleiten mit altersmäßig gestaffelten Proben, Aufgaben und Leistungswettbewerben, um so auch den Prozeß des "Älter- und Größerwerdens" erlebbar zu machen. Wir haben es hier also zu tun mit einem ausgeklügelten Konzept einer pädagogischen Provinz, die gleichwohl kein Selbstzweck sein sollte; denn dieser Jugendstaat sollte ja zugleich dem ganzen Volke dienen.
Dies geschah durch "Dienste", die die HJ leistete. Dazu gehörten in erster Linie Sammlungen für unterschiedliche Zwecke - vor allem auch für das "Winterhilfswerk", einen Wohlfahrtsfonds, der bedürftige "Volksgenossen" unterstützen sollte. Aber auch Ernteeinsätze und Sammelaktionen zur Wiedergewinnung wertvoller Rohstoffe - heute Recycling genannt - standen auf dem Programm. Im Kriege erweiterten sich solche Einsätze dann z.B. auf den Post-, Gesundheits- und Sozialdienst.
Verbesserung der sozialen Lage der Jugend
Die seit der Weltwirtschaftskrise ab 1929 zunehmende Verelendung breiter Bevölkerungsschichten - nicht etwa nur der Arbeiterschaft, sondern auch von Teilen der bürgerli-
182
chen Mittelschicht - traf nicht zuletzt auch viele Kinder und Jugendliche. Das spürte auch die HJ, zumal sie als Jugendorganisation des ganzen deutschen Volkes mit dem Ziel auftrat, die Klassen- und Standesunterschiede zu überwinden. Vor 1933 hatte die HJ einen großen Mitgliederanteil aus der Arbeiterschaft, so daß deren wirtschaftliche und soziale Verfassung unmittelbar erfahrbar wurde. Schirach selbst stand von seiner sozialen Herkunft her diesem Problem einigermaßen fremd gegenüber, anders als Artur Axmann, der selbst aus diesem Milieu stammte. Unter seiner Leitung entstand schon 1932 in der HJ ein "soziales Amt", das bis Kriegsende bestehen blieb. Bereits 1933 begannen auf Axmanns Initiative hin medizinische Reihenuntersuchungen, für die bereits detaillierte Richtlinien ausgearbeitet waren (Schirach 1934, 199 ff.). Ziele dieser Untersuchungen waren, den Gesundheitszustand der Jugend im ganzen zu erfassen, eine vorbeugende Gesundheitsfürsorge zu betreiben, so daß Krankheiten früh erkannt und entsprechend behandelt werden konnten - sei es medizinisch, sei es im Sinne einer vorbeugenden Erholungsfürsorge durch Kuraufenthalte oder durch Erholungsangebote auf dem Lande, z.B. bei Pflegefamilien. Eine Rolle spielte allerdings auch die Überlegung, solche Kinder zeitweise oder ganz aus der HJ auszuschließen, die den Dienstanforderungen körperlich nicht gewachsen waren. Zugleich sollte im Rahmen dieser Maßnahmen auch ermittelt werden, welche körperlichen Anstrengungen Jungen und Mädchen eines bestimmten Alters überhaupt zugemutet werden konnten, ohne sie gesundheitlich zu überfordern. Daraus ergaben sich dann detaillierte Anweisungen an die Führerschaft z.B. über die zulässige Länge von Marsch- und Wanderstrecken. Bis 1938 wurden auf diese Weise jährlich etwa eine Million Jugendliche untersucht, das Ergebnis wurde in einem "Tauglichkeitspaß" festgehalten, der bei HJ-Veranstaltungen mitzuführen war. Zum Konzept der vorbeugenden Gesundheitsfürsorge gehörte auch die Gesundheitserziehung in der HJ selbst, wofür Aufklärungsmaterial entwickelt wurde, das dem jeweiligen Alter angemessen war. Das Jahr 1939 wurde zum "Jahr der Gesundheit" proklamiert und Schirach erfand dafür im Rahmen von "10 Geboten" das Motto: "Du hast die Pflicht gesund zu sein!". Die 10 Gebote" lauteten:
1. Dein Körper gehört Deiner Nation, denn ihr verdankst Du Dein Dasein. Du bist ihr für Deinen Körper verantwortlich.
183
2. Du mußt Dich stets sauber halten und Deinen Körper pflegen und üben. Licht, Luft und Wasser helfen Dir dabei.
3. Pflege Deine Zähne. Auf ein kräftiges, gesundes Gebiß kannst Du stolz sein.
4. Iß reichlich rohes Obst, rohe Salate und Gemüse, nachdem Du sie gründlich mit sauberem Wasser gereinigt hast. Im Obst sind wertvolle Nährstoffe enthalten, die beim Kochen verloren gehen.
5. Trink flüssiges Obst. Laß den Kaffee den Kaffeetanten. Du hast ihn nicht nötig.
6. Meide Alkohol und Nikotin, sie sind Gifte und hemmen Dein Wachstum und Deine Arbeitskraft.
7. Treibe Leibesübungen! Sie machen Dich gesund und widerstandsfähig.
8. Du mußt jede Nacht mindestens neun Stunden schlafen.
9. Übe Dich in der "Ersten Hilfe" bei Unglücksfällen. Du kannst dadurch der Lebensretter Deiner Kameraden werden.
10. Über all Deinem Handeln steht das Wort: Du hast die Pflicht gesund zu sein!" (Rüdiger 1993, 201).
Im selben Jahr wurde allen Führern und Führerinnen sowie den im Gesundheitsdienst Tätigen zur Pflicht gemacht, das Rauchen aufzugeben - getreu der von Schirach vertretenen Erziehungsmaxime, daß das Vorbild das beste Erziehungsmittel sei. Ob diese "Pflicht" bei so manchem nicht lediglich zur Heuchelei führte, darf nach unserer heutigen Lebenserfahrung gewiß vermutet werden.
Wie die "10 Gebote" zeigen, hatte dieses Gesundheitsprogramm eine ideologische und eine praktische Komponente. Die ideologische war von Hitler vorgegeben, indem er, wie schon erwähnt wurde, der körperlichen Ertüchtigung den Vorrang vor anderen Erziehungszielen einräumte - nicht um des einzelnen willen, sondern um des starken, wehr- und gebärtüchtigen Volkes willen.
Die praktische Komponente hatte zwei Aspekte - aus der Sicht der Veranstalter und aus der Sicht der Jugendlichen und deren Eltern. Wir wissen heute, daß der NS-Staat eine umfassende gesundheitliche Bestandsaufnahme der ganzen Bevölkerung angestrebt und zum Teil verwirklicht hat. Vorrangiges Ziel war, diejenigen zu erfassen, die den Vorstellungen der Rassereinheit bzw. der Erbgesundheit widersprachen, um sie aus der "Volksgemeinschaft" auszugrenzen
184
oder gar - wie im Falle der geistig schwer Behinderten - zu ermorden.
Nichts spricht dafür, daß Schirach und Axmann solche Konsequenzen im Auge hatten, als sie diese Reihenuntersuchungen begannen. Aber immerhin verbanden sie von vornherein damit den Gedanken der Ausgrenzung. Wer nicht in einem vorgegebenen Durchschnittstempo mitmarschieren konnte, mußte draußen bleiben. Was aber ist von einer "volksgemeinschaftlichen" Jugendorganisation zu halten, die z.B. körperlich behinderte junge Menschen nur wegen dieser Behinderung von vornherein ausschließt? Denkbar wäre doch auch gewesen, für solche Jugendlichen spezielle Angebote zu machen, so wie dies etwa für die Motorrad- oder Flugzeug-Interessierten auch geschah. Aber das für alle HJ- und BDM-Mitglieder Gemeinsame war eben der regelmäßige "Dienst", der in militärähnlicher Form betrieben wurde und eine bestimmte körperliche Verfassung voraussetzte.
Aus der Perspektive der Jugendlichen und deren Eltern ergab sich jedoch ein anderes Bild. Vor allem in den unteren sozialen Schichten herrschte damals weitgehend Unkenntnis über gesundheitliche und hygienische Fragen. Hinzu kam oft Gleichgültigkeit, die teilweise einfach aus der Überforderung durch den Lebenskampf resultierte: aus Arbeitslosigkeit, wirtschaftlicher Not, geringer Bildung usw. Kinderkrankheiten, soweit sie nicht zur Bettlägrigkeit führten und damit offensichtlich wurden, wurden oft nicht erkannt, und die Folgen, z.B. bei der weit verbreiteten Rachitis, nicht behandelt. Tuberkulose wurde vielfach erst in einem späten Stadium wahrgenommen. Vor der Hitlerjugend hatte sich niemand öffentlich um diese Probleme so nachhaltig und systematisch gekümmert. Deshalb mußte die Gesundheitsfürsorge der HJ und des BDM bei vielen Menschen als ein Fortschritt verstanden werden, der er ja insoweit auch war. Allerdings galt das wohl weniger für diejenigen Familien, die als "asozial" angesehen wurden; denn die hatten meistens gelernt, daß eine derartige Fürsorge auch eine Form sozialer Kontrolle war, der man sich am besten entzog.
Wir können heute überhaupt die Popularität vieler Maßnahmen nicht nur der HJ, sondern auch anderer NS-Organisationen nicht verstehen, wenn wir uns nicht klarmachen, auf welche sozial-ökonomische Situation sie damals trafen. So mag
185
uns trivial erscheinen, wenn die NS-Frauenschaft Koch-, Näh- und Hauswirtschaftskurse anbot, oder wenn ähnliche Themen beim BDM eine Rolle spielten. Aber vor allem wiederum in den unteren sozialen Schichten waren damals elementare Kenntnisse darüber, wie man Geld einteilen muß, wie man sich richtig ernährt, wie man Kleidung pflegt und repariert usw. keineswegs selbstverständlich. Und wenn beim BDM oder im Rahmen von "Glaube und Schönheit" versucht wurde, durch Handarbeiten, Basteln und Raumgestaltung kostengünstig eine bescheidene Alltagsästhetik zu finden, so mag uns das heute folkloristisch erscheinen, aber damals empfanden viele Menschen das als durchaus nützlich und pädagogisch sinnvoll.
Das gilt auch für die zweite Aktion, die Axmann ins Werk setzte: den "Reichsberufswettkampf". Die Sache selbst hatte er nicht erfunden, sondern schon in der Weimarer Zeit der "Deutsche Handlungsgehilfenverband (DHV)", aber Axmann machte daraus eine Massenveranstaltung. Das ganze beruhte auf einem Ausscheidungssystem: die Besten kamen jeweils in die nächste Runde. Die Anforderungen bestanden aus beruflicher Praxis, Berufstheorie, Deutsch, Rechnen, Allgemeiner Staatskunde und Sport (bei Mädchen kam noch Hauswirtschaft hinzu). Der Wettbewerb wurde in Zusammenarbeit mit der DAF - die hatte das Geld dafür aus ihren Mitgliedsbeiträgen - erstmals 1934 mit ca. 500.000 Teilnehmein veranstaltet. Die Teilnehmerzahl nahm von Jahr zu Jahr zu und erreichte 1937 1,8 Millionen. Höhepunkt war die Endausscheidung auf Reichsebene, die Sieger wurden am 1. Mai Hitler in der Reichskanzlei vorgestellt.
Auch hier läßt sich eine ideologische und eine praktische Komponente unterscheiden. Ideologisch ging es sicher um die Inszenierung von "Volksgemeinschaft", vor allem um die Mobilisierung der Arbeiterschaft (ab 1938 konnten auch Erwachsene an dem Wettbewerb teilnehmen), deren Loyalität sich das Regime nicht sicher sein konnte. Außerdem ging es um die Mobilisierung von "Leistung" und "Einsatz".
Aber vieles spricht dafür, daß der junge Axmann solche Absichten allenfalls am Rande im Sinn hatte. Vermutlich war ihm die praktische Seite der Sache zumindest zunächst wichtiger; denn er wußte aus eigener Erfahrung, welch geringes
186
Ansehen der Arbeiter und zumal der jugendliche damals hatte, wie egoistisch die Betriebe mit ihm umgingen und vor allem, wie viele berufliche Talente verkümmern mußten, weil niemand sie zur Kenntnis nahm oder förderte. Noch nie zuvor war der arbeitenden Jugend so viel öffentliche Aufmerksamkeit und Anerkennung zuteil geworden wie durch diese jährliche Aktion. Und die praktischen Folgen blieben nicht aus. Viele Betriebe fühlten sich unter Druck gesetzt, ihre Ausbildungs- und Arbeitsbedingungen zu überprüfen. Begabungen wurden erkennbar, die dem Betrieb bisher entgangen waren, in nicht wenigen Fällen zeigte sich, daß junge Leute beruflich unterfordert waren, weil sie diejenige Arbeit annehmen mußten, die ihnen den Lebensunterhalt sicherte.
Die DAF, die Nachfolgeorganisation der ehemaligen Gewerkschaften, konnte keine Tarifverhandlungen führen, also keine Lohnforderungen stellen. Deshalb verlegte sie ihre Aktivität darauf, das öffentliche Ansehen der "Arbeiter der Faust" zu heben. Sie versuchte dies durch Verbesserung der Arbeitsbedingungen ("Schönheit der Arbeit") und der Freizeitbedingungen ("Kraft durch Freude"). In diese Ambitionen paßte der Reichsberufswettkampf gut hinein. Sieht man sich nämlich an, was die DAF unter dem Slogan "Schönheit der Arbeit" unternahm, dann gewinnt man einen guten Eindruck davon, wie damals viele Betriebe ihre Arbeiter behandelten und wie uninteressiert sie vielfach an deren Arbeitsbedingungen waren. Daß eine Verbesserung keineswegs nur eine Frage der Kosten war, zeigte die DAF mit ihren Vorschlägen: Wie man die sanitären Einrichtungen verbessern, wie man die Beleuchtung am Arbeitsplatz effektiver machen, wie man für mehr frische Luft sorgen, mit ein wenig Farbe, ein paar Blumen die Pausenräume freundlicher gestalten kann usw. Solche uns heute entweder banal oder selbstverständlich erscheinenden Maßnahmen waren damals für das Bewußtsein vieler Unternehmer neu. Nicht zuletzt am Widerstand der Unternehmer war vor 1933 auch der Versuch gescheitert, den arbeitenden Jugendlichen bzw. den Lehrlingen einen angemessenen bezahlten Urlaub zu gewähren. Der schon erwähnte "Reichsausschuß der deutschen Jugendverbände" hatte dafür im Jahre 1925 ein Programm vorgelegt, das von allen wichtigen Wohlfahrtsorganisationen unterstützt wurde. Über kaum ein anderes gesellschaftliches Pro
187
blem hatte es einen derartig großen Konsens gegeben. Aber eine entsprechende gesetzliche Regelung kam in der Weimarer Zeit nicht zustande, die Gewährung von Urlaub blieb in das Belieben des jeweiligen Arbeitgebers gestellt. Eine gesetzliche Regelung war deshalb nötig, weil eine tarifvertragliche Lösung für die Lehrlinge nicht möglich war, da rechtlich der Lehrlingsstatus nicht als Arbeitsverhältnis, sondern als Ausbildungsverhältnis galt.
Der "Reichsausschuß" hatte u.a. gefordert, jugendlichen Arbeitern und Lehrlingen unter 16 Jahren drei Wochen und den 16-18jährigen zwei Wochen bezahlte Ferien zu gewähren. Nach der Machtergreifung setzte die HJ die Betriebe unter Druck, von sich aus für vernünftige Urlaubsregelungen zu sorgen. Die Resultate waren durchaus beachtlich, denn schon 1934 konnten ca. 100.000 und 1936 ca. 560.000 Jungen an dreiwöchigen Zeltlagern teilnehmen. Da nach Angaben der Reichsjugendführung 62,5 Prozent der Teilnehmer berufstätig bzw. Lehrlinge waren, mußten sie dafür auch Urlaub bekommen haben. Das Jugendschutzgesetz von 1938, an dessen Zustandekommen die HJ maßgeblich mitgewirkt hatte, regelte nicht nur den Urlaub für Jugendliche, sondern erfüllte praktisch auch alle anderen Forderungen, die der "Reichsausschuß" seinerzeit gestellt hatte.
Diese freizeitpolitische Aktivität der HJ läßt sich ebenfalls ideologisch und praktisch deuten. Wollte die HJ eine Erziehungsinstitution für die gesamte Jugend sein, so mußte diese Jugend auch Zeit haben, an Veranstaltungen teilzunehmen - vor allem eben auch an den Sommerlagern, die für die Jungen in Zeltlagern, für die Mädchen in Jugendherbergen stattfanden; denn die Lagererziehung war ein Kernstück der NS-Erziehung - nicht nur für die Jugend, sondern auch für die Erwachsenen. Nur im Lager nämlich, nicht am Wohnort, ließen sich die Lebensbedingungen so konsequent arrangieren und kontrollieren, wie es dem Ideal der HJ-Erziehung entsprach.
Praktisch gesehen war eine Urlaubsregelung für jugendliche Arbeiter und Lehrlinge längst überfällig. Das hatte schon der hohe Konsens in dieser Frage in der Weimarer Zeit bewiesen. Dagegen waren eigentlich nur die Arbeitgeber, die nach 1933 ihren Widerstand auf so bemerkenswerte Weise aufgaben. Hier konnte sich die HJ mit Recht rühmen, eine wich-
188
tige soziale Frage gelöst zu haben, wozu "die Systemzeit" trotz des großen Konsenses nicht im Stande war. Für viele Jugendliche standen sicher nicht die Ideologie und das Erziehungskonzept im Vordergrund, das die HJ zu der Freizeitaktivität motivierte, sondern das Erlebnis, oft zum ersten Mal die häusliche Umgebung verlassen und in einer anderen Umgebung Ferien machen zu können. Auch nach dem Kriege blieben viele Jugendliche aus finanziellen Gründen noch auf öffentlich subventionierte Zeltlager und andere Ferienmaßnahmen der Jugendverbände angewiesen, wenn sie überhaupt verreisen wollten.
Im September 1940 beauftragte Hitler Schirach mit der "Erweiterten Kinderlandverschickung". Durch diese Maßnahme sollten möglichst viele Kinder bis zum 14. Lebensjahr - später auch ältere - aus den bombengefährdeten Großstädten in nicht vom Luftkrieg bedrohte Gebiete verschickt werden. Eigentlich handelte es sich hier um eine Evakuierung, aber um der Sache ein positives Image zu geben, schlug Schirach vor, von "Erweiterter KLV" zu sprechen. Auch in den Friedensjahren gab es bereits eine "KLV", in deren Rahmen z.B. gesundheitsgefährdete Kinder zur Erholung aufs Land geschickt wurden. Daran ließ sich im Bewußtsein der Bevölkerung anknüpfen.
Für diese Kriegsmaßnahme gab es keinerlei Vorbereitungen, wie etwa für den Luftschutz oder für andere Notmaßnahmen. Schirach wurde deshalb von Hitler bevollmächtigt, die dafür nötigen Partei- und Staatsinstanzen zu koordinieren.
Für Kleinkinder mit ihren Müttern sowie für Kinder von 6 bis 10 Jahren war die NSV - der nationalsozialistische Wohlfahrtsverband - zuständig, die sie entweder in Heimen, Hotels oder in Familien unterbrachte. Wer Verwandte auf dem Lande hatte, konnte seine Kinder dort unterbringen.
Kernstück dieser Maßnahmen, die auf Freiwilligkeit beruhten, waren aber die KLV-Lager, in die ganze Schulklassen mit ihren Lehrern einzogen. Der Aufenthalt dauerte mindestens sechs Monate, und im Jahre 1943 waren in über 5.000 Lagern über 1 Million Kinder und Jugendliche von 10- 16 Jahren untergebracht. Das größte wurde im Staatsbad Podiebrad in Böhmen mit fast 10.000 Jugendlichen eingerichtet, die sich dort auf Hotels und Pensionen verteilten. Die Beschaffung geeigneter Unterkünfte wurde dadurch erleichtert, daß wäh-
189
rend des Krieges der Fremdenverkehr praktisch nicht mehr existierte.
Schwieriger war die personelle Besetzung zu lösen. Die wehrfähigen Männer zwischen 18 und 40 Jahren standen nicht zur Verfügung. Zurückgreifen konnten die Planer also nur auf Mädchen und Frauen sowie auf ältere Männer und nicht wehrfähige Jungen. "Lagerleiter" waren die aus der Heimat mitgekommenen Lehrer(innen) bzw. Schulleiter(innen). "Lagermannschaftsführer" waren ausgesuchte Jungvolkführer, die meist nicht älter als 16 Jahre waren. Die "Lagermädelschaftsführerinnen" konnten etwas älter sein, da sie ja nicht wehrpflichtig waren.
Die Lager waren also eine gemeinsame Veranstaltung von Lehrerschaft und HJ: Die Lehrer waren für den Unterricht zuständig und natürlich als Lagerleiter für rechtlich relevante Entscheidungen - schließlich galt auch hier das "Führerprinzip" -, während die HJ für die Freizeit und für die allgemeine Disziplin verantwortlich war. Die Zusammenarbeit zwischen beiden Instanzen scheint im großen und ganzen funktioniert zu haben, was sicherlich nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, daß es sich hier um eine Notsituation handelte, die für Kompetenzrivalitäten wenig Raum ließ. Schließlich waren die Väter Soldaten und die Mütter zu Hause an der "Heimatfront". Außerdem konnte die HJ ihre Erziehungsprinzipien in den Lagern durchsetzen. In einer für alle Lager gültigen Lagerordnung war festgelegt, daß es verboten war, schwere Arbeiten verrichten zu lassen, körperlich zu züchtigen, Kinder und Jugendliche in den Augen anderer herabzuwürdigen oder ihr Ehrgefühl zu verletzen, sowie Strafexerzieren und Nahrungsentzug zu verhängen.
Sensibilität war ohnehin geboten angesichts der relativ langen Trennung der Kinder von ihren Eltern, zudem noch unter Kriegsbedingungen. Man mußte darauf achten, die Eltern möglichst nicht zu beunruhigen. So bestand Schirach gegen Bormann darauf, daß Gelegenheit zum regelmäßigen Besuch des Gottesdienstes und zum seelsorgerischen Gespräch mit einem Geistlichen möglich war, und er wehrte auch Versuche von Wehrmacht und SS ab, die Lager zur vormilitärischen Ausbildung zu benutzen.
In der Literatur findet sich gelegentlich die Behauptung, Schirach und die HJ hätten die Lager zur besonders intensi-
190
ven weltanschaulichen Agitation und Indoktrination benutzt. Nun war in der Tat das Lager normalerweise das beliebteste nationalsozialistische Erziehungs-Arrangernent. Aber die kriegsbedingten Randbedingungen der KLV setzten hier enge Grenzen; denn "die HJ" in Gestalt junger, aber erwachsener Führer war praktisch nicht vorhanden und allenfalls von den Lehrern hätten entsprechende Einwirkungen ausgehen können; allein die Wahrscheinlichkeit spricht dafür, daß dies von Fall zu Fall auch geschehen ist, aber Schirachs verkündeten Absichten und Plänen entsprach dies nicht.
Das KLV-Projekt, an dem insgesamt etwa 4 Millionen Kinder und Jugendliche teilnahmen, dürfte vielen von ihnen das Leben gerettet haben und war eine bemerkenswerte soziale Leistung u.a. der HJ. Problematisch wurde die rechtzeitige Rückführung der Lager angesichts des Vormarsches der Roten Armee. Ohne Hitlers ausdrückliche Zustimmung durfte kein Lager zurückgeführt werden, aber Hitler war ab Ende 1944 nicht mehr erreichbar für die Verantwortlichen. Sie mußten auf eigene Faust handeln. Soweit bekannt ist es gelungen, die Kinder und Jugendlichen rechtzeitig ins "Alt-Reich" zurückzuführen. Lediglich in Ost-Brandenburg wurden zwei Lager von der Roten Armee überrollt.
Die größten Schwierigkeiten entstanden nach der Kapitulation, weil die Lager nun zum Beispiel im Hinblick auf die Verpflegung auf sich selbst angewiesen waren. Viele Kinder machten sich selbständig auf den Weg nach Hause, den geschlossenen Rücktransport mußten die Heimatgemeinden organisieren, was wegen des zusammengebrochenen Verkehrs wochenlang dauern konnte.
Die musisch-kulturelle Wende
Bis etwa 1936, als das HJ-Gesetz erlassen wurde, hatte sich die HJ organisatorisch einigermaßen konsolidiert. Nun aber tauchte das schon erwähnte Problem auf, was man mit einer Millionen-Organisation wie dieser nun eigentlich machen sollte, oder genauer: was diese Millionen von Mitgliedern nun in dieser Organisation tun sollten. Die "Kampfzeit" war längst vorbei. Zwar hielt sich die HJ für eine völkisch-nationale, in diesem Sinne also für eine politische Organisation,
191
aber aus der Sicht der Jugendlichen war sie eine Freizeitorganisation, und die wird auf die Dauer eben an der Attraktivität ihrer Angebote bewertet. Bisher beruhte der "Dienst" auf dem, was alle können, nämlich marschieren, singen, spielen und Sport treiben, aber das begann gerade deshalb uninteressant zu werden, weil alle es konnten, also für individuelle Interessen kein Raum war - jedenfalls nicht im Rahmen der Organisation. Damit war ein Dilemma entstanden. Blieb die HJ das, was sie war, dann drohte die Gefahr, daß viele Jugendliche zwar mehr oder weniger ihren "Dienst" versahen, mit ihren individuellen Interessen aber aus der HJ auszogen, um sie anderswo zu befriedigen. Gab die HJ aber solchen sachbezogenen Interessen nach, drohte sie zu einer riesigen Freizeitorganisation mit jeweils individuell wählbaren Angeboten zu werden und den Anspruch zu verlieren, eine einheitliche nationale Organisation für alle Jugendlichen zu sein. Schirach versuchte einen Kompromiß: Der für alle gültige gemeinsame "Dienst" blieb bestehen; er sollte weiterhin dazu dienen, die Jugendlichen "gemeinschaftsfähig" zu machen. Aber darüber hinaus sollten sie auch die Möglichkeit erhalten, sich zur "gemeinschaftsbezogenen Persönlichkeit" zu entwickeln.
Diese Wende zur sachorientierten Individualisierung, also zu dem, was eben nicht alle können oder wollen, ist bis zum Kriegsausbruch nur in Ansätzen zum Zuge gekommen. Speziell für die Jungen wurden über den normalen Dienst hinaus Sondereinheiten wie die Motor-, Marine-, Flieger-, Nachrichten- und Reiter-HJ geschaffen - gleichsam als zusätzliches Freizeitangebot.
Für die älteren Mädchen sollten die Arbeitsgemeinschaften von "Glaube und Schönheit" im freiwilligen Rahmen die individuelle Bildung fördern. Dabei war die Thematik prinzipiell nicht begrenzt - z.B. auf sogenannte "frauenspezifische" Themen. Es konnte sich auch um wissenschaftliche oder spezielle kulturelle Interessen handeln. Zunächst war man davon ausgegangen, daß die Mädchen mit 18 Jahren in die NS-Frauenschaft eintreten sollten. Es zeigte sich jedoch, daß viele Mädchen dieses Alters sich dazu noch nicht zugehörig fühlten, sich noch nicht als "Frau" im Sinne jener zum Teil wesentlich älteren Frauen und Mütter verstanden, die in der NS-Frauenschaft anzutreffen waren. Deshalb sollte ihnen Gelegenheit gegeben werden, noch einige Zeit unter Gleich-
192
altrigen individuellen Neigungen und Interessen nachgehen zu können - durchaus verstanden im Sinne einer Bildung der Persönlichkeit.
H. Lauterbacher berichtet in seinen Memoiren, Vorbild für "Glaube und Schönheit" sei eine englische weibliche Jugendorganisation namens "Health and Beauty" gewesen, die er bei einem Englandbesuch kennengelernt und über die er Schirach berichtet habe.
Aber die "musisch-kulturelle Wende" - Schirach selbst spricht von einer "Wende nach innen" - war grundsätzlicher gemeint, nämlich vom "soldatischen" Typus hin zum "musischen und soldatischen Typus". Der Ausdruck "Wende" könnte allerdings mißverstanden werden. Musisch-kulturelle Elemente hatte die HJ von Anfang an schon im Rahmen ihrer Fest- und Feiergestaltung aufzuweisen. Zudem war das Singen ein wichtiger Bestandteil jedes Heimabends. Aber bis 1936 hatten diese Elemente eine eher untergeordnete, instrumentelle Bedeutung, jedenfalls waren sie nicht konstitutiv für das erzieherische Selbstverständnis zumindest der männlichen HJ.
Anders allerdings bei den Mädchen: Man muß bedenken, daß die deutsche Jugendbewegung von Anfang an ein männliches Phänomen war, zugeschnitten auf die männliche Pubertät. Die Leitbilder des "Fahrenden Scholaren" - wie beim Wandervogel vor dem Ersten Weltkrieg - oder des "Weißen Ritters" - wie bei einem Teil der "bündischen Jugend" nach dem Ersten Weltkrieg - waren für Mädchen wenig attraktiv. Das gilt auch für das "soldatische" Leitbild der männlichen HJ, in dem Mädchen ebenfalls keinen rechten Platz fanden - ganz abgesehen davon, daß im Gleichschritt marschierende Mädchen, die dann im Geländespiel miteinander raufen, weder dem Frauenbild der Nazis noch dem Geschmack der damaligen Mehrheit der Bevölkerung entsprachen. Auch das Ideal der "Mutter", die den heimischen Herd umsorgt, möglichst viele Kinder zur Welt bringt und aufzieht - das schon damals eher ein männliches als ein weibliches NS-Leitbild war -, läßt sich schwerlich in den Alltag von 10-14jährigen Mädchen umsetzen. In der Tat spielte dieses Ideal in der Arbeit der Jungmädel und des BDM eine untergeordnete Rolle und trat erst in der Altersphase von "Glaube und Schönheit" deutlicher hervor. Wollte man damals vielmehr
193
den Mädchen wie den Jungen ein eigentümliches Jugendleben arrangieren und dies wieder unter dem Aspekt des chancengleichen Zugangs für jedes Mädchen, dann blieb neben dem Sport und der damit verbundenen Gesundheitserziehung nur der musisch-kulturelle Bereich übrig, der hier tatsächlich von Anfang an eine größere Bedeutung hatte als bei den Jungen. Während die Jungen noch die Marschlieder aus der Kampfzone ertönen ließen, sangen die Mädchen eher Volkslieder, die der Jahreszeit und den Festtagen entsprachen. Gemeinsame Spiele, Handarbeiten, Basteln - z.B. Weihnachtsgeschenke für Kinder armer Familien - kamen hinzu.
Diesen eher musischen als soldatischen Stil wollte Schirach ab etwa 1937 auf die ganze HJ übertragen, und zwar im Sinne einer Spitzen- und Breitenarbeit. Äußere Höhepunkte dieser neuen Entwicklung waren die seit 1937 jeweils im Juni stattfindenden "Kulturtage" in Weimar. Eingeladen wurden dazu das Führerkorps von HJ und BDM, die besten Schülerinnen und Schüler und die Sieger des Reichsberufswettkampfes. Auf dem Programm standen Theateraufführungen mit Werken der deutschen Klassik, Meisterkonzerte, Lesungen und Leistungsschauen junger Künstler.
Schirach nutzte diese Gelegenheit zu programmatischen Reden. Dabei stützte er das neue musische Konzept vor allem auf Goethes Anschauungen über Bildung und Erziehung mit dem Ziel, die HJ in der nationalen Tradition der deutschen Klassik kulturell zu verankern. Seine Berufung auf Goethe war nicht das Ergebnis wissenschaftlich-philologischer Analysen, sondern - wie bei Schirach üblich - eher intuitiv und emotional, und sie war insofern nicht ganz unproblematisch, als Hitler ein gespaltenes Verhältnis zu Goethe hatte; er verübelte ihm seine weltbürgerliche Haltung und sein Freimaurertum. Trotzdem ließ er Schirach gewähren.
Ab 1937 wurde auch die musisch-kulturelle Breitenarbeit forciert. Die Jungen und Mädchen wurden aufgefordert, ein Instrument spielen zu lernen. Zu diesem Zweck wurden ab 1937 in Zusammenarbeit mit KdF -der Freizeitorganisation der DAF - "Musikschulen für Jugend und Volk" eingerichtet, in denen im Unterschied zum teuren Privatunterricht der Instrumentalunterricht relativ preiswert erteilt werden konnte. Bis 1939 gab es bereits 66 Schulen mit 700 Lehr-
194
kräften, Mitte der 40er Jahre waren es 120 Schulen, aber nun gab es kriegsbedingt auch einen Mangel an Lehrkräften. Zudem wurde ab Oktober 1943 die Herstellung von Musikinstrumenten aus kriegsbedingten Gründen verboten.
Auch diese Musikschulen, die es bis heute gibt, waren keine Erfindung der HJ. Sie waren schon vor 1933 im Rahmen der "Jugendmusikbewegung" gegen den starken Widerstand der Berufsmusiker entstanden, die dadurch für sich wirtschaftliche Nachteile befürchteten. Diese "Jugendmusikbewegung" stand in Frontstellung zum offiziellen bürgerlichen Konzertbetrieb, der auf der Trennung von Musikern und Publikum beruhte. Demgegenüber wollte die neue Bewegung die Gemeinschaftsbezogenheit des Singens und Musizierens wieder zur Geltung bringen. Ziel war nicht professionelle Perfektion, sondern das gemeinsam geschaffene musikalische Erlebnis. Durch das sogenannte "offene Singen" sollte die Distanz von Musikern und Publikum überwunden werden. Bekannte und neugeschaffene, einfach zu singende Lieder konnten von allen Anwesenden mitgesungen werden, die Chor- und Instrumentalsätze wurden entsprechend komponiert - ähnlich wie die Orgel den Gesang der Gemeinde in der Kirche begleitet. Eine ganze Reihe von jungen Komponisten und "Liedermachern" - von denen Hans Baumann am bekanntesten wurde - stellten sich für Schirachs Konzept zur Verfügung, der sich im übrigen nicht scheute, sich auch mit fremden Federn zu schmücken; so wurde etwa der berühmte Leipziger Thomanerchor zu einer "Einheit" der HJ.
Das Ideal des "musischen Menschen" war der gemeinschaftsbezogene Mensch, der Körper, Geist und Seele harmonisch ausbalancieren kann. Diese aufs Laientum setzende "Jugendkultur" der HJ wurde von Fachleuten schon damals kritisiert, etwa mit der Begründung, daß der rein erlebnishafte Zugang zum Dilettantismus führe und das sachbezogene Verständnis von Kunst und Musik verhindere.
Es wäre jedoch einseitig zu sagen, die HJ sei in einer jugendspezifischen, von der offiziellen Kunst strikt getrennten Kultur steckengeblieben. Bei den "Spielscharen", die sie gründete - Theater- oder Chor/Instrumentalgruppen -, waren die Übergänge fließend - je nach künstlerischem Ehrgeiz. "Werktreue" war jedenfalls nicht verpönt. Im Jahre 1942 gab
195
es 550 solcher Einheiten, in denen ca. 130.000 Jungen und Mädchen tätig waren.
Eine Brücke zur offiziellen Kunst-Kultur bildete ein "Veranstaltungsring" der HJ, der den Mitgliedern preiswerte Besuche von Konzerten und Theateraufführungen ermöglichte.
Mit der Rückbesinnung auf die eigene klassische nationale Tradition ging einher die Öffnung nach außen, zu anderen Völkern, so auch zu den früheren Kriegsgegnern Frankreich und England. Das Heft Nr. 6/1938 von "Wille und Macht" war dem Thema England gewidmet und enthielt Grußworte von Premierminister Chamberlain und von Lord Halifax.
Das Jahr 1938 steckte bekanntlich voller außenpolitischer Krisen, die dann ein Jahr später auch zum Krieg führten. So mag aus der Rückschau die Zuwendung der HJ zu den ehemaligen - und auch wieder künftigen! - Kriegsgegnern als taktisches Spiel erscheinen, ja, als Heuchelei. Nichts spricht jedoch dafür, daß die HJ diese Kontakte nicht ehrlich gemeint hat. Schirach glaubte tatsächlich an eine friedliche Zusammenarbeit mit der Jugend anderer Völker. Die nationalsozialistische Weltanschauung verstand er nicht imperial, vielmehr bezeichnete er sie öffentlich als eine rein deutsche Sache, die auf andere Völker nicht übertragbar sei.
Daß Hitler
- wie wir
heute wissen - 1938 bereits zum Krieg entschlossen war, steht auf einem
anderen Blatt und läßt die Vermutung zu, daß er
Schirachs
Verständigungsversuche in sein taktisches Kalkül einbezogen
hat.
Schirachs pädagogischer Ehrgeiz blieb nicht auf die HJ beschränkt, er wollte auch die Schule verändern. Bis in die Kriegszeit hinein unternahm er Versuche, ein Jugendministerium unter seiner Leitung zu etablieren, dem auch das Schulwesen unterstehen sollte. In den Jahren von 1933 - 1939 war das Verhältnis von HJ und Schule mehr oder weniger gespannt. In den Schulen selbst entstanden Konflikte einfach schon dadurch, daß den Lehrern vielfach HJ-Mitglieder und -Führer gegenübersaßen, die sich nicht mehr als "Pennäler" behandeln ließen. Jugendliche Überheblichkeit und gesundes Selbstbewußtsein lagen dicht beieinander, und viele Lehrer fürchteten, wegen ideologisch mißliebiger Äußerungen denunziert oder zumindest vor der Klasse in unangenehme Diskussionen verwickelt zu werden; beides kam vor.
Auf der oberen Ebene - Reichsjugendführung und Erziehungsministerium - waren Konflikte schon deshalb unvermeidlich, weil in Gestalt der HJ zum ersten Mal ein außerschulischer Jugendverband den Anspruch erhoben hatte, neben der Schule als eigenständiger Erziehungsfaktor anerkannt zu werden - was ja auch im HJ-Gesetz zum Ausdruck gekommen war. Vor 1933 war ein solcher Anspruch mit Blick auf die Schulen nie gestellt worden; Wandervogel und bündische Jugend hielten ihre Veranstaltungen in der Freizeit der Jugendlichen ab, und es konnte den Schulen ziemlich gleichgültig bleiben, was sie dabei an pädagogischen Vorstellungen und Praktiken entwickelten, solange die inneren Normen, Regelungen und pädagogischen Grundsätze der Schule davon nicht berührt wurden.
Diese klare Trennung - Schule ist Schule und Jugendarbeit ist Freizeit - ließ sich nun nicht mehr einfach aufrechterhalten, weil die HJ ja einen völkisch-nationalen Erziehungsanspruch in einem gesamtpolitischen Sinne erhob, sie wollte mehr als nur ein außerschulischer Freizeitverein sein. Deshalb mußte die Frage auftauchen, ob und in welcher Weise auch die Schule Grundsätze der nationalsozialistischen Erziehungskonzeption übernehmen müsse, wie sie die HJ entwickelt hatte. Es ging "um die Einheit der Erziehung", wie der Titel einer Rede hieß, die Schirach am 24. Mai 1938 vor der Führerschaft der HJ in Weimar gehalten hat. Diese Rede löste eine breite öffentliche Diskussion gerade auch in der Lehrerschaft aus. Sie ist insofern bemerkenswert, als sie im Unterschied zu anderen Reden Schirachs verhältnismäßig systematisch aufgebaut, weniger sprunghaft und auch relativ unpathetisch ist. Zudem galt sie in den Reihen der HJ als eine vielzitierte programmatische Äußerung, so daß sie hier etwas ausführlicher dokumentiert werden soll.
Damals - 1938 - gab es mehr oder weniger deutliche Kritik an der HJ. Zunehmendes Desinteresse am "Dienst" und steigende Disziplinschwierigkeiten wurden schon erwähnt. Gravierender aber war, daß ein erheblicher Lehrermangel einge-
197
treten war, was um so schwerer wog, als die seit 1936 erfolgende Aufrüstung qualifizierte Facharbeiter erforderte, an denen es nun mangelte. Der HJ wurde vorgeworfen, durch ihre schulfeindliche Haltung zu diesem Übel beigetragen zu haben. Der pädagogische Wind begann sich zu drehen, und die Erziehungsansprüche der HJ drohten zu einem Hemmnis zu werden. Wie wir gesehen haben, begann auch Kriecks Stern ab 1936 nicht zuletzt deshalb zu verblassen, weil seine pädagogische Konzeption für die Effektivierung des Schulunterrichts und der beruflichen Qualifizierung nichts hergab. Schirachs "musische Wende" kollidierte allmählich mit der von Wirtschaft und Partei geforderten technokratischen Wende.
Auf diesem Hintergrund bestimmte Schirach in seiner Rede das Verhältnis der HJ zur Schule so:
"Die Hitlerjugend will nicht der alleinige Erziehungsfaktor für die Jugend unseres Volkes sein. Ihre sachlichen Auseinandersetzungen mit der Schule sind nicht durch Machtstreben bedingt. Es ist notwendig, zu erkennen, daß die Führerschaft unserer Jugend nicht aus Verwaltern von Organisationsdienststellen besteht, sondern aus Trägern und Bekennern einer erzieherischen Anschauung, die ohne weiteres auch im schulischen Leben verwirklicht werden kann. Die Selbstverantwortung der Jugend ist auch in der Schule denkbar" (Schirach 1938, 112).
Das Prinzip, Jugend solle von Jugend geführt werden, sollte also auch in die Schule einziehen - nicht, um die Qualität des Unterrichts zu beeinträchtigen, wie Schirach ausdrücklich beteuerte, sondern um den Geist der Schule, das "Schulleben", zu verändern. Seine Kritik der bestehenden Schule faßte er in folgenden Punkten zusammen:
Sie habe im allgemeinen die falschen Lehrer. "Was wir brauchen, ist eine Lehrerschaft, die eine charakterliche Auslese bedeutet. Leider entscheidet sich mancher Student für den Lehrberuf, weil er an die Versorgung denkt. Es liegt auf der Hand, daß solche Naturen keine positiven erzieherischen Fähigkeiten besitzen können, denn wer den Lehrberuf ausschließlich wegen der späteren Pensionierung erwählt, dürfte kaum geeignet sein, der heranwachsenden Generation eine idealistische Lebensauffassung zu vermitteln. Das Amt des Erziehers verlangt nach Selbstlosigkeit und völliger Hingabe
198
an ein höchstes Ideal; der wahre Erzieher wird zuletzt nach Versorgung fragen. Jener, leider nicht seltene Typ des Lehrbeamten wirkt nach absolviertem Staatsexamen gleichsam als Automat für wissenschaftliche Bildung, indem er seine sämtlichen Dienstjahre hindurch seinen Lehrstoff, das geheiligte 'Pensum', in täglichen Dosen jahraus, jahrein verabfolgt. Wenn aus der Klasse heraus, die das Objekt dieser sogenannten Erziehung darstellt, ein leiser Widerspruch laut wird, wird sie mit dem in napoleonischer Haltung verkündeten Satz 'Wissen ist Macht', zur Raison gebracht. Mit diesem Schlagwort sind ganze Jahrgänge von Natur aus selbständiger junger Deutscher in der Schule niedergeschmettert worden" (Schirach 1938, 114).
"Gerade die selbständigen Naturen" würden "in der Schule meist als störend empfunden". "Oft wurde als Böswilligkeit und Trotz hart unterdrückt, was in Wirklichkeit nichts anderes als die erste Offenbarung einer wirklichen Führernatur war. Und leider wurde oft in frühester Jugend diese Selbständigkeit einer erwachenden Persönlichkeit brutal gebrochen, damit das Schema siege und mit dem Schema die brave Mittelmäßigkeit" (115). Aber die Musterschüler dieser Art von Schule seien keineswegs auch immer die gewesen, die dann den Aufgaben des Lebens standgehalten hätten. Viel Wissen sei noch lange nicht Bildung.
"Wer die Jugend erziehen will, muß sie ehrfürchtig machen und begeistern können. Denn ohne Ehrfurcht und Begeisterung ist ebensowenig eine Erziehung wie ein höheres menschliches Dasein denkbar. Wie weit aber hat sich das humanistische Gymnasium von diesem Ideal entfernt! Livius Geschichte Roms wird auf den lateinischen Satzbau hin wissenschaftlich untersucht, und die ewige Dichtung Homers wird auf Befehl amusischer Studienräte zergliedert und auswendig gelernt, statt erlebt. Gelingt es doch, selbst die Deutschstunde zu einer im Sinne Lessings tragischen Begebenheit, das heißt zu einem Mitleid und Furcht erweckenden Schauspiel zu veröden. Wir wollen keine Einzelfälle verallgemeinern, aber ist es nicht so, daß der Mehrzahl unserer höheren Schüler die große klassische Dichtung ihrer Nation systematisch verekelt wurde? Muß ein Nationalheiligtum wie der 'Faust' unbedingt so zerpflückt und 'erklärt' werden, daß er 18jährige deutsche Jungen mit einer Angstpsychose vor ihrer Deutschstunde erfüllt? Ganz zu schweigen von den belieb-
199
ten Aufsatzthemen ,In wieweit lassen sich Schillers Wilhelm Tell und Goethes Egmont vergleichen, und worin unterscheiden oder ähneln sich die Freiheitsideen beider?'" (Schirach 1938, 115 f.).
Da könne es nicht verwundern, wenn Schüler und Lehrer sich feindlich gegenüberstünden und wenn selbst gutwillige Lehrer davon ausgingen, daß das Prinzip der Selbstführung nach aller pädagogischer Erfahrung versagen müsse.
Aber "dieselbe Klasse, die am Vormittag einen verdienten Studienrat bei der Klassenarbeit beschwindelte, in die Schulbänke vielerlei Unsinn schnitzte und sich ganz allgemein rüpelhaft betrug, ist am Abend desselben Tages in einem Heim der Hitlerjugend versammelt, um einen Schulungsvortrag anzuhören, und gibt dabei ein Musterbeispiel jugendlicher Zucht und Disziplin. Das Heim selbst, das von einem Gleichaltrigen verwaltet wird, befindet sich in musterhafter Ordnung, und es ist ganz undenkbar, daß ein Angehöriger der Gemeinschaft einen Einrichtungsgegenstand mutwillig beschädigen würde. Dieselbe Klasse, die einem gereiften Mann inneren und äußeren Widerstand entgegensetzt, wenn er sie zur Ordnung ruft und im Verfolg des ihm vom Staat erteilten Auftrags disziplinieren möchte, folgt am Abend mit innerer Bereitschaft und Freude dem Befehl eines jungen Kameraden, der wesentlich höhere Ansprüche an ihre Disziplin stellt als auch der strengste Lehrer" (117 f.).
In der Schule jedoch kenne die Klasse nur eine "Ehre: unbedingter Zusammenhalt gegen den Lehrer als Feind und kompromißloser Kampf gegen jeden Verräter der Klassengemeinschaft. Es ist dies nichts anderes als eine natürliche Reaktion auf die dauernde Beaufsichtigung und Gängelung, zu der der Lehrer verpflichtet ist. Die Stellung eines Ordnungsbeamten, eines Polizisten in der Klasse, ist der Klasse genauso unwürdig wie des Lehrers selbst".
Ganz anders wiederum bei der Hitlerjugend: "In den Führerschulen der Hitlerjugend ist der Vortragende ein Freund und Kamerad seiner Zuhörer. Der Gedanke, daß diese Zuhörer während seines Vortrags Schabernack üben oder es an der nötigen Ehrerbietung fehlen lassen, erscheint jedem, der unsere Führerschulen kennt, lächerlich. Das Bild einer solchen Unordnung würde gegen den Geist der Gemeinschaft verstoßen, und die Gemeinschaft selbst würde einen Störenfried
200
zurechtweisen und mit der Verachtung strafen. Es ist wunderbar und beglückend, daß die Jugend nichts so sehr anspornt als das Vertrauen, das man in sie setzt. Sobald sie empfindet, daß man ihr mehr Vertrauen schenkt, als sie zu empfangen gewohnt ist, wächst in ihr der Trieb, sich dieses Vertrauens würdig zu erweisen. Nun wird mancher Lehrer aus seiner Erfahrung heraus hiergegen einwenden, daß sich doch in jeder Klasse auch Elemente minderen Wertes befinden, eben jene Elemente, die ihm fortgesetzt Schwierigkeiten bereiten. Ich erwidere hierauf. Diese Elemente kann niemals der Lehrer überwinden, sondern nur die Klasse selbst. Welcher vernünftige Mensch könnte annehmen, daß ein oder zwei Böswillige auf die Dauer stärker sein könnten als dreißig Anständige?" (Schirach 1938, 119 f.).
Und schließlich die Quintessenz aus allem: "Wenn man ein Schulsystem aufbauen würde, innerhalb dessen die Jugend selbst für die Schülerschaft verantwortlich ist, würde es zwischen Lehrerschaft und Schülerschaft im allgemeinen keine Feindschaft mehr geben. Und der Lehrer erhielte damit jene Freiheit und Würde, die mit seinem Amt verbunden sein sollte, aber nicht verbunden ist" (120).
Die HJ sehe im Lehrer keinen Feind, denn schließlich arbeiteten in ihr über 10.000 Lehrer freiwillig mit.
"Ich bin nicht glücklich darüber, daß die Stellung des Lehrers schwindet und die des Jugendführers steigt. Es befriedigt mich weder das eine noch das andere. Ich will auch nicht die Jugend gegen die Schule mobilisieren, wie sich mancher Lehrer vorstellen mag. Auch dieses Führerkorps soll nicht mit Worten oder Handlungen gegen die bestehende Einrichtung der Schule Opposition treiben. Ich spreche hier nur, um Klarheit zu schaffen, nicht um zu opponieren" (123).
Klarmachen wollte Schirach vor allem dies: Der hauptberufliche Jugendführer, dessen Ausbildung an der "Akademie für Jugendführung" in Braunschweig bereits geplant war, sollte einem Mangel aus dem Wege gehen können, der dem Lehrerberuf so nachhaltig anhatte: der ausschließlichen Fixierung auf eine bestimmte pädagogische Tätigkeit bis zur Pensionierung:
"Wir glauben an die Sendung des nationalsozialistischen Jugendführers. Wir glauben, daß eine unaufhaltsame Entwick-
201
lung dahin treibt, daß der Erzieher der Zukunft während der verschiedenen Stationen seines Lebens und Dienstes auch verschiedene erzieherische Funktionen ausüben wird. So sehen wir ihn zunächst als Jugendführer, der durch jährliche Übungen sich für seine spätere Funktion als Volksschullehrer vorbereitet. Wir sehen ihn dann in diesem Amte, wie er als Jugendlicher und durch Dienst und Rang mit der Jugend verbundener Nationalsozialist im gleichen Gerste unterrichtet, in dem er bisher geführt hat. Wir sehen ihn dann nach einigen Jahren auf der weiteren Wanderschaft wieder im aktiven Dienst der Jugendführung, aber diesmal mit höherer Verantwortung. Dann als Erzieher an einer Adolf-Hitler-Schule, später in einer deutschen Schule des Auslandes oder im Amt für weltanschauliche Schulung. Vielleicht begegnen wir diesem Mann später auf einem Lehrstuhl der Akademie für Jugendführung,... ganz genau kann man den Weg dieses Mannes nicht bezeichnen, weil wegen der ungeheuren Weite dieser Ausbildung der Möglichkeiten so viele sind, daß sie sich gar nicht übersehen lassen. Eines weiß ich ganz genau: Dieser Mann wird nicht bis zu seinem vollendeten 65. Lebensjahr Tag für Tag auf dem Katheder sitzen! Er wird nicht tagtäglich um 12.45 Uhr das Buch zuklappen, aus dem er zum siebenhundertunddreiundvierzigsten Mal seine Lektion verkündet hat, um nach Hause zu gehen, gut und reichlich zu essen, ein Mittagsschläfchen zu halten, Kaffee zu trinken, seine Zeitung zu lesen, seine Zigarre zu rauchen usw., kurz um mit dem Zeichen einer Glocke das für 24 Stunden zu vergessen, was er niemals auch für eine Stunde seines Daseins vergessen darf-. die erzieherische Sendung." (Schirach 1938, 124 f.)
Solche Schulmeister-Kritik mußte natürlich die jungen Leute begeistern, und sie konnte als dunkle Folie dienen, auf der sich um so strahlender das eigene Konzept des neuen Allround-Erziehers projizieren ließ:
"Der Jugendführer und Erzieher der Zukunft wird ein Priester des nationalsozialistischen Glaubens und ein Offizier des nationalsozialistischen Dienstes sein. Er wird aber auch Träger sein jener weltweiten Bildung, die für alle Generationen und auch für alle Völker jener große Deutsche verkörpert, der in dieser Stadt seine irdischen Augen schloß, um seine ewigen für immer zu öffnen und auf uns zu richten. Im Bannstrahl dieser Sterne wird der Erzieher der Zukunft für die ihm anvertraute, nicht nach Wissen, aber Bildung hun-
202
gernde Jugend jenes höchste Glück bringen, das nach Goethes ewigem Gesetz den Erdenkindern nur durch die Persönlichkeit offenbart werden kann. Ich sehe sie alle vor mir, diese körper- und geistgestählten Kameraden, die nicht Schulmeister sein werden, sondern Meister des Lebens. Ihrer Gemeinschaft angehören zu dürfen, wird so viel Ehre bedeuten, daß zehntausend junger Menschen mit heißem Herzen kämpfen werden, um dieser Ehre würdig zu werden. Diese Mannschaft von morgen wird nicht mit erhobenem Zeigefinger vor die Jugend treten und sie mit lateinischen Sprüchen ermahnen" (125).
Schirach schob den "schwarzen Peter" also an die Schule zurück: nicht die HJ sei für den Lehrermangel und für das Desinteresse am Lehrerberuf verantwortlich; vielmehr sei die Schule in ihrer gegenwärtigen pädagogischen Verfassung unattraktiv geworden, und nur durch einen Lehrertypus, der über die HJ heranwachse und dem später nicht die Fixierung auf eine bestimmte pädagogische Tätigkeit drohe, sei Abhilfe möglich.
Schirach konnte den Mund nicht zuletzt deshalb so voll nehmen, weil er seit eineinhalb Jahren selbst Schulträger geworden war. Nachdem er bis 1936 erfolglos über eine Reform der Schule mit Erziehungsminister Rust verhandelt hatte, gründete er gemeinsam mit Robert Ley am 17.1.1937 die "Adolf-Hitler-Schulen" (AHS); Hitler hatte dieses Vorhaben zwei Tage vorher genehmigt. Ley hatte deshalb ein Interesse daran, weil er mit den sogenannten "Ordensburgen" bereits Erwachsenenbildungsstätten für den Führernachwuchs eingerichtet hatte, denen aber der Unterbau fehlte.
Die AHS unterstanden nicht Erziehungsminister Rust - der von diesem Projekt überfahren wurde -, sondern der HJ als deren "Einheiten". Sie umfaßten sechs Schuljahre, nahmen solche Jungen ab vollendetem 12. Lebensjahr auf, die sich im Jungvolk bewährt hatten, und schlossen mit einer dem normalen Abitur vergleichbaren Reifeprüfung ab, die allerdings erst 1942 von Rust als gleichwertig anerkannt wurde, nachdem im Lehrplan der AHS einige Veränderungen vorgenommen worden waren. Dieser Schultyp galt - im Unterschied zu den erwähnten NPEA - als leistungsschwach, und Rust wollte - wie im vorausgehenden Kapitel erwähnt - den Leistungsstandard der Oberschule unbedingt hochhalten. Den Absolventen
203
der AHS sollten alle Laufbahnen in Partei und Staat offenstehen. Auch für Mädchen waren solche Schulen geplant, aber ihre Realisierung wurde durch den Krieg verhindert.
Anders als in den staatlichen Schulen ließ sich hier Schirachs "Einheit der Erziehung" zumindest zum Teil verwirklichen. Der Lehrplan unterschied sich zwar nicht wesentlich von dem der staatlichen Gymnasien. Aber die Beziehung zwischen Lehrern (hier "Erzieher" genannt) und Schülern war von besonderer Art, es sollte ein Führer-Gefolgschaftsverhältnis sein, der Pädagoge sollte sich als Lehrer und Jugendführer in einer Person verstehen - ein "Vorbild" sein, dem von der Seite des Jungen "Vertrauen" entgegengebracht werden konnte. Äußerer Ausdruck dieser Art von pädagogischer Beziehung war die für die HJ im ganzen charakteristische Du-Anrede. Das Zusammenleben sollte erzieherisch gestaltet werden, und zwar durch die Jungen selbst im Sinne einer "Selbsterziehungsschule". Normativer Kern dieser Selbsterziehung sollte die "Ehre" sein. So wurden die Klassenarbeiten ohne Lehreraufsicht geschrieben, "mogeln" galt als unehrenhaft. Wichtige reformpädagogische Ideen aus der Zeit vor 1933 wurden wieder aufgegriffen. Der Frontalunterricht wurde durch das Arbeitsgespräch ersetzt, die starre, auf den Lehrer orientierte Sitzordnung zugunsten einer Hufeisenform der Tische abgeschafft. Gruppenarbeit wurde eingeführt. Der Unterricht sollte "erlebnisorientiert", das Lernen in Form eines geistigen Wettbewerbs gestaltet werden. Neben der intellektuellen Ausbildung und dem Sport nahm die musische Bildung einen verhältnismäßig breiten Raum ein, der HJ-Dienst und andere "Einsätze" fanden in den Einheiten außerhalb des Internates statt, um eine soziale und geistige Isolierung der Schüler zu vermeiden. Nicht der Typus des individuellen "Intellektuellen" sollte aus der Schule hervorgehen, sondern ein harmonisch gebildeter, dabei bescheidener und disziplinierter junger Mann, der selbständig, verantwortungsbereit und kritisch zu denken und zu handeln gelernt hatte. Die "Elite" für Partei und Staat, die aus diesen Schulen hervorging, sollte nicht dogmatisch borniert sein, sondern Führungsqualitäten erworben haben. Dazu gehörte auch die Auseinandersetzung mit gegnerischen politischen und weltanschaulichen Positionen; entsprechende Literatur, die sonst verboten war, stand den Schülern dafür zur Verfügung.
204
Auch im Falle der AHS - die im übrigen einschließlich Unterkunft und Verpflegung kostenlos war - gelang es Schirach, Parteieinflüsse weitgehend auszuschalten. Mit Robert Ley, der die Schulen zunächst finanzierte und formell auch zusammen mit Schirach Schulträger war - ab 1942 übernahm das die Kasse der NSDAP - gab es zwar Anfangs Kontroversen über den Lehrplan und das pädagogische Konzept, aber die RJF konnte sich durchsetzen und Schirach ließ dem Erzieherkorps einen weiten Spielraum dafür, Erfahrungen zu machen; denn für viele Einzelheiten gab es keine rechten Vorerfahrungen, an die man hätte anknüpfen können. Zwar waren fast alle pädagogischen Einfälle, die hier zum Zuge kamen, bereits in der Reformpädagogik vor 1933 vorgedacht und teilweise praktiziert worden - nicht zuletzt in den an Hermann-Lietz orientierten Schulen, von denen Schirach eine als Schüler besucht hatte -, aber das Konzept im ganzen war neu und bedurfte der allmählichen Konsolidierung und Korrektur. Es war gewissermaßen ein schulpädagogisches Experiment.
In späteren literarischen Äußerungen damals Beteiligter (z.B. Klüver, Rüdiger 1983, 1984) wird unter anderem betont, daß die Erziehung zur Kritikfähigkeit durchaus ernst gemeint gewesen sei. Dabei wird auf folgendes Paradebeispiel hingewiesen:
Nach der Abiturprüfung der AH-Schüler 1941 in Sonthofen habe Ley zu einem Bierabend eingeladen. Dabei sei er mit kritischen Fragen zu seiner Person konfrontiert worden: Ob er wisse, daß er im Volk als Trinker gelte; ob es richtig sei, daß er seine treue Gattin verlassen und eine jüngere Frau geheiratet habe. Ley habe diese Fragen geduldig und offen beantwortet. Am nächsten Morgen habe - vorher nicht geplant - ein Appell aller AH-Schüler vor Ley stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit habe er erklärt, die vorangegangene Unterhaltung mit den Abiturienten habe ihn erkennen lassen, daß er nicht mehr die charakterliche Integrität besitze, um Vorbild für die AH-Schüler zu sein; er trete deshalb von der Leitung der AH-Schulen zurück.
Dieser Vorfall scheint hinreichend verbürgt, unter anderem durch eine eidesstattliche Erklärung eines Lehrers, der dabei war (Rüdiger 1983, Anhang S. 59). Aber was sagt er über "Kritikfähigkeit" aus? Gewiß gehörte damals Mut dazu, mit einer
205
Parteigröße wie Ley derart zu reden; das wird schon daraus deutlich, daß Ley am Ende jenes Bierabends ausdrücklich erklärte, er verbitte sich jede Maßnahme gegen AH-Schüler und deren Lehrer in dieser Sache. Andererseits war Gegenstand der Kritik rein Privates, nichts Politisches, gemessen zudem an Maßstäben, die "systemimmanent" waren: Wenn charakterlich einwandfreie "Führer" die pädagogische Norm sein sollten, dann mußten eben auch solche Personen zumindest aus erzieherischen Zusammenhängen zurücktreten, die dieser Norm gerade auch in den Augen der Öffentlichkeit nicht entsprachen; denn Leys Sauf- und Frauengeschichten waren kein Geheimnis. Insofern zeigten die Abiturienten in dieser Szene nur, daß sie den Anspruch, ein Führer müsse in jeder Hinsicht Vorbild sein, ernstnahmen, eine darüber hinausgehende, zum Beispiel sachlich-politische Kritikfähigkeit läßt sich daraus aber nicht ableiten - was wiederum nicht heißen muß, daß es sie nicht etwa im Arbeitsunterricht der Schule gegeben habe.
Diese Szene läßt aber vielleicht noch etwas anderes erkennen. Es ist bekannt, daß im Führerkorps der HJ vor allem in den Kriegsjahren die Hoffnung zunahm, man könne nach dem Krieg gemeinsam mit Hitler unter den "Bonzen" aufräumen. Das in der HJ und vor allem auch in den AHS gezüchtete Elitebewußtsein hätte sich auf Dauer also auch innenpolitisch bemerkbar machen können, zumal auch darüber nachgedacht wurde, was eigentlich mit dem NS-Staat geschehen solle, wenn Hitler einmal abgetreten sei; denn wer immer sein Amtsnachfolger hätte werden sollen, die integrierende charismatische Ausstrahlung und Bedeutung Hitlers hätte er nicht erben können, so daß von daher schon strukturelle innenpolitische Veränderungen notwendig geworden wären. Aber dazu ist es bekanntlich nicht gekommen.
Für das ehrgeizige Projekt der AHS wurde ein Erziehertyp gebraucht, der nicht leicht zu finden war: eine Kombination von Jugendführer, wissenschaftlich qualifizierter Lehrkraft und überdurchschnittlich qualifiziertem Pädagogen. Aus dem normalen Philologiestudiengang an der Universität war dieser Typ nicht zu gewinnen. Deshalb wurde 1937 eine eigene "Erzieher-Akademie" gegründet.
Ausgesuchten HJ- und DJ-Führern wurde eine zweiphasige Ausbildung angeboten. Die ersten vier Semester wurden an
206
dieser Akademie in Sonthofen. absolviert - mit Praxisorientierung vom ersten Semester an. Für die Lehre wurden junge Dozenten gewonnen, die sich bereits habilitiert hatten oder kurz davor standen, außerdem Gastprofessoren vor allem von der benachbarten Universität München. Diese erste Phase des Studiums konnte deshalb besonders intensiv und effektiv sein, weil sie unter Internatsbedingungen stattfand und wegen der vergleichsweise geringen Studentenzahlen - zu wenig z.B. für Vorlesungen, so daß die dominante Lehrform das Seminar war.
In der zweiten Phase konnten die Studierenden vier bis sechs Semester nach eigener Entscheidung an einer Universität studieren mit dem Abschlußziel der Lehrbefähigung und der Promotion.
Das Beispiel der "Erzieher-Akademie" verweist auf ein weiteres Charakteristikum der HJ-Aktivitäten: die Schulungs- und Fortbildungsarbeit. Es gab so gut wie keine Aktivität - vom normalen "Dienst" über die sachbezogenen Spezialprojekte wie die "Spielscharen" bis hin zur KLV -, die nicht mit einem derartigen Schulungsangebot bzw. mit einer entsprechenden Verpflichtung verbunden waren. Noch nie zuvor hatte es in Europa eine außerschulische pädagogische Mobilisierung solchen Ausmaßes gegeben. Man arbeitete dabei nicht intuitiv, sondern nach Lehr- bzw. Schulungsplänen, und da es für die meisten Projekte dieser Art keine Vorbilder gab, mußte experimentiert werden, d.h. Schulungskonzepte mußten immer wieder aufgrund neuer Erfahrungen revidiert werden. Da solche offenen Handlungssituationen gerade für junge Menschen eine gewisse Faszination ausstrahlen, weil sie Chancen eines persönlichen Erfolges enthalten, die einem fest reglementierten System wie der Schule weitgehend fehlen, kann es nicht verwundern, daß junge Erzieher, Künstler und Wissenschaftler sich für solche Konzepte nicht ungern ehrenamtlich oder nebenamtlich zur Verfügung stellten, zumal für Schirach "Parteizugehörigkeit" eine untergeordnete Rolle spielte.
Natürlich war dieser Aktivismus wie alle Aktivitäten während des Dritten Reiches doppeldeutig. Einerseits wirkte er ideologisch bindend und integrationsfördernd. Andererseits erhielten aber auch viele junge Menschen Chancen, sich auf irgendeinem Gebiet außerhalb von Schule oder Beruf weiter-
207
zubilden. Diese unmittelbare Erfahrung dürfte bei den meisten dominiert haben, weniger die Tendenz der ideologischen Bindung, die man entweder kaum wahrnahm oder gegen die man nichts einzuwenden hatte, solange die damit verbundenen Erlebnisse positiv waren. Jedenfalls umgab die HJ zumindest in den wenigen Friedensjahren eine Aura von "pädagogischem Reizklima", das die Bereitschaft zum Lernen und zur Fortbildung animierte und honorierte.
Es würde zu weit führen, diese Aktivitäten hier im einzelnen zu beschreiben, zumal dies an anderer Stelle bereits geschehen ist (Rüdiger 1983). Erwähnt sei nur noch eine im historischen Sinne weitere Neuheit der HJ: der/die hauptamtliche Jugendführer(in).
Vor 1933 gab es wohl schon hauptamtliche Funktionäre in Jugendverbänden, aber keine ausgebildeten pädagogischen Fachkräfte. Lediglich haupt- und nebenamtliche, vom Staat eingestellte "Jugendpfleger" waren bereits tätig, aber die hatten eine andere Aufgabe. Sie sollten dafür sorgen, daß die von der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellten Jugendpflegemittel vor Ort unter den verschiedenen Jugendverbänden zweckmäßig verwendet wurden; denn vor 1933 veranstaltete der Staat selbst keine Jugendarbeit, er unterstützte lediglich die staatsfreien Jugendverbände (nach dem sogenannten "Subsidiaritätsprinzip"), insofern diese pädagogische Ziele verfolgten, wobei das Angebot eines Jugendlebens mit Heimabend, Fahrt und Lager schon als ein solches Ziel galt. Das Verhältnis von Staat und Jugendverbänden war vor 1933 also im Prinzip so geordnet wie heute auch. Heute allerdings verfügen die Jugendverbände in der Regel über hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter, vor 1933 wären sie zumindest in der bürgerlichen Jugendbewegung auf Unverständnis gestoßen, man hätte einfach nicht gewußt, wozu sie gut sein sollten.
Schirach wollte - davon war schon die Rede - mit dem Typus des hauptamtlichen Jugendführers Mobilität in die pädagogische Berufsstruktur bringen. Dazu bedurfte es aber einer besonderen Ausbildung, für die die herkömmlichen Ausbildungsstätten (Universität; HfL) nicht geeignet waren. Deshalb wurde in Braunschweig eine "Akademie für Jugendführung" errichtet; der Neubau sollte zugleich Vorbild für das architektonische Selbstverständnis, das eigentümliche
208
"Raumerleben" der HJ sein. Kurz vor Kriegsbeginn begann der erste Kurs in der nur teilweise fertiggestellten Anlage, er mußte aber wegen des Kriegsausbruchs abgebrochen werden, die Teilnehmer gingen zur Wehrmacht. Erst ab 1942 wurden wieder Kurse abgehalten - nun mit kriegsversehrten HJ-Führern. Wegen des Krieges blieb das Konzept ein Torso. Erkennbar ist jedoch, daß Schirach hier einen Führertypus heranbilden wollte, der - sportlich, musisch und geistig gebildet - sich weltläufig verhalten konnte, der nicht nur sich beim Geländespiel wohlfühlte, sondern sich auch im Frack auf dem Parkett zu bewegen verstand -jeder gesellschaftlichen Situation gewachsen. Dabei hat er offensichtlich auch an das Auftreten seines Führerkorps im Ausland gedacht. Unverkennbar ist jedenfalls Schirachs Bemühen, den seit der "Kampfzeit" überkommenen "soldatischen" Modus der HJ zu relativieren.
Für die Mädchen war eine "Hochschule des BDM" geplant, die in Wolfenbüttel errichtet werden sollte, wozu es nicht mehr kam. Da die Kurse für die männliche HJ aber seit Kriegsbeginn ausfielen, benutzte der BDM zunächst das leerstehende Haus in Braunschweig.
Während
die
Führerausbildung
der Jungen - wie erwähnt - einen bestimmten Typus im Blick hatte,
scheinen entsprechende Erwartungen an die Mädchen nicht gestellt
worden
zu sein. Deren Ausbildung war eher pragmatisch orientiert: Vermittlung
einer Reihe von praktischen Kenntnissen über Gesundheitsfragen,
Rechtsfragen,
Feiergestaltung usw. Ferner standen - wie auch schon bei "Glaube und
Schönheit'
- Angebote zur allgemeinen historischen, musischen und literarischen
Bildung
auf dem Programm.
Die Aufmerksamkeit, die man bisher der Hitlerjugend entgegengebracht hat, hat sich lange Zeit auf die männliche HJ bezogen, sehr viel weniger auf die weibliche. Dabei galt der erwähnte freiwillige Zustrom zur Hitlerjugend nach der Machtergreifung auch für die Mädchen. Ihr Anteil am Gesamtverband betrug Ende 1932 mit 23.900 Mädchen nur 22,13 %, er stieg bis Ende 1934 mit 593.232 Mitgliedern auf 25,88 % und
209
bis Ende 1934 mit 1.334.261 Mitgliedern sogar auf 37,29 % an (Jürgens, 68). Dieser Zuwachs ist deshalb bemerkenswert, weil bis dahin der Anteil von Mädchen in Jugendorganisationen sehr gering war. Gleichwohl finden sich selbst in manchen Forschungsarbeiten mehr oder weniger stark ausgeprägt die verbreiteten Klischees: Entsprechend den bekannten gegenemanzipatorischen "Männerphantasien" der Nazis habe die Frau Gefährtin des Mannes zu sein, ihm möglichst viele Kinder zu schenken und im übrigen ihren Horizont auf Familie und Haushalt zu beschränken. Der BDM - so meist die Schlußfolgerung - müsse irgendwie die Mädchen auf dieses Leitbild abgerichtet haben.
Wir haben schon gesehen, daß das so nicht zutrifft. Das "Mutterideal" spielte in der Arbeit von JM und BDM eine untergeordnete Rolle, und der BDM propagierte eine Berufsausbildung für möglichst jedes Mädchen. Das war damals vor allem in der Arbeiterschaft keineswegs selbstverständlich, vielmehr war die Erwartung eher die, daß die Tochter der Mutter im Haushalt hilft und allenfalls bis zur möglichst schnellen Heirat eine ungelernte Arbeit annimmt, um auf diese Weise zu einer kleinen Aussteuer zu kommen. In den bürgerlichen Familien war eine solide Berufsausbildung der Mädchen - vielleicht auch ein Studium - eher üblich geworden, aber meist auch unter dem Aspekt einer künftigen "guten Partie". Auf seine Weise war das bürgerliche Mädchen ebenso auf den künftigen Mann fixiert, für den es unter der Obhut von Mutter, Tante und Großmutter "rein" bleiben und attraktiv werden sollte.
Sicher ging die BDM-Führung davon aus, daß das Mädchen, wenn es heiratete, und vor allem, wenn ein Kind kam, aus dem Arbeitsprozeß ausschied und sich dann der Familie widmete; und gewiß hatte der BDM, wenn er eine Berufsausbildung propagierte, eher "frauenspezifische" Berufe im Sinn, also solche, die im Erziehungs-, Gesundheits-, Pflege- und Sozialbereich angesiedelt waren. Aber diese Einstellung war nicht originell, sondern entsprach durchaus der Tradition der bürgerlichen Frauenbewegung - mit der sich im übrigen der BDM nur bedingt identifizierte -, die gerade im Hinblick auf die Sozialarbeit "Mütterlichkeit als Beruf' propagiert hatte und der es nur auf dieser ideologischen Schiene mühsam gelungen war, eine berufliche Emanzipation der Frau durchzusetzen.
210
Im übrigen hatte der Erste Weltkrieg eine wichtige Erfahrung hinterlassen. Da viele junge Männer gefallen waren, gab es in den entsprechenden Jahrgängen einen Frauenüberschuß, und nicht jede Frau, die vielleicht gerne Mutter geworden wäre, konnte einen Partner finden. Schon aus diesem Grund mußte es zweckmäßig erscheinen, möglichst jedes Mädchen einen Beruf lernen zu lassen, was sich im Rahmen der Nazi-Ideologie auch mühelos begründen ließ: wer nicht als Mutter seinem Volk dienen konnte, konnte dies ebenso durch einen nützlichen Beruf tun.
Die an sich mögliche Lösung durch ein uneheliches Kind wurde vom BDM nie propagiert, und als gegen Kriegsende in Parteikreisen - vor allem auch durch Bormann - die Idee aufkam, auf diese Weise die Kriegsverluste an jungen Männern zu kompensieren, hat sich die BDM-Führung dem widersetzt. Zwar wurde die ledige Mutter im Dritten Reich besser behandelt und entschieden weniger diskriminiert als vorher, aber zum Vorbild wurde sie nicht.
Überhaupt ist zu erkennen, daß die von Nazi-Männern propagierten Parolen über die Rolle der Frau, die wir heute lesen und die unser Bild von der Sache weitgehend bestimmen, von den NS-Frauenorganisationen, vor allem auch vom BDM weitaus zurückhaltender aufgegriffen wurden. Schirach war jedenfalls kein "Macho", und er hat in dieser Mädchenfrage offenbar einigermaßen sensibel operiert und den dafür zuständigen weiblichen Mitgliedern in der RJF weitgehend freie Hand gelassen. Die BDM-Führung versuchte eine stärkere Mitbeteiligung des weiblichen Geschlechts in der Gesellschaft zu erreichen und strebte somit ein anderes Frauenideal an als die NS-Frauenschaft. Der BDM wandte sich sowohl gegen die anfänglichen Studienbeschränkungen für Frauen als auch gegen Benachteiligungen für Mädchen auf den höheren Schulen, die durch die Neuordnung des höheren Schulwesens von 1938 durchgesetzt wurden. Demnach mußten in allen Schulformen für Mädchen Lehrstoffe aufgenommen werden, die der praktischen hausfraulichen Bildung dienten. Zudem wurden die Mädchen vom Lateinunterricht der Unter- und Mittelstufe ausgeschlossen, weshalb sie die allgemeine Hochschulreife nur noch erreichen konnten, wenn sie aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten Latein lernten. Diese Regelung wurde erst 1940 für die Kriegszeit wieder außer Kraft gesetzt. Weil der BDM seine Vorstel-
211
lungen im staatlichen Schulwesen nicht durchsetzen konnte, versuchte er, auch für Mädchen Eliteschulen zu schaffen. Das gelang mit Hilfe der SS. Im Jahre 1939 wurde eine erste NPEA in Österreich und zwei Jahre später eine weitere eröffnet. Seit September 1942 wurde auf Betreiben der Staatskanzlei erwogen, Adolf-Hitler-Schulen für Mädchen zu eröffnen.
Die männliche HJ gab zwar immer den Ton an, spielte eine Vorreiterrolle, aber in ihrem Windschatten zogen die Mädchen mit. Der Reichsberufswettkampf war in erster Linie für die Jungen organisiert, aber die Mädchen waren auch dabei. Die AHS als Elite-Schulen wurden zunächst nur für die Jungen eingerichtet, aber für die Mädchen waren sie auch geplant, und selbstverständlich mußte die Berufsausbildung zum Jugendführer auch für die Mädchen gelten.
Nach meinem Eindruck ist die weibliche HJ im Vergleich zur männlichen das interessantere Phänomen und auch das relativ fortschrittlichere. Für Jungen war es auch vor 1933 kein Problem, in irgendeinem Bund oder Verband ein "Jugendleben" unter Gleichaltrigen zu führen. Die Frage war eigentlich nur, ob sie es wollten. Für Mädchen dagegen war dies keineswegs selbstverständlich. Zwar gab es schon vor dem Ersten Weltkrieg im Rahmen des Wandervogel Mädchengruppen, die unter Leitung von erwachsenen Frauen - meist der eigenen Mütter - Wanderungen unternahmen. Und die sozialistischen Jugendverbände - z.B. die der SPD nahestehende Sozialistische Arbeiterjugend (SAJ) - nahmen prinzipiell auch Mädchen auf, weil sie von der uneingeschränkten Gleichberechtigung der Geschlechter ausgingen. Auch in der "bündischen Jugend" der Weimarer Zeit waren Mädchen vertreten, bei der "Deutschen Freigeben'' sollen es gar 15 Prozent gewesen sein. Aber das waren Minderheiten, die fast ausschließlich aus bürgerlichen Familien kamen. Auch die Kirchen hatten natürlich weibliche Jugendliche organisiert, aber weniger zum Zwecke eines "Jugendlebens" als zum Zwecke der konfessionellen Loyalitätssicherung. Die große Masse der Mädchen, vor allem aus der Arbeiterschaft und aus der Landbevölkerung, blieb jedoch von einem "Jugendleben" unter Gleichaltrigen ausgeschlossen. Die Mobilisierung der Mädchen, und zwar im Prinzip jedes deutschen Mädchen vom 10. Lebensjahr an, gelang erst der HJ. Sie bot diesen Mädchen einen pädagogisch kontrollierten Lebens-
212
raum an, der durch eigene Regeln bestimmt war, die nicht aus dem Familienstatus abgeleitet waren. Das war ein sehr wichtiger Schritt zur Emanzipation von der eigenen Familie. Während für den Jungen diese Emanzipation auch früher nicht nur erwünscht war, sondern auch gefordert wurde - sonst blieb er ein "Muttersöhnchen" -, bestand das Leben des Mädchens im wesentlichen darin, daß es von seiner Herkunftsfamilie an die Familie weitergereicht wurde, die es dann mit seinem Mann selbst gründete. Eine Erziehung zu öffentlichem Handeln und Verhalten war in dieser Tradition nicht vorgesehen.
Nun aber verließ das 10- oder 12jährige "Jungmädel" nachmittags das Elternhaus mit der Begründung, daß es zum "Dienst" müsse. Vielleicht fragte es schon nicht mehr um Erlaubnis, denn schließlich handelte es sich ja nicht um eine beliebige Freizeitbeschäftigung, sondern um eine der Öffentlichkeit geschuldete Pflicht, eben um "Dienst". Dort, wo es hinging, fand es Gleichaltrige und eine um weniges ältere "Führerin". Es wurde gesungen, gespielt und vielleicht etwas Nützliches getan, z.B. einfaches Spielzeug als Weihnachtsgeschenk für andere, arme Kinder gebastelt. Paradoxerweise war es gerade der Zwang, die "Dienstpflicht", die viele dieser Mädchen aus dem Elternhaus holte, denn vor 1933 wäre den meisten von ihnen gar nicht erlaubt worden, an einem Angebot der Jugendarbeit teilzunehmen, weil sich dies für Mädchen eben nicht schicke. Obwohl Eltern nicht befürchten mußten, daß ihre Töchter gewaltsam zum Dienst aus dem Haus geholt wurden, wurden sie doch durch den Anspruch des "Dienstes" unter Begründungszwang gesetzt - zumindest der eigenen Tochter gegenüber.
So kann es nicht verwundern, daß sehr viele ehemalige Mitglieder von JM und BDM gute Erinnerungen an diese Zeit haben, während ähnlich positive Urteile ehemaliger DJ- und HJ-Mitglieder wesentlich seltener anzutreffen sind. Im Kontext der deutschen Jugendbewegung seit dem Beginn des Jahrhunderts bedeutete die männliche HJ eher einen Niedergang, wenn man das doch relativ eintönige militärähnliche Ritual vergleicht mit den Möglichkeiten, die die Jungen vor 1933 angesichts der Fülle unterschiedlicher Jugendbünde und Jugendverbände hatten. Der normale "Dienst" in der HJ begann für die Jungen unattraktiv zu werden - für die 10 bis 14jährigen vielleicht weniger als für die älteren. Inso-
213
fern waren Schirachs Bemühungen, das ursprünglich rein soldatische Leitbild musisch zu relativieren, durchaus notwendig.
Bei den Mädchen gab es solche Probleme offenbar kaum. Ihr Vorbild sollten die Frauen des Ersten Weltkriegs sein, die an der "Heimatfront" die an der äußeren Front stehenden Männer vertraten und deren Arbeit weitgehend übernommen hatten. Aber dieses Vorbild blieb schon deshalb diffus, weil es schwer an einzelnen Personen zu symbolisieren und weil es zu sehr auf eine bestimmte Generation bezogen war. Wichtiger war für die Mädchen ohne Zweifel das Gemeinschaftserlebnis unter Gleichaltrigen. Für sie waren die Angebote von JM und BDM also zu diesem historischen Zeitpunkt deutlich attraktiver, im Sinne einer neuen Erfahrung, die die meisten ihrer Mütter nicht hatten machen können.
Um den damaligen Erfolg des BDM zu verstehen, muß man sich die fundamentale Bedeutung der Emanzipationsproblematik vergegenwärtigen. Das Ideal der bürgerlichen Familie, an dem sich dann auch die aufstrebende Arbeiterschaft orientierte, hatte sich erst im Laufe des 19. Jahrhunderts herausgebildet. Es beruhte auf der bekannten Rollenaufteilung zwischen Mann und Frau. Der Mann verläßt die Familie, um ihr "draußen" den Lebensunterhalt zu verschaffen, bzw. um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen. Die Frau war zuständig für das Haus einschließlich der Dienstboten, falls man sie sich leisten konnte, für Stil und Kultur und vor allem für die emotionale Betreuung der Kinder. Eine "öffentliche" Rolle spielte sie nicht, es sei denn, man würde ihre Pflichten als Gastgeberin so verstehen. Diese Arbeitsteilung konnte so lange befriedigend für beide Beteiligten sein, wie sie daraus ihre gegenseitige Achtung und Anerkennung sowie soziales Ansehen in ihrer Umgebung gewinnen konnten. Wenn aber diese Balance brüchig wurde, geriet nicht nur die Frau z.B. wegen ihrer ökonomischen und rechtlichen Abhängigkeit vom Mann in eine prekäre Lage, auch der Mann konnte leicht an Selbstachtung verlieren, wenn er nämlich - aus welchen Gründen auch immer - die Erwartungen nicht erfüllte, die an seinen beruflichen Erfolg geknüpft waren. Der Arbeitsplatz konnte verloren gehen, Karriere-Hoffnungen blieben vielleicht unerfüllt, oder ein Konkurs stand gar ins Haus. Die Identität, die beide Seiten aus dieser Familien- bzw. Ehe-
214
konstellation bezogen, war also leicht auch ohne persönliche Schuld gefährdet.
Nur auf diesem Hintergrund wird verständlich, warum die Emanzipation der Frau ein so schwieriger Prozeß bis auf den heutigen Tag gewesen ist. Als die Frau bzw. die bürgerliche Tochter begann - teils zunächst aus Langeweile oder aus Bildungshunger, vor allem aber zum Zwecke der eigenen Existenzsicherung, weil eine Versorgung durch Heirat immer mehr zu einem va-banque-Spiel wurde -, wie der Mann das Haus zu verlassen, um ebenfalls einen Beruf wahrzunehmen, mußte sie sich einige fundamentale Fragen stellen und beantworten, die aus ihrer traditionellen weiblichen Erziehung erwuchsen: Was unterscheidet mich gesellschaftlich noch vom Mann, wenn ich meinen Lebensunterhalt selbst verdiene? Was ist mein besonderes weibliches "Wesen", und muß ich dies in der Wahl meines Berufes ausdrücken oder in der Art und Weise, wie ich ihn ausübe? Wie gehe ich zum Beispiel am Arbeitsplatz mit anderen Frauen und vor allem mit Männern um? Und vor allem: Wie kann ich die öffentliche und private Rolle (Beruf und Familie) miteinander verbinden?
Aber auch für den Mann stellten sich entsprechende Fragen: Was macht meine Rolle als Mann noch aus, wenn sich meine Frau ihren Lebensunterhalt selbst verdienen kann und will? Wie gehe ich mit der Tatsache um, daß meine Frau von mir unkontrolliert "draußen" mit anderen Männern umgehen muß?
Manche dieser Fragen haben sich heute historisch erledigt, aber am Anfang berührten sie tiefe Schichten des persönlichen Selbstverständnisses, also der Identität, und der Weg von der "patriarchalischen" zur "partnerschaftlichen" Ehe bzw. Familie der Gegenwart war ein mühsamer und schwieriger und mußte mit Ungewißheit, Zweifeln und Desorientierung erkauft werden. Der Auszug der Frau aus dem alten Leitbild der bürgerlichen Familie in die Öffentlichkeit machte für beide Geschlechter neue Fundierungen ihrer Identität notwendig. Wie schwierig dies für Männer sein konnte, haben wir schon am Beispiel Baeumlers gesehen, dem die sich gleichberechtigt in der Öffentlichkeit bewegende Frau als eine Zerstörerin des öffentlichen Selbstverständnisses des Mannes galt. Nun ist Baeumler gewiß ein ex-
215
tremes Beispiel, aber das Problem eines neuen Verhältnisses der Geschlechter zueinander in der Familie wie in der Öffentlichkeit war ein wichtiges Thema nicht zuletzt auch in der Jugendbewegung.
Aus der Sicht des Mädchens ging es unter anderem darum, neben familiären auch öffentliche Verhaltensweisen zu lernen. Wie schwierig solche Lernprozesse waren, zeigt das Beispiel der schon erwähnten SAJ, in der Mädchen formal als gleichberechtigt angesehen wurden. Die SAJ verstand sich aber als eine politische Organisation und eine ihrer wichtigsten Verhaltenskategorien war deshalb "Solidarität". Diese Verhaltensnorm war gegenüber jedermann geboten, der sich in derselben Klassenlage befand, also Arbeiter war -gleichgültig, ob man ihn persönlich kannte oder ob er ansonsten ein "mieser Typ" war; war er dies, dann konnte man ihn ruhig verprügeln, ohne daß dabei die "Solidarität" aufs Spiel gesetzt werden mußte.
Die Mädchen konnten diese Trennung von privat und öffentlich damals kaum nachvollziehen. Sie waren fixiert auf das familiäre Denken und Fühlen, wozu sie ja auch erzogen worden waren. Das äußerte sich z.B. darin, daß sie meistens versuchten, sich einen Jungen aus der Gruppe zu angeln, und wenn dies gelungen war, erlosch das Interesse an der Arbeit der Gruppe zugunsten privater Zweisamkeit. Schon damals gab es deshalb in der SAJ Überlegungen, eigene Mädchengruppen zu gründen, um dem ständigen Vergleich und der Konkurrenz mit den Jungen zu entgehen. Aber die Koedukation von Jungen und Mädchen galt als ein wichtiges sozialistisches Prinzip. Heute finden wir eine spezifische Mädchenarbeit nicht nur in der außerschulischen Jugendarbeit, auch in der Schule hat sich herausgestellt, daß Mädchen vor allem in naturwissenschaftlichen Fächern besser zum Zuge kommen, wenn sie unter sich bleiben.
Während also die Männer traditionell dazu erzogen worden waren, öffentliche Rollen zu lernen und sie strikt von privaten zu trennen, hatten die Mädchen nur private gelernt, und deshalb neigten sie verständlicherweise dazu, an öffentliche Situationen private Erwartungen zu richten. Noch im gegenwärtigen Feminismus ist dies in Gestalt einer "Intimisierung der Öffentlichkeit" oder einer Moralisierung von Politik und Gesellschaft zu beobachten, wobei die Maßstäbe
216
unverkennbar aus der Privatheit stammen und deshalb oft die jeweilige Sache verfehlen.
Der Erfolg der NS-Ideologie beruhte nun offensichtlich darauf, daß sie in diesem Widerspruch von traditioneller Familienorientierung und moderner Öffentlichkeitsorientierung eine Balance anbot. Die traditionelle Rolle wurde wieder aufgewertet, zugleich wurde der Frau aber auch eine öffentliche Bedeutung offeriert - beides aufgehoben in der Idee der Volksgemeinschaft, wobei der Begriff des "Dienstes" für beide Rollen wenn auch in unterschiedlicher Weise gleichermaßen Sinn ergab. Die NS-Ideologie bot so eine Lösung für massenhafte Identitätskrisen an. Für die Männer war dies natürlich auch eine Lösung; sie wurden in ihrer alten, dominierenden Rolle beruflich wie als "politische Soldaten" bekräftigt und konnten so auch akzeptieren, daß den Frauen nun eine wenn auch begrenzte öffentliche Rolle zugestanden wurde.
Wir dürfen diese "Lösung" des männlichen und weiblichen Identitätsproblems nicht vom heutigen Stand der Emanzipation aus betrachten und beurteilen. Abgesehen davon, daß der Prozeß der Emanzipation der Frau bis hin zu radikal feministischen Positionen der Gegenwart Männer und Frauen nicht eben glücklicher im Vergleich zu früher gemacht zu haben scheint, wäre die Ansicht ganz irrig, die Nazis hätten ein frauenfeindliches, machistisches Regime geführt. Im Gegenteil: Im Alltag des Dritten Reiches wurde Frauen mehr Respekt und Achtung entgegengebracht als vorher - was sich in den Kriegsjahren noch steigerte,
Über Hitlers Ansehen bei den Frauen gibt es inzwischen viele Deutungen, auch einigermaßen abwegige, die es als massenerotisches Phänomen interpretieren, so, als hätten die Frauen damals kein wichtigeres Problem gehabt, als sich diesen Herrn Hitler - und sei es nur unbewußt - ins Bett zu wünschen. Die Sache war wohl viel trivialer. Die Frauen, die Hitler um 1933 zujubelten, hatten meist ihre arbeitslosen Männer zu Hause und mußten trotzdem - ohne unsere heutigen "sozialen Netze" - ihre Familien über die Runden bringen. Und die ihm später zujubelten, hatten die Erfahrung gemacht, daß es ihnen wirtschaftlich besser ging und daß sie öffentliche Achtung genossen.
Im
Kontext dieser
langfristigen
Emanzipationsproblematik muß auch die weibliche Hitlerjugend
gesehen
werden. Sie bot den Mädchen neben Familie und Schule einen
öffentlichen
Raum für ihr Aufwachsen an, der einerseits durch die
Intimität
der Gleichaltrigkeit Geborgenheit ausstrahlen konnte, andererseits aber
mit der Kategorie des "Dienstes" an der Allgemeinheit eine
öffentliche
Dimension bekam.
217
Stichworte
einer
"Gebrauchspädagogik"
Schirach hat seine pädagogischen Vorstellungen über die HJ nicht systematisch ausformuliert. Dennoch fällt es nicht schwer, sein Konzept zu rekonstruieren.
Die NS-Ideologie im ganzen war ja - wie eingangs am Beispiel der pädagogischen Ideen Hitlers schon gezeigt wurde - ein Konglomerat aus allen möglichen Versatzstücken des bürgerlich-kleinbürgerlichen "gesunden Volksempfindens".
Schirachs pädagogische Konzeption der HJ ist deshalb ebenfalls am besten dadurch zu beschreiben, daß man diesen Populismus sinngemäß überträgt. Demnach verkörperte die HJ im wesentlichen das, was das erwähnte "Volksempfinden" für richtig hielt. Was war ein "anständiger" deutscher Junge bzw. ein "anständiges" deutsches Mädchen? Wer den Verführungen der Straße auswich und sich stattdessen in die Obhut von HJ bzw. BDM begab, dort neben körperlicher Ertüchtigung - was ja nie verkehrt sein kann - alle möglichen nützlichen Dinge lernte, jedenfalls "sinnvoll beschäftigt" wurde und deshalb nicht auf Abwege geriet oder "auf dumme Gedanken" kam. Auch gegen "Disziplin" und "Ordnung" sowie gegen für die Allgemeinheit nützliche "Dienste" hatte das "Volksempfinden" nichts einzuwenden, solange dies alles "maßvoll" blieb. Während Schirach - wie wir sahen - an der damaligen Schule teilweise massive öffentliche Kritik übte, versuchte er von Anfang an die Zustimmung der Eltern zu gewinnen. Das aber wäre mit einem unverhüllten Indoktrinationsprogramm auf die Dauer nicht erfolgreich gewesen.
Auf diesem populistischen Hintergrund müssen die pädagogischen Leitmotive gesehen werden, die immer wieder auftauchen: "Erlebnis", "Vorbild", "Kameradschaft", "Ehre", "Dienst". Alle diese Stichworte spielten schon vorher in der
218
Reformpädagogik und in der bürgerlichen, teilweise auch in der sozialistischen Jugendbewegung eine Rolle, sie lagen sozusagen in der Luft.
Wie Krieck und Baeumler ging es auch Schirach im Kern um die Neufundierung eines Gemeinschaftslebens und eines Gemeinschaftsbewußtseins - von den unteren HJ-Einheiten bis hin zur Volksgemeinschaft im ganzen. Der junge Mensch sollte sich erfahren als Mitglied solcher Sozialitäten, von daher seine Identität erwerben und in diesem Rahmen auch seine individuellen Fähigkeiten entwickeln. Wie schon bei Krieck und Baeumler machte dieses Gemeinschaftskonzept Front gegen die gemeinschaftsungebundene Individualisierung (polemisch "Individualismus" genannt), wie sie bei Jugendlichen vor allem erkennbar war in der Beliebigkeit des relativ unkontrollierten Freizeitverhaltens. Die nun zu erörternden pädagogischen Stichworte bekommen nur Sinn, wenn man sie im Rahmen dieses Gemeinschaftskonzeptes sieht.
Die Bedeutung der Gemeinschaft kann man nicht lehren, man muß sie "erleben". Dieser Gedanke Schirachs war nicht neu. "Erlebnis" war z.B. ein zentrales Motiv der Reformpädagogik. Der Reformpädagoge Kurt Hahn etwa, der u.a. das Internat "Schloß Salem" gründete, nach England emigrierte und dort seine pädagogische Arbeit fortsetzen konnte, forderte ausdrücklich eine "Erlebnispädagogik". In kritischer Distanz zur "verkopften" Schule, die ihren Bildungsauftrag auf die Vermittlung abstrakten Wissens ohne Bezug zum Leben reduziert habe, sollte die emotionale und ästhetische Dimension des Menschen wieder zur Geltung kommen, der Mensch in seiner Ganzheit wieder in den Blick treten können. Schirachs Schulkritik lag auf dieser Linie. Nur ging es ihm primär nicht um die Schule, sondern um das außerschulische Jugendleben. Die "weltanschauliche Schulung" sollte nicht im Stile des Unterrichts erfolgen, sondern Gefühle wie Ehrfurcht, nationale Zugehörigkeit, Freude und Trauer ansprechen. Diese Erlebnisorientierung war - übrigens auch schon bei Kurt Hahn und anderen Reformpädagogen - gegenaufklärerisch orientiert. Nicht rationale Aufklärung - z.B. über historische oder politische Probleme - sollte ermöglicht werden, sondern die gemeinsam-emotional erlebte Erfahrung sozialer Zugehörigkeit. Die rationale Aufklärung wurde dagegen erlebt als sozial-zersetzend.
219
Nun kann man bekanntlich Erlebnisse und bestimmte Gefühle nicht dadurch hervorrufen, daß man sie verbal propagiert. Sie bedürfen bestimmter Situationen, in denen sie zum Vorschein kommen können, und solche Situationen müssen hergestellt, arrangiert werden. Auf diesem Hintergrund gewinnen die vielfältigen Rituale ihre pädagogische Bedeutung: Aufmärsche mit entsprechender "kultischer" Musik und den dazugehörigen mehrdeutigen bzw. inhaltlich unbestimmbaren gesprochenen Texten; die Lageratmosphäre; die Uniformierung sowie die an Rangabzeichen erkennbaren Führer-Karrieren schon für "Pimpfe" und "Jungmädel"; die Feier- und Weihestunden; der Fahnenkult; die Lagerfeuerromantik, das gemeinsame Singen und so fort. Solche Inszenierungen vermochten Erlebnisse zu produzieren, die teils durchaus individueller Natur waren, vor allem aber kollektive Gestimmtheiten hervorrufen konnten, die etwa einen Satz wie: "Du bist nichts, dein Volk ist alles!" unmittelbar erfahrbar werden ließen. Oder ein anderes Beispiel: Was "Deutschland" ist, erfährt man nicht hinreichend im Geographieunterricht, sondern dadurch, daß man durch das Land wandert, mit den Menschen spricht und möglichst zeitweilig an ihrem Alltagsleben teilnimmt - z.B. durch einen "Ernteeinsatz". "Erlebnis" ist also ein Gegensatz oder zumindest eine notwendige Ergänzung zur bloß verbalen Belehrung.
In diesem Sinne ist "Erlebnispädagogik" seit geraumer Zeit wieder aktuell, um nicht zu sagen: zu einer "Mode" geworden. Auch dabei geht es um die Suche nach Alternativen zur bloß verbalen, rationalen Kommunikation, auf der ja sogar die therapeutischen Verfahren beruhen. So versucht man etwa, mit dissozialen Jugendlichen Segel-Touren zu unternehmen, bei denen sie von der täglichen Verpflegung bis zum Segelsetzen ihr Leben selbst in die Hand nehmen müssen. Man setzt dabei auf positive Erlebnisse und Erfahrungen z.B. im Hinblick auf die individuelle Leistungsfähigkeit und auf das Gemeinschaftsleben. In der Jugendarbeit gibt es auch weniger spektakuläre Beispiele, z.B. Alternativen zum üblichen Komfort-Tourismus in Gestalt von Kanu- und Radtouren. Auch die Schule bemüht sich um Erlebnisorientierung, indem sie z.B. Schullandheimaufenthalte oder Studienfahrten organisiert, oder vor Ort Dichterlesungen, Theater- und Museumsbesuche, Betriebsbesichtigungen usw. ermöglicht.
220
Es handelt sich hier offensichtlich um ein pädagogisches Thema und Problem, das über die HJ hinausreicht, und deshalb wollen wir uns diesem Aspekt später noch einmal gründlicher zuwenden.
Im "Erlebnis" der Gemeinschaft als Inbegriff der sozialen Zugehörigkeit, verbunden mit entsprechenden Rechten und Pflichten, sollte auch eingeschlossen sein die Erfahrung des - fast altersgleichen - "Führers" als "Vorbild" Im Idealfall repräsentierte der Führer in seiner Person und in seinem Verhalten optimal das, was die Gemeinschaft an positiven Erwartungen über sich selbst hegte. Führer sollte derjenige werden, der - ohne formal demokratisch gewählt zu werden - dem "Geist" der Gemeinschaft am besten entsprach. Wie "Erlebnis" war auch "Vorbild" anti-rational gemeint: "Richti ges" Verhalten sollte nicht gepredigt, sondern vorbildhaft vorgeführt und vorgelebt werden.
Nun ist in der modernen Pädagogik die Bedeutung von Vorbildern für Kinder und Heranwachsende unbestritten; sie werden gebraucht als Orientierungen für die eigene Lebensperspektive und für die Identitätsbildung. Im allgemeinen gehen wir jedoch davon aus, daß die Vorbilder erwachsen sind, weil nur dann die nötige Spannung und Differenz zur Lage des Jugendlichen entstehen kann, die eine produktive Perspektive "nach vorne", also für den Lebensentwurf herzugeben vermag. Die HJ jedoch erhob nun auch Gleichaltrige in den Rang von Vorbildern - nämlich die Führer bzw. die, die es wegen ihres vorbildhaften Verhaltens werden sollten. Diese Vorstellung war in der vorhergehenden Jugendbewegung allenfalls in ersten Ansätzen zu finden. Im allgemeinen jedoch blieb es dabei, daß man Vorbildwirkungen von den wenn auch relativ jungen Erwachsenen erwartete, nicht jedoch von den Gleichaltrigen, die sich eher als untereinander gleichrangig ansahen. Die Idee des Gleichaltrigenvorbildes wurde nun massenhaft propagiert, und sie erwuchs aus der Idee des Jugendstaates, der eben auch von Jugendlichen wenigstens auf der unteren Ebene geführt werden sollte. Schon damals ist öffentlich diskutiert worden, ob eine derartige Erwartung nicht zu einer massenhaften Überforderung führen müsse oder nicht gar zu einer dem Alter nicht angemessenen Frühreife. Auch darauf wird noch näher einzugehen sein, hier sei nur festgehalten: Die Vorbild-Erwartungen an die Gleichaltrigen bezogen sich zunächst einmal lediglich auf
221
das "Jugendleben" in der HJ, nicht auch auf die künftigen Erwachsenen-Rollen.
Die dienstliche Beziehung der HJ-Mitglieder untereinander - auch zwischen Jungen und Mädchen - sollte "kameradschaftlich" sein. Der Begriff "Kameradschaft" hatte bei Schirach zwei Quellen: Einmal die "Front-Kameradschaft" aus dem Ersten Weltkrieg, die unter den "Stahlgewittern" (E. Jünger) der Materialschlachten die traditionellen Standes- und Klassenunterschiede zusammenschmelzen ließ; zum anderen die reformpädagogische Version einer neuen pädagogischen Beziehung zwischen Lehrern und Schülern, wie sie Schirach in Bad Berka erlebt hatte und deren äußerer Ausdruck das kameradschaftliche "Du" war. Im Unterschied zur Freundschaft - Freunde muß man sich wählen können - war kameradschaftliches Verhalten gegenüber jedermann angezeigt, der zur eigenen Gruppe gehörte - also in diesem Falle zur HJ.
Die öffentliche Beziehung von Jugendlichen und Erwachsenen war also nur dann den Normen der "Kameradschaft" unterworfen, wenn sie wie bei der HJ, der Wehrmacht oder beim Reichsarbeitsdienst zur dienstlichen Beziehung wurde. Dann ging es im wesentlichen darum, den "Kameraden" als Mitglied der Gruppe zu respektieren, ihn bei der Durchführung der gemeinsamen Aufgaben (des "Dienstes") zu unterstützen, ihn vor Angriffen von außen zu schützen und ihm innerhalb der Gruppe Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Unbeschadet bestehender Rangunterschiede hatte der "Kamerad" als gleichrangig zu gelten. Für die HJ bedeutete Kameradschaft in Verbindung mit dem zu leistenden "Dienst' eine nicht-private, öffentliche Verhaltensnorm, die jedem Mitglied der HJ zustand - ob man ihn nun persönlich ausstehen konnte oder nicht. Auch diese Verhaltensnorm war schon vorher in der bürgerlichen Jugendbewegung anzutreffen, aber dort überwogen doch eher introvertierte, auf persönliche Freundschaften gegründete Gruppenbeziehungen. Diesen eher privatistisch-individualistischen Normen setzte die HJ mit der Norm der Kameradschaft für die 10- bis 18jährigen eine nicht private, kollektive Norm gegenüber, was zumindest in diesem Umfange neu in der modernen Jugendgeschichte war und ein Gegengewicht bildete zur spontanen Freundes- bzw. Cliquen-Gruppe, wie sie unter Jugendlichen im allgemeinen zu finden ist. Wie jede auf eine bestimmte Gruppe begrenzte Verhaltensnorm grenzte auch diese an-
222
dere Personen aus: Mit Juden und Kommunisten oder anderen von den zuständigen Organen der Erwachsenen definierten Feinden konnte es keine kameradschaftliche Beziehung geben, im Gegenteil: In solchen Fällen wäre sie als Verrat bewertet und unter Umständen auch entsprechend geahndet worden.
In diese Vorstellungen fügt sich das Stichwort "Ehre" zwanglos ein. "Ehre" gebührte dem Einzelnen, insofern er Mitglied einer Gruppe war, aber auch der Gruppe selbst. Beide -Einzelner wie Gruppe - konnten ihre "Ehre" verlieren. So hatte angeblich das deutsche Volk durch den Versailler Vertrag seine "Ehre" verloren.
Bis heute ist "Ehre" diskreditiert und wird allenfalls von Rechtsradikalen noch öffentlich verwendet. Damit ist die Sache nicht verschwunden. Jede soziale Gemeinschaft braucht nämlich ein Leitbild ihrer Integritätr, eine Vorstellung von ihrer Vollkommenheit. An diesem Selbstanspruch werden das einzelne Mitglied wie die Gemeinschaft im Ganzen gemessen. "Vorbild" ist demnach der, der dieses normative Leitbild optimal in seiner Person zu repräsentieren vermag. Das Individuum als solches kann also keine Ehre haben, sondern nur, insofern es einer Gemeinschaft angehört.
Zwei praktische Beispiele für die Ehre eines HJ-Mitgliedes sind uns schon begegnet: Es galt in den Adolf-Hitler-Schulen als unehrenhaft, bei Klassenarbeiten zu "mogeln". Andererseits war es gemäß der Rede von Schirach über die "Einheit der Erziehung" nicht unehrenhaft, in der üblichen Schule Widerstand gegen den Lehrer zu leisten und ihn auch bei Klassenarbeiten zu beschummeln. Die Erklärung für diesen scheinbaren Widerspruch liegt auf der Hand: Die normale Schulklasse war eben keine von der HJ selbst geführte soziale Gemeinschaft und konnte deshalb auch nicht an deren Ehrbegriffen gemessen werden; deren Ehre begründete sich vielmehr im Widerstand gegen den Lehrer und seine Ansprüche.
Sieht man die erwähnten pädagogischen Stichworte im Zusammenhang, so zeigt sich, daß die HJ-Erziehung im Sinne von Ernst Krieck eine "funktionale" war, d.h. sie setzte nicht auf rationale Belehrung, sondern auf das Arrangement von Erlebnis-Situationen, von denen sie sich eine bestimmte Pädagogische Wirkung erhoffte, nämlich im Hinblick auf die
223
Stabilisierung einer erwünschten sozialen Gemeinschaft. Nur aus der Perspektive dieser Gemeinschaft ergeben die pädagogischen Einzelheiten einen Sinn.
Da wir es hier jedoch nicht mit einer rational durchgeformten pädagogischen Theorie zu tun haben, sondern mit intuitiv und emotional fundierten Überzeugungen, läßt sich das Gemeinte auch nur in Stichworten andeuten; einer rationalen Analyse ist es nur begrenzt zugänglich, wie Baeumlers Versuch zeigt, den Begriff "Kameradschaft' für das Lehrer-Schüler-Verhältnis als "Leistungskameradschaft" zu präzisieren. Das Ergebnis weiterer Analysen dieser Art wäre eine differenzierte soziale Beziehungsstruktur, die durch den Begriff der "Kameradschaft" nur notdürftig auf einen Nenner zu bringen wäre. Was heißt es dann beim Militär oder im Industriebetrieb?
Nun bekommen Gemeinschaften ihren Sinn und ihre Daseinsberechtigung nur dadurch, daß sie eine Funktion ausüben, daß ihre Mitglieder also im Rahmen einer Aufgabe tätig werden können. Dafür stand bei der HJ der Begriff "Dienst'.
Mit ihm sollte das "Jugendleben" auf die Volksgemeinschaft im ganzen bezogen werden. Einmal galt das organisierte Jugendleben selbst als Dienst, insofern es ja im Sinne einer allgemeinen Lebensertüchtigung der Vorbereitung der Heranwachsenden auf ihre künftigen Aufgaben in Staat und Volk diente. Zum anderen aber sollten die Jugendlichen darüber hinaus bereits nützliche Dienste z.B. im Rahmen von Sammelaktionen und Ernteeinsätzen für die Allgemeinheit leisten - auch dies in Konsequenz der "Erlebnis-Pädagogik".
Der "Dienst" öffnete also den "jugendeigenen Raum" zur Öffentlichkeit hin, räumte dem Jugendlichen einen öffentlichen Status ein. Ähnlich wie die Schulpflicht einerseits dem Kinde die pädagogische Atmosphäre eines Schonraumes gewähren soll, aber gleichzeitig schon ein Stück vom Ernst des Lebens in Gestalt der Leistungserwartungen in sich enthält, sollte auch das außerschulische Leben der Jugend sich in dieser Kombination von Schonraum und allgemeiner Pflichterfüllung entfalten.
Der für die gesamte, entsprechend gesunde deutsche Jugend arrangierte Dienst war ein Novum in der deutschen Jugendgeschichte. Vor 1933 gab es zwar auch schon die Möglichkeit
224
für Jugendliche, sich für öffentliche Aufgaben zu engagieren, z.B. im Rahmen politischer Jugendverbände. Aber dies geschah freiwillig und so, daß jeder dabei zwischen den verschiedenen weltanschaulichen und politischen Positionen und Organisationen wählen konnte.
Ich
möchte
Schirachs
pädagogisches Konzept im Unterschied zu einer wissenschaftlich
oder
wenigstens systematisch entwickelten und fundierten Pädagogik eine
"Gebrauchspädagogik" nennen. Das ist nicht von vornherein
abwertend
gemeint. Die bürgerliche und die proletarische Jugendbewegung, die
zu Beginn unseres Jahrhunderts entstanden, verstanden sich ebenfalls
primär
als Lebensformen und nicht als geplante pädagogische
Veranstaltung,
erste Versuche einer erziehungswissenschaftlichen Theorie der
außerschulischen
Jugendarbeit gab es erst in den sechziger Jahren. Den Begriff der
"Gebrauchspädagogik"
kann man also getrost für diese ganze Zeit verwenden - in Analogie
etwa zur "Gebrauchsmusik". Er weist auf den eher funktionalen Charakter
dieser Pädagogik hin, auf ihre eher sekundäre Bedeutung. Im
Vordergrund
steht immer die Herstellung bestimmter Lebens- und Erlebnissituationen.
Die HJ war nicht primär eine pädagogische Veranstaltung,
sondern
eine Lebensform, weshalb es eigentlich zutreffender wäre, von
"HJ-Sozialisation"
statt von "HJ-Erziehung" zu sprechen.
Ich habe bisher versucht, Schirachs Konzept der HJ möglichst aus seiner Sicht darzustellen - ohne die moralische Voreingenommenheit, die uns die politische Kriminalität des NS-Regimes eigentlich abverlangt. Auf diese Weise erscheint es auch zunächst plausibel, in sich schlüssig; denn jeder Mensch, der handelt und die Wirklichkeit gestaltet, tut dies mit einer für ihn sinnvollen und logischen Stimmigkeit.
Dieses und das folgende Kapitel sollen nun dieses Programm kritisch erörtern. Dazu sind aber einige Vorbemerkungen nötig, weil die Darstellung des HJ-Konzeptes notwendigerweise idealtypisch erfolgen mußte - eher in der Weise einer logischen als einer empirischen Rekonstruktion.
225
1. Die Praxis der HJ entsprach keineswegs immer, vielleicht sogar nicht einmal überwiegend den öffentlich geäußerten Intentionen Schirachs. Das ist bei einer so großen Organisation nicht weiter verwunderlich, zumal sehrjunge Leute in ihr Führungspositionen übernommen hatten und die HJ immer Probleme hatte, genügend Führer zu rekrutieren, so daß sie vor allem auf dem Lande auf junge Lehrer zurückgreifen mußte. Von der alltäglichen Praxis wissen wir nicht viel, weil sie eben von Ort zu Ort unterschiedlich sein konnte. Berichte von Menschen, die damals dabei waren, fallen - wie nicht anders zu erwarten - höchst unterschiedlich aus, nämlich teils zustimmend, teils ablehnend. Verfälscht werden solche Erinnerungen unter anderem dadurch, daß es nach dem Kriege nicht opportun war, sich positiv an die HJ zu erinnern, zumal die HJ-Generation ja auch diejenige war, die den Wiederaufbau in Westdeutschland in Angriff nehmen mußte, da wären positive Erinnerungen an die HJ-Zeit nicht gerade karrierefördernd gewesen. Für die ehemaligen HJ-Mitglieder und HJ-Führer, die nach dem Kriege in der SBZ bzw. DDR lebten, mochte es sogar lebensgefährlich sein, positive Erinnerungen zu äußern.
Hinzu kommt, daß die wenigen Friedensjahre bis 1939 überschattet wurden durch ebenso viele Kriegsjahre, und für die meisten, die beides in jungen Jahren erlebt haben, wird es in ihrem biographischen Erleben eine Einheit bilden, wobei die Kriegsjahre wohl das Urteil über die Friedensjahre wesentlich mitbestimmen dürften. So oder so müssen wir jedenfalls davon ausgehen, daß die Praxis den Intentionen Schirachs keineswegs immer entsprochen haben kann. Es. gab bornierte und arrogante Führer, es gab solche, die ihre "Gefolgschaft" dazu aufforderten, politisch mißliebige Äußerungen und Handlungen der Eltern oder anderer Erwachsener zum Zwecke der politischen Verfolgung preiszugeben. Es gab Hitlerjungen, die absichtlich oder unabsichtlich ihre Eltern denunzierten.
Die bereits mehrfach erwähnte Tat-Philosophie gab es auch hier, nämlich einen sich selbst genügenden Aktivismus, dessen Folgen um so prekärer werden konnten, je länger der Krieg dauerte und z.B. Denunziationen als vaterländische Pflicht erscheinen ließen.
2. Überhaupt darf man Schirachs "Jugendstaat" nicht isoliert sehen; er befand sich ja im Rahmen einer Staats- und Gesell-
226
schaftsverfassung, die - wie uns das Kapitel über Hitler gezeigt hat - die Gestalt einer Erziehungsdiktatur angenommen hatte bzw. annehmen sollte. Pädagogik und Polizei waren da nur verschiedene Seiten derselben Medaille, und wenn die HJ halbwegs "rein" bleiben konnte mit ihrem zweifellos vorhanden gewesenen pädagogischen Idealismus, dann vor allem deshalb, weil die "Drecksarbeit" von den dafür zuständigen Organen der Erwachsenen - Polizei, Gestapo, SS - erledigt wurde. Der Vater, den sein HJ-Filius denunzierte, wurde nicht innerhalb der HJ "behandelt", sondern unter Ausschluß der Öffentlichkeit von der Gestapo. Ein unerwünschter politischer Witz konnte da ausreichen. Vor allem in den Kriegsjahren hat Schirach die Nähe der SS gesucht, und zwar nicht zuletzt wegen deren polizeilicher Funktionen. Überhaupt reagierte die RJF sehr empfindlich auf jede Art von jugendlicher Gruppenbildung außerhalb der HJ. Sie fürchtete sogenannte "bündische Umtriebe", also das Weiterbestehen ehemaliger Gruppen der "Bündischen Jugend" in einem Maße, das die reale Bedeutung solcher Gruppen weit übertraf. Vor allem während des Krieges bildeten sich Gruppen von Jugendlichen, die nicht im engeren Sinne als "politischer Widerstand", sondern eher als Auflehnung gegen das Freizeitmonopol der HJ bezeichnet werden können. Bekannt geworden sind - vor allem aus Polizeiakten bzw. Prozeßunterlagen - unter anderem die "Meuten", die "Edelweiß-Piraten" und die" Swing-Jugend". Sie wurden von Gestapo und SS mit Unterstützung der RJF mit unverhältnismäßiger Härte verfolgt.
3. Je mehr die HJ die Gemeinschaftsorientierung betonte, umso schlimmer wurde das für diejenigen, die nicht dazugehören wollten oder durften. "HJ-Fähigkeit" wurde zu einer Grenze der Selektion. Dazugehören durften schon die nicht, die nicht oder nicht schnell genug marschieren konnten, weil sie etwa körperlich behindert waren. Hinzu kamen die dissozialen Jugendlichen, die in Fürsorgeerziehungsanstalten saßen oder im Jugendgefängnis. Gewiß: Die HJ hat sich bemüht, im Bündnis mit aufgeschlossenen Sozialpädagogen die Möglichkeiten der Resozialisierung zu verbessern, um den im landläufigen Sinne "erziehbaren" Jugendlichen eine bessere Chance zu geben. Aber "HJ-Fähigkeit" war die Grenze, jenseits derer die RJF sich nicht mehr für zuständig hielt, und erst jenseits dieser Grenze kann man studieren,
227
wes Geistes Kind der biologisch-rassistische Nationalsozialismus wirklich war - im Umgang mit Behinderten, Geisteskranken, Unangepaßten, Andersrassigen. Wenn man den Nationalsozialismus insgesamt pädagogisch würdigen will, dann muß man diese dunkle Seite mitsehen. Die HJ war nur ein Teil der NS-Pädagogik, und gemessen an dem, was jenseits ihrer Grenze lag, war sie in der Tat ein Paradestück, das sich international vorführen ließ.
Ausgeschlossen waren "selbstverständlich" auch die Juden. Sie durften in den Friedensjahren noch eigene Jugendorganisationen unterhalten, an ihrem bekannten weiteren Schicksal ist auch Schirach mitschuldig geworden. HJ-Führer bzw. BDM-Führerin konnte nur werden, wer seine arische Abstammung nachweisen konnte. Zu welch absurden Konsequenzen das führen konnte, zeigt folgendes Beispiel. In einem Interview im Jahre 1980 schilderte Trude Bürkner-Mohr - bis 1937 Reichsreferentin des BDM, also höchste BDM-Führerin - folgenden Fall:
"Ich entsinne mich eines Falles in Berlin, der sich ungefähr 1936 ereignete. Dr. Goebbels rief mich an, weil ein Vater, der Parteigenosse war und in einem östlichen Vorort von Berlin ein sehr bekannter und vermögender Geschäftsmann war, ihm mitteilte, daß er beim Erbringen des Ahnennachweises auf eine jüdische Urgroßmutter gestoßen war. Seine beiden Töchter waren begeisterte und sehr tüchtige Mädel- und Jungmädelringführerinnen, die unter diesen Umständen nicht hätten im BDM bleiben dürfen. Der Vater wagte überhaupt nicht, seine Töchter von dieser Entwicklung zu unterrichten, und ich schlug Dr. Goebbels und dem Vater vor - es waren noch etwa drei Monate bis zur Versetzung -, die Mädchen ab Ostern in einem Internat in der Schweiz anzumelden, ohne den Mädchen die näheren Umstände zu sagen. So wurde dann auch verfahren. Die Mädchen blieben bis Kriegsende in der Schweiz. In Einzelfällen konnte ähnlich geholfen werden" (Rüdiger 1984, 56). Aus dem Text geht nicht eindeutig hervor, ob Frau Mohr wenigstens nachträglich die Absurdität dieser Geschichte klar geworden ist.
Diese Zusammenhänge, die wir jetzt nicht weiter verfolgen können, müssen immer im Blick bleiben, wenn wir Schirachs Konzept der HJ beurteilen wollen. Dann läßt sich folgendes feststellen:
1. Für die damalige Zeit war es nicht ungewöhnlich, eine nationale oder auch nationalistisch orientierte Jugendorganisation zu schaffen. Alle europäischen Länder waren mehr oder weniger nationalistisch orientiert, und die Menschen bezogen aus dieser nationalen Einstellung ein wichtiges Stück ihrer Identität. Den Nationalstaat übergreifende Orientierungen konnten sich erst nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt auf dem Hintergrund des "Kalten Krieges" durchsetzen. Als Beispiel dafür mag der Prozeß der europäischen Integration dienen. Aber bis heute schlummern in den meisten europäischen Ländern nationale Gefühle, die nur eines Anlasses bedürfen, um sich zu artikulieren. Lediglich in Deutschland sind nach dem Zweiten Weltkrieg als eine seiner Folgen nationale Orientierungen weitgehend verschwunden, wie sich bei der deutschen Vereinigung zeigte, bei der nationale oder gar nationalistische Töne so gut wie gar nicht zu hören waren. Gleichwohl müssen wir erkennen, daß andere Völker in diesem Punkte eine relativ ungebrochene Tradition aufweisen.
Für die Zeit vor und nach 1933 waren nationale Orientierungen bis weit in die Arbeiterbewegung hinein selbstverständlich, und die anderen europäischen Völker hielten es für verhältnismäßig normal, daß die Deutschen nach der Niederlage von 1918 wieder ihre nationale Identität suchten.
Ungewöhnlich war nur, daß die HJ sich eine Monopolstellung sicherte und alle anderen - auch die national orientierten - Jugendverbände auflöste oder sich einverleibte. Das wäre in den anderen westeuropäischen Ländern an ihren demokratischen Traditionen gescheitert.
Diese Monopolisierung in Verbindung mit der späteren "Dienstpflicht" war die entscheidende politische Vorgabe für die von der HJ betriebene Jugendarbeit; denn auf diese Weise brach sie mit zwei Traditionen der bisherigen Jugendarbeit in Deutschland, nämlich mit der pluralistischen Angebotsstruktur und mit dem Prinzip der Freiwilligkeit der Mitgliedschaft bzw. der Teilnahme.
Diese Monopolisierung aber wurde schon in den letzten Friedensjahren zum Problem - in den Kriegsjahren traten spezielle Aufgaben in den Vordergrund, was aber über den beginnenden Leerlauf Ende der dreißiger Jahre nicht hinwegtäuschen kann. Trotz der von Schirach eingeleiteten
228
"musischen Wende", die auf die Dauer, wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, die HJ vielleicht zu einem Freizeitverein mit differenzierten Angeboten hätte machen können, stellte sich einfach heraus, daß die "Volksgemeinschaft" im regelmäßigen "Dienst", der ja aus einer Mischung von Militärritual und Pfadfinderei bestand, nicht zu repräsentieren war. Je öfter ein solcher Dienst erlebt wurde, desto seltener konnte er zum "Erlebnis" werden. So wurde der HJ gerade ihre Monopolstellung zum pädagogischen Verhängnis, weil sie auf Dauer - wie die Jugendverbände vor 1933 auch schon - an den sonst üblichen und zugänglichen Freizeitmöglichkeiten gemessen wurde. Solange die HJ in diesem Punkte - also als Freizeitverein -attraktiv blieb, konnte sie auf freiwilligen Zulauf hoffen. Und viele Jungen und Mädchen waren, wenn sie ihre Ferien außerhalb der eigenen Wohnung verbringen wollten, schon aus finanziellen Gründen auf die Angebote der HJ angewiesen. Andererseits war die Monopolstellung natürlich hilfreich bei der Durchsetzung jugendpolitischer Ziele wie der Urlaubsregelung für jugendliche Lehrlinge und Arbeiter.
2. Wie wir schon bei Ernst Krieck gesehen haben, war "Volksgemeinschaft" eine soziale Fiktion, der keine Wirklichkeit entsprach. Es gab in der damaligen Gesellschaft alle möglichen Gemeinschaften und Organisationen, aber keine, die das ganze Volk zu repräsentieren vermochte: die unterschiedlichen Generationen, Klassen, Berufe, Einkommensgruppen, Religionszugehörigkeiten, landsmannschaftlichen Teilkulturen und Traditionen usw.. Aber was war "Volksgemeinschaft" im ganzen? So mußte nach dem Ende der "Kampfzeit" der normale und regelmäßige Dienst Züge von wirklichkeitsfremder Spielerei, einer Art von "Als-ob" annehmen, übrig blieben eigentlich nur vordergründig-pragmatische Aspekte, wie daß es nicht verkehrt sein kann, sich in frischer Luft zu bewegen. Lediglich die gemeinnützigen Tätigkeiten wie Sammlungen abhalten konnten als sinnvoller "Dienst" erfahren werden. Selbst das ursprüngliche Paradebeispiel von "Volksgemeinschaft", nämlich der gemeinsame Dienst aller Jugendlichen ohne Rücksicht auf Klassen- und Standeszugehörigkeit, fand seine Grenzen. Da die Rekrutierung für die HJ nach Wohngebieten erfolgte und damals die Wohngebiete sehr viel stärker als heute nach Stand und Einkommen getrennt waren, blieb die Durchmischung auf der unteren Ebene notwendigerweise beschränkt. Auf
230
der Führungsebene war, mit zunehmendem Rang umso stärker, die Oberschuljugend überrepräsentiert. Wie also sollte "vor Ort" im normalen "Dienst" die "Volksgemeinschaft" "erlebbar" werden?
3. Offensichtlich war das Programm der HJ ein generationsspezifisches. Schirach und die anderen jungen Leute in der Reichsjugendführung hatten als Kinder den Ersten Weltkrieg erlebt, der sie ebenso prägte wie die politischen Wirren der Nachkriegszeit und ihre "Kampfzeit" vor 1933. Diese Erfahrungen schlugen sich nieder in ihrem HJ-Konzept: Die Anknüpfung an ein idealisiertes Frontsoldatentum (Beispiel "Langemarck") oder beim BDM an die Frauen der "Heimatfront". Das waren ihre Väter und Mütter, teilweise auch Brüder und Schwestern gewesen. Aber die Generationserfahrungen wechseln schneller als die Generationen, und schon Ende der dreißiger Jahre zeichnete sich ab, daß sie nicht einfach übertragbar waren. Wer 1938 zum "Jungvolk" kam, hatte den Krieg nicht mehr und die Weltwirtschaftskrise nur als Säugling oder Kleinkind erlebt, und was die noch gar nicht so alten Führer der ersten Stunde wie Schirach noch selbst erfahren hatten, war für den Zehnjährigen von 1938 bereits "Geschichte".
Schirach scheint dieses Problem verstanden zu haben und reagierte darauf mit der "Musischen Wende" und mit dem Versuch, der HJ in der Gestalt Goethes und damit der deutschen Klassik eine generationsunabhängige Tradition zu stiften. Für die Führungsgeneration der ersten Stunde um Schirach bedeutete die HJ-Tätigkeit einen persönlichen Aufstieg - weniger im materiellen Sinne, denn die Gehälter für die Hauptamtlichen waren bescheiden, sondern eher im politisch-kulturellen Sinne. Sie erhielten in relativ jungen Jahren - im Alter unserer Studenten! - Chancen für eine selbständige, alle Fähigkeiten herausfordernde und zudem öffentlich hoch angesehene Tätigkeit, wie sie Menschen dieses Alters nur selten zuteil wird. In der Weimarer Zeit hätten sie eine derartige Chance kaum bekommen, weil damals die Führungskräfte bis hin zur Arbeiterbewegung ein hohes Alter hatten und jungen Leuten das Nachrücken verwehrten. Während diese junge Führergruppe also diese Zeit verständlicherweise als "erfülltes Leben" ansehen konnte, stellte sich die Sache für die Jüngeren durchaus anders dar. Sie kamen zu einer etablierten und durchaus schon bürokratisierten Or-
231
ganisation, in der sie ihren "Dienst" ableisten sollten. Wenn sie Glück hatten, trafen sie auf einen pfiffigen Führer, der die Sache einigermaßen spannend machte, sonst konnte es recht langweilig werden.
Das Schicksal der Generationsabhängigkeit eines pädagogischen Konzeptes galt übrigens nicht nur für die HJ, das Problem stellte sich auch vorher und nachher. Die "Wandervogel-Generation" vor dem Ersten Weltkrieg z.B. war ganz anders geprägt und entwickelte andere Bedürfnisse als die "Bündische Jugend" nach dem Krieg. Die Gegensätze waren so groß, daß sich die Älteren und die Jüngeren kaum mehr verstanden. Ein weiteres Beispiel ist die FDJ in der ehemaligen DDR, die ja ebenfalls ein weitgehend monopolisierter Jugendverband war. Gegründet und getragen zunächst von einer Generation, die im Widerstand gegen die Hitler-Diktatur und damit auch gegen die HJ mit einem "anti-faschistischen" Denk- und Handlungsmodell Politik und Staat in Deutschland neu ordnen wollte, wurde diese Massenorganisation immer mehr zu einer differenzierten Freizeitorganisation, in der die ursprünglichen politisch-moralischen Ausgangswerte zu ritualisierten Phrasen verkamen, weil sie die Generationserfahrung der Jüngeren nicht mehr trafen.
Mit diesem Problem der wechselnden Generationserfahrungen haben alle pädagogischen Berufe ihre Mühe, auch die Schule; sie muß darauf z.B. mit neuen didaktischen und methodischen Strategien reagieren. Aber für eine Jugendorganisation wie die HJ ist es von existentieller Bedeutung, weil Programme und Methoden, die zunächst "erfolgreich" waren, innerhalb weniger Jahre ins Leere laufen können, eben weil sie auf einmal an einer neuen Generationsgestimmtheit vorbeigehen.
4. Dieses Dilemma mußte sich insbesondere für die zentrale pädagogische Kategorie "Erlebnis" bemerkbar machen. Wie jemand eine bestimmte arrangierte Situation, z.B. eine Feierstunde oder einen Lageraufenthalt, "erlebt", kann man ihm nicht vorschreiben. Man kann es durch emotional-kalkulierte Inszenierungen provozieren. Dennoch muß aber immer wieder ein Funke überspringen, und das geschieht nur dann, wenn eine entsprechende "Gestimmtheit" vorliegt. Eine emotional ansprechbare Grundgestimmtheit ist aber abhängig von der erwähnten grundlegenden Generationser-
232
fahrung. Um das Jahr 1933, als viele Menschen geradezu in einen Rausch gerieten und in Hitler und seiner Bewegung den Hoffnungsträger sahen, der sie aus ihrer Notlage befreien würde, war die Stimmung auch bei jungen Menschen anders als etwa im Jahre 1938. Nun war Alltag eingekehrt, die Menschen gingen ihren Aufgaben und Pflichten nach und versuchten, ihre Alltagsprobleme zu lösen. Jetzt war auch der HJ-Dienst zu etwas Alltäglichem geworden, von dem keine besondere Faszination mehr ausging. Die positiven Erlebnisse wollten sich nicht mehr so recht einstellen.
Wer sein pädagogisches Konzept auf "Erlebnis" baut, macht sich abhängig von der Gestimmtheit seiner Partner. Trifft er diese nicht, provoziert er Widerstand oder zumindest innere Distanz. Das gilt nach wie vor. Heute allerdings muß sich die Jugendarbeit als Teil eines komplexen Freizeitmarktes sehen, im Wettbewerb stehend mit zahlreichen kommerziellen Angeboten. Insofern sind "erlebnispädagogische" Angebote heute Versuche, sich marktgerecht zu verhalten, Marktlücken wahrzunehmen und auf diese Weise Teilnehmer zu gewinnen. Hier wird die Abhängigkeit der Pädagogik von ihren Partnern im Ausmaß der Nachfrage erkennbar. Derartige regulierende Mechanismen kannte die HJ nicht, sie mußte sozusagen im Rahmen einer pädagogischen Planwirtschaft agieren, mußte versuchen, entweder die wirklichen Bedürfnisse und Interessen der Jugendlichen zu antizipieren, oder sie zu leugnen. Solange also der eher pflichtorientierte "Dienst" mit subjektiven "Erlebnissen" verbunden blieb, entstand kein besonderes Problem. Fielen beide aber auseinander, dann mußte zwangsläufig der Pflicht- und Disziplinarcharakter des Dienstes stärker hervortreten. Dies wurde in den letzten Jahren vor dem Kriege erkennbar, und der Krieg hat hier möglicherweise einen pädagogischen Offenbarungseid verhindert.
Mit dem Konzept der "Erlebnispädagogik" ist aber noch ein weiteres prinzipielles Problem verbunden. Wie weit tragen solche Erlebnisse eigentlich? Üblicherweise sind pädagogisch inszenierte Erlebnissituationen ja künstliche, d.h. sie werden gerade deshalb pädagogisch arrangiert, weil sie sich im normalen Leben nicht oder nicht im gewünschten Umfange ergeben. Sie beziehen sich zunächst einmal nur auf diese jeweilige Situation. Wen also das Gemeinschaftserlebnis einer HJ-Feier beeindruckte, der ging ja anschließend
233
wieder nach Hause, zu seiner Familie, in die Schule, an den Arbeitsplatz. Mag sein, daß ihm eine Weile das positive Erlebnis Mut und Motivation zur Alltagsbewältigung gab, oder daß er die tristen Seiten seines Alltags besser ertrug unter dem Aspekt der baldigen Wiederholung dieses positiven Erlebnisses. Aber es blieben doch eben "Sonntagserlebnisse", die nicht ohne weiteres den Alltag beeinflußten, der nach ganz anderen Regeln und Normen ablief. So muß es doch auch nachdenklich stimmen, wenn Schirach die Disziplin in seinem HJ-Heim preist, während dieselben Jungen am nächsten Morgen in der Schule wieder zur üblichen Rasselbande und zu infantilen Pennälern werden. Der Glanz des HJ-Heimes strahlte nicht auch in die Schulstube hinüber; die Jungen verhielten sich in unterschiedlichen Situationen jeweils nur angemessen. Das ist übrigens heute genauso. Zu Hause verhalten sie sich anders als in der Schule und wieder anders in der Disco. Diese Verhaltensdifferenzierung - sich an dem jeweiligen sozialen Ort angemessen nach den dort üblichen Regeln und Erwartungen verhalten zu können - ist ein bedeutsames Stück sozialen Lernens.
Man kann also davon ausgehen, daß im allgemeinen die Erlebnisse der HJ auf das Leben in der HJ beschränkt blieben. Anders verhielt es sich mit vielem, was man praktisch lernte: Sport, Gesundheitsinformationen, handwerkliche Techniken, künstlerische Fertigkeiten usw. Solche Kenntnisse und Fähigkeiten waren durchaus auf den Alltag übertragbar. Aber sie machten eben nicht den Kern dessen aus, was die HJ-Erziehung eigentlich erreichen wollte.
5. Das Konzept des "Vorbildes" muß ähnlich gesehen werden. Das Vorbild des HJ-Führers war zunächst einmal nur im Rahmen der HJ verwendbar. Schon beim Militär, dem die HJ äußerlich so ähnlich war, galten ganz andere Regeln - von Schule und Beruf ganz zu schweigen. Aber bezogen lediglich auf das HJ-Leben vermochte der Appell, sich vorbildlich für andere Gleichaltrige zu verhalten, sicher bei vielen Jungen und Mädchen Selbstbewußtsein und Motivationen für sozial angemessenes Handeln freizusetzen. Bei Licht besehen handelte es sich jedoch um partikulare Vorbilder, die keineswegs alle wesentlichen Probleme des jugendlichen Lebens ansprachen. Von einem guten dreizehnjährigen Jungvolkführer konnte ein zwölfjähriger Pimpf vielleicht lernen, wie man taktisch geschickt ein Geländespiel gewinnt, wie man Diszi-
234
plin durchsetzt, wie man Befehle erteilt, oder wie man einen Konflikt in der Gruppe entschieden, aber auch kameradschaftlich löst. Aber schwerlich konnte man von ihm lernen, wie man mit Mädchen umgeht, zu Hause einen Konflikt löst, oder mit den Leistungserwartungen der Schule umgehen soll; dies hätte die dienstliche Dimension überschritten. Und hätte sich unser Pimpf wirklich nahezu total mit seinem jungen Führer identifiziert, hätte ihn dies eher in seiner eigenständigen Entwicklung behindern können.
Aber Schirach hatte mehr im Sinn als ein solches doch eher individuell orientiertes Vorbild-Konzept. Seine Absicht war, einen kollektiven Führer-Typus zu schaffen, mit einer gemeinsamen Haltung, Lebenseinstellung, mit einheitlichem Wertbewußtsein. Zur Ausprägung eines solchen Typus sollten nicht zuletzt die Adolf-Hitler-Schulen und die Braunschweiger Akademie für Jugendführung dienen. Die dahinterstehende Idee des "Ordens", die auf ihre Weise auch die SS zu realisieren suchte, war schon in Teilen der "Bündischen Jugend" der Weimarer Zeit zu finden - dort wie hier mit einem unübersehbaren Elite-Anspruch. Soziologisch gesehen ging es darum, erwünschte und idealisierte Lebenswelten und Lebensformen, die in der modernen, arbeitsteilig organisierten und auf persönlicher Konkurrenz beruhenden Gesellschaft nicht mehr von selbst sich einstellten, mit pädagogischen Mitteln wieder einzuführen. Insofern waren sie teilkulturelle Kunstprodukte, und es ist sehr fraglich, ob sie in Friedenszeiten auf die Dauer eine wirkliche Chance gehabt hätten; denn auch hier - wie schon beim "Erlebnis" - stellt sich die Frage nach der gesellschaftlichen Brauchbarkeit. Wäre ein solcher Führer-Typus, wie er Schirach vorschwebte, z.B. tauglich gewesen für die in einem modernen Industriebetrieb erforderlichen Haltungen und Einstellungen? Oder hätte er hier nicht eher weltfremd gewirkt?
Die grundsätzliche pädagogische Frage ist, ob man überhaupt mit pädagogischen Mitteln, also durch eine bestimmte Erziehung, eine erwünschte gesellschaftliche Realität produzieren kann, die sich sonst, nämlich im normalen gesellschaftlichen Leben - in Wirtschaft, Politik, Verwaltung, Kultur - nicht mehr von selbst ergibt. Diese Frage ist nicht nur an Schirach, sondern an die moderne Pädagogik überhaupt
235
bis auf den heutigen Tag zu stellen. Gerade im deutschen Begriff von "Erziehung" war immer der Gedanke virulent, man müsse Kinder und Jugendliche in allgemeiner, sozusagen prinzipieller Weise sittlich und moralisch erziehen, damit sie - mit diesem Fundus ausgestattet - als Erwachsene die Welt nach solchen moralischen Maßstäben zu gestalten in der Lage sind. Versittlichung der Welt durch richtige Erziehung war das Programm. Aber spätestens seit Beginn unseres Jahrhunderts, mit dem Einsetzen der Reformpädagogik, wurde dieses pädagogische Weltverbesserertum auch weltfremd, stemmte sich gegen die dominierenden gesellschaftlichen Tendenzen der Individualisierung, Pluralisierung, Arbeitsteilung und Mobilität. Pädagogik wurde zur Zivilisationskritik schlechthin. "Menschenbilder" als Wunschbilder entstanden in den Köpfen von Pädagogen, die der gesellschaftlichen Realität, den in ihr erforderlichen Denk- und Handlungsnotwendigkeiten immer weniger entsprachen. Kriecks und Baeumlers Kritik an diesem Bildungsverständnis war keineswegs unberechtigt. Gerade die Reformpädagogik liefert eine Fülle anschaulicher Beispiele für den illusionären Versuch, die gesellschaftliche Realität ausgerechnet z.B. durch zivilisationsferne Landerziehungsheime verbessern zu wollen. In dieser Tradition steht auch Schirachs Absicht, einen besonderen Führertypus auszubilden. Welche Verhaltensweisen, Charakterzüge, Tugenden sollten in diesem Typus zum Zuge kommen, und warum gerade diese und keine anderen? In der gesellschaftlichen Wirklichkeit spielt sich das anders ab. Dort bilden sich zum Beispiel Typen von Handlungskompetenz von selbst heraus, weil sie gebraucht werden; sie werden jedenfalls nicht auf Ober- und Hochschulen fabriziert. Darin ist Krieck zuzustimmen, daß der Anteil der planmäßigen, absichtsvollen Erziehung an der menschlichen Persönlichkeit eher gering ist; das meiste und wichtigste ergibt sich durch soziales Tätigsein in den jeweils zugänglichen Handlungsfeldern, also "funktional" im Sinne Kriecks. Eigentlich war die HJ wie auch die Jugendbewegung vorher ein Freizeitarrangement für ein Jugendleben, mit dem sich pädagogisch nicht viel verderben ließ. Der Einfluß dieses Arrangements war begrenzt, weil seine Wirkung zeitlich recht begrenzt war. "Dienst" fand höchstens ein- oder zweimal in der Woche statt, der Rest der Zeit wurde zu Hause, in der Schule, am Arbeitsplatz, vielleicht in der Kirche, mit Freunden verbracht. Selbst die "Lager" in den Fe-
236
rien waren nach spätestens drei Wochen wieder zu Ende. Die "Führer" an der Basis waren so, wie eben junge Leute damals waren. Was sie in "Führerschulungen" an Nützlichem und Praktischem für ihre Führungstätigkeit lernten, konnte das "Jugendleben" unten bereichern und Spaß machen. Mit der Absicht jedoch, über das Praktische und Nützliche hinaus mit pädagogischer Planmäßigkeit einen Vorbild-Typus als eigenständige Lebensform zu schaffen, erhielt die Sache eine neue Qualität, die allerdings wegen des Krieges nicht mehr durchschlagen konnte. Dieser Führer-Typ wäre nämlich auf die Dauer zu einer Art von "Berufs-Führer" geworden, der die Naivität der üblichen HJ-Arbeit an der Basis zum Verschwinden gebracht hätte zugunsten einer beruflichen Profilierung, die am ehesten noch in Richtung Indoktrination und Agitation, jedenfalls auf der ideologischen Ebene zu erwarten gewesen wäre. Es war nämlich gerade die Nicht-Professionalität der unteren HJ-Führer, die solche Einwirkungen in Grenzen hielt.
Spätestens an dieser Stelle wird deutlich, daß wir bei der pädagogischen Beurteilung der HJ unterscheiden müssen zwischen dem, was unten an der Basis geschah, und den Ideen, Plänen und Praktiken auf der Ebene der oberen Führer, des "Führer-Korps", von denen hier die Rede ist. Solange unten die erwähnte Naivität Ton und Stil angab, gab es zwar Übergriffe, Ungereimtheiten, auch mal Unverschämtheiten, aber dies hatte noch kein System, sondern war eher spontanen Ursprungs. Gerade das theoretisch und professionell Imperfekte war das Humane daran.
Aber kehren wir zum Problem des Vorbildes zurück. Kinder und Jugendliche brauchen Erwachsene vor Augen, die etwas erreicht haben, was sie selbst anstreben. Das können Menschen aus dem familiären Umfeld sein, aber auch solche Personen, die man persönlich nicht kennt, die nur auf dem Fernseher oder in Büchern auftauchen. Auch Erwachsene haben Vorbilder, sie gestehen es sich nur selten ein. Sie orientieren sich ebenfalls an Menschen, die irgend etwas besser können als sie selbst. Auch in der NS-Zeit haben junge Menschen sich Vorbilder gesucht, mit denen sie sich identifizieren konnten, und das waren sicher nicht nur HJ-Führer. Gleichwohl legt der jeweilige Zeitgeist einen bestimmten Typus des Vorbildes nahe, damals wohl nicht zuletzt den Typus des Offiziers.
237
Im Einzelfälle ist die Wahl von Vorbildern ein kompliziertes Unterfangen, hängt nicht nur vom jeweiligen Zeitgeist ab, sondern auch von dem im jungen Menschen sich entwickelnden Lebensentwurf. Eine falsche Wahl dabei zu treffen, gehört zu den Risiken des jugendlichen Lebens; auch Terroristen haben ihre Vorbilder. Wer als junger Mensch in der NS-Zeit sich der Nazibewegung zugehörig fühlte, suchte sich andere Vorbilder als jemand, der in Distanz oder gar in innerem Widerstand zu ihr stand.
Kompliziert wird die Vorbildsuche auch deshalb, weil ein einziges Vorbild nicht mehr ausreicht für alle Aspekte des eigenen Lebensentwurfes. Vorbilder müssen pluralisiert werden, das eine imponiert z.B. wegen seines beruflichen Könnens, das andere als verläßlicher Ehepartner, ein drittes wegen seines souveränen öffentlichen Auftretens (z.B. im Fernsehen). Vorbilder zu finden ist kein einmaliger Akt, sondern ein zeitlicher, also biographischer Prozeß, zu dem auch das Abstoßen oder Wechseln von Vorbildern gehört. Es wäre also abwegig, Vorbilder für andere pädagogisch einplanen zu wollen, wie es Schirach vorhatte. Junge Leute montieren sich das, was sie zu brauchen glauben.
Keineswegs abwegig jedoch war die Idee, Gleichaltrige zum vorbildhaften Verhalten gegenüber ihresgleichen zu ermuntern; denn damals wie heute brauchen Kinder und Jugendliche die Ermutigung durch diejenigen, die etwas besser können als sie selbst, die aber nicht so weit entfernt sind wie ein Erwachsener. Um ein Beispiel aus dem Sport zu nehmen: Ein Junge, der ein guter Fußballer werden will, orientiert sich sicher an einer Spielerpersönlichkeit wie Beckenbauer, aber auch an seinem Mittelstürmer in der Jugendmannschaft, von dem er das Dribbeln lernen kann.
Ähnlich muß man wohl urteilen über die Leitmotive "Ehre" und "Kameradschaft", die auch in Verbindung mit "Ritterlichkeit" die Norm für den Umgang zwischen Jungen und Mädchen sein sollten. Für die damaligen jungen Leute enthielten diese Worte Vorstellungen, die sowohl zur inneren Stabilität wie zu einem angesehenen Sozialverhalten führen konnten. Solange die damit verbundenen Erwartungen, Bilder und Mythen auf das Jugendleben beschränkt blieben, handelte es sich um eine Art von Pfadfinderei. Daß sie letztlich wie die Volksgemeinschaft auf sozialen Fiktionen beruhten, kann dann außer acht gelassen werden.
238
Problematisch wurden diese Attitüden erst, als sie auch die Vorstellungswelt von Erwachsenen beherrschen konnten wie wir am Beispiel des "Germanismus" von Baeumler gesehen haben. Problematisch war ferner, daß die soziale Werthaltung, die in den Begriffen zum Ausdruck kam, nur in bezug auf die eigene Gruppe galt und insoweit die Ausgrenzung anderer einschloß. Die Frage ist jedoch, ob dies den Jüngeren bewußt geworden ist. Folgenreicher jedenfalls war, daß diese auf die eigene Gruppe begrenzte Moral auch das Wertbewußtsein von Erwachsenen bestimmte. Diese Moral war nicht an der demokratischen Tradition der Menschenrechte orientiert, die dem menschlichen Individuum vor jeder sozialen Zugehörigkeit eine grundsätzliche Würde zubilligt. Die Folgen sind bekannt.
6. Mit seiner scharfen Schulkritik sprach Schirach in seiner Rede über die "Einheit der Erziehung" sicher vielen jungen Menschen aus der Seele. In der Tat traf diese Kritik insbesondere das humanistische Gymnasium keineswegs unverdient.
Unsere heutigen pädagogischen Maximen, daß an den Bedürfnissen und Interessen der Schüler angeknüpft werden müsse, daß der Unterricht zwar auch auf das künftige Leben vorbereiten, zugleich aber auch das gegenwärtige Leben der Schüler kritisch-fördernd begleiten müsse, waren damals weitgehend unbekannt, obwohl die Reformpädagogik sie längst propagiert hatte. Zwar bemühte sich eine jüngere Generation von Lehrern zumindest teilweise um moderne Formen des Unterrichts und der Beziehung zu ihren Schülern, dennoch waren die Schulen noch weitgehend Disziplinierungsanstalten geblieben. Nicht von ungefähr war das Gymnasium ein beliebtes Motiv für Spott und Satire, wie sie etwa in der "Feuerzangenbowle" von Spoerl oder in "Professor Unrat" von H. Mann zum Ausdruck kommen. Jedenfalls stand die erzieherische Disziplinierung der Schüler im Vordergrund, die sich einmal aus der Sache und zum anderen aus der Institution rechtfertigte. Die "Sache", also die Unterrichtsstoffe - gerade auch die scheinbar weltfremden wie die alten Sprachen -sollten die Schüler zwingen, ihre eigenen Interessen, Gefühle und Bedürfnisse für bedeutungslos zu halten angesichts der Bedeutungsschwere der sittlichen, kulturellen und ästhetischen Gehalte, die der Unterricht präsentierte. Die Schule als Institution sollte dafür sorgen, daß der Schüler sich diesen allgemeinen Prinzipien gemäß ver-
239
hielt - nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb der Schule.
Paradoxerweise war es aber gerade diese von heute aus gesehen "rückständige" und teilweise auch "reaktionäre" pädagogische Grundhaltung, die dann Möglichkeiten des Widerstandes oder zumindest der Distanz gegenüber der NS-Ideologie eröffnete. Lehrer konnten streng bei ihrer Sache bleiben, scheinbar ohne jede Rücksicht auf die aktuellen Zeitläufe, und doch hier und da eine Bemerkung fallen lassen, die zum Nachdenken über die Aktualität anregen konnte, ohne daß sie sich allzu gefährlich damit hervorwagen mußten. Die Schuldisziplin andererseits vermochte bis zu einem gewissen Grade Einflüsse von außen abzuwehren, weil der Begründung schwer zu widersprechen war, daß Disziplin nun einmal nötig sei. Nach allem, was wir heute wissen, scheint das traditionelle Gymnasium weniger von der NS-Ideologie okkupiert worden zu sein als etwa die Volksschule. Während das Gymnasium sich immer von seiner Sache her verstand, also von den Inhalten des Unterrichts, verstand sich die Volksschule primär vom Schüler her, und die Ideen der Reformpädagogik hatten deshalb hier erheblich mehr Resonanz gefunden. Je weniger jedoch in diesen Schulen der Eigenwert der Sache geltend gemacht werden konnte, um so weniger Widerstandsmöglichkeiten bestanden gegen ideologischen Druck von außen. Das führt zu der vielleicht überraschenden Einsicht, daß gerade die "fortschrittliche" Pädagogik, die sich um die Subjektivität des Schülers besonders bemühte, auch besonders schutzlos war gegen ideologische Verführungen. Indem die Reformpädagogik die Sachverhalte zu erzieherischen Zwecken instrumentalisierte - was davon ist gut und nützlich für das Kind, dient seiner sittlichen Entwicklung -, machte sie diese pädagogischen Zwecke auch fast beliebig austauschbar. An die Stelle des reformpädagogischen Ideals der optimalen individuellen Entwicklung konnte mühelos das kollektive Ideal des "Volksgemeinschafts-Menschen" treten. Dieses Problem stellt sich übrigens bis heute. Die bildungspolitischen Auseinandersetzungen in den 70er Jahren zum Beispiel zwischen "Linken" und "Konservativen" beruhten schlicht darauf, daß bestimmte pädagogische Zwecke im Hinblick auf ein erwünschtes Verhalten der Schüler vorgegeben wurden, nach denen dann die Stoffe des Unterrichts bzw. die Fragestellun-
240
gen an diese Stoffe ausgewählt werden sollten. Mit anderen Worten: Es ist die erzieherische Absicht selbst, die disponibel macht für ideologische Einbrüche, weil sie nicht auf sachliche Aufklärung aus ist, sondern auf die Herstellung eines erwünschten Verhaltens bzw. einer erwünschten Gesinnung.
Schirach hielt sich jedoch nicht für einen ideologischen Verführer, sondern für einen pädagogischen Reformator. Dabei hat er ein Dilemma der pädagogischen Berufe durchaus richtig gesehen: Die professionelle Deformation, die geradezu unvermeidlich dadurch eintritt, daß man auf einen in jungen Jahren gewählten pädagogischen Beruf bis zum Ende seines Berufslebens im allgemeinen fixiert bleibt. Wer heute offen mit älteren Lehrern oder Sozialpädagogen sprechen kann, erfährt meist schnell, eine wie schreckliche Perspektive das ist. Ein Hochschullehrer kann mit der ständigen Erfahrung, daß seine StudentInnen immer jünger werden, die andere verbinden, daß er durch seine Studien und Forschungen sich selbst weiterbildet und dadurch vielleicht doch auch wertvoller für seine Hörer werden kann. Ein Schullehrer hat es da weitaus schwerer, weil er zwar auch seine zunehmende lebensgeschichtliche Erfahrung und seine Weiterbildung in den Umgang mit Schülern einbringen kann, jedoch in einem weit geringeren Maße, weil der Schulunterricht thematisch relativ begrenzt ist. Der Typ des Lehrers, der Jahr für Jahr dieselben Lektionen aus der Schublade zieht, sich nach Ferien und Freizeit sehnt, möglichst keine Zeit investiert, die nicht unabweisbar dienstlich gefordert ist, ist auch heute massenhaft verbreitet, und wer sich darüber mokiert, möge bedenken, daß ein solches Verhalten von einem bestimmten Zeitpunkt an schon aus Selbstschutz notwendig wird.
Gegen Schirach muß deshalb klargestellt werden, daß diese Notwendigkeit in das professionelle Selbstbild mit übernommen werden muß, um Fehleinschätzungen oder gar psychosomatische Erkrankungen zu vermeiden. Erzieherisches Dauer-Engagement, wie Schirach es sich vorstellte, ist nur relativ kurze Zeit durchzuhalten, was darüber hinausgeht, droht schnell neurotische Züge anzunehmen. Insofern ist der "Unterrichtsbeamte", wie Schirach ihn karikierte, bis zu einem gewissen Grade eine professionelle Notwendigkeit.
Trotz solcher Einwände ist Schirachs Idee einer größeren Mobilität innerhalb der pädagogischen Berufe keineswegs
241
von vornherein abwegig. Es wäre sicher ein Glück für alle Beteiligten, vor allem auch für die betroffenen Kinder, wenn die jahrzehntelange Fixierung auf einen pädagogischen Teilberuf - bei den Lehrern noch wieder unterteilt in Grundschule, Hauptschule, Realschule und Gymnasiallehrer - zugunsten einer gewissen Fluktuation verändert werden könnte. Warum sollte - um Schirachs Beispiel zu variieren - nicht jemand bis zum Abitur in einem Jugendverband mitwirken, mit 22 Jahren Sozialpädagoge sein, nach fünf oder sechs Jahren Berufserfahrung in der Jugendarbeit oder in einem Jugendgefängnis nach einem Zusatzstudium Lehrer werden, nach weiteren fünf oder sechs Jahren in die Erwachsenenbildung gehen, mit etwa 40 nach einem weiteren Fortbildungsstudium wieder an die Schule - diesmal vielleicht in einer anderen Schulform - und mit etwa 50 in die Verwaltung gehen oder als Leiter einer pädagogischen Einrichtung tätig werden? Und dies nicht etwa im Sinne einer behördlich festgeschriebenen Laufbahn-Karriere, sondern einer individuellen freiwilligen, aber auch vom Dienstherrn zu honorierenden beruflichen Mobilität.
Dagegen sprechen heute eigentlich nur die äußeren Bedingungen: die Laufbahn- und Besoldungsvorschriften, das Interesse der Administration an kalkulierbarem Personal und sicher auch das gewerkschaftliche Interesse an klaren Dienststellenbeschreibungen und an einer eindeutigen Klientel für Gehaltsforderungen. Gewiß gibt es solche Mobilität in eingeschränkter Form auch heute: Ein Hauptschullehrer kann sich zum Realschullehrer, dieser zum Gymnasiallehrer fortbilden, und einigen wenigen gelingt es, in der Schulverwaltung tätig zu werden.
Jedenfalls lehrt uns unsere Erfahrung, daß bestimmte pädagogische Tätigkeiten im allgemeinen optimal in einem bestimmten Lebensalter erledigt werden können. Aufgaben, die eines besonderen persönlichen Einsatzes bedürfen, können eher von Jüngeren als von Älteren erfüllt werden. Es gibt heute an unseren Schulen Kollegien, deren Mitglieder kaum jünger als 50 sind. Es fehlen die Jüngeren, die z.B. engagiert und mit Spaß an der Sache einen Schullandheimaufenthalt arrangieren würden. Fortbildung durch Berufswechsel hätte jedenfalls eine andere Qualität als jene Fortbildung, die der Dienstherr heute wünscht und die die Fixierung auf den pädagogischen Teilberuf nur verstärkt. "Fortbildung" in diesem
242
Sinne ist nämlich nicht, wenn ein Geschichtslehrer an einem Historiker-Kongreß teilnimmt, sondern wenn er unter seinesgleichen bleibt und mit ihnen über neue methodische Finten des Unterrichts nachsinnt.
Schirachs Forderung nach einer Mobilisierung der pädagogischen Berufe, nach der Aufhebung ihrer bornierten Arbeitsteiligkeit ist auch heute noch einer ernsthaften Diskussion würdig. Aber unter dem Stichwort der "Einheit der Erziehung" wollte er mehr, nämlich die Integration dieser Berufe mit Parteitätigkeiten unter der leitenden Idee der übergreifenden nationalsozialistischen Weltanschauung. Darin steckt wie in anderer Weise bei Hitler und Krieck die Wunschvorstellung eines Erziehungsstaates, dessen Realität im ganzen nach den gleichen weltanschaulichen Prinzipien gestaltet werden soll. Die in der HJ entwickelten Erziehungsmaßstäbe sollten auch auf die Schule übergreifen und dann über das in den Adolf-Hitler-Schulen und der "Akademie für Jugendführung" geprägte Führerkorps im ganzen Volk, in Staat und Gesellschaft wirksam werden. Das war nicht nur im Sinne einer Anpassung gemeint, einer ständigen Reproduktion des Bestehenden, sondern durchaus auch im Sinne einer Erneuerung bzw. Verbesserung der in der Partei und ihren Organisationen anzutreffenden Haltungen und Gesinnungen, in der Art eines "jungen Nationalsozialismus" mit durchaus elitären Zügen. Ähnlich sah sich damals die noch junge SS, mit der Schirach nicht zuletzt deshalb auch zu kooperieren versuchte.
Der Krieg ließ - außer in Ansätzen im Rahmen der KLV-Lager - diese "Einheit der Erziehung" nicht Wirklichkeit werden. Vieles spricht dafür, daß sie gescheitert wäre. Zum einen wäre die Massenorganisation der HJ gar nicht in der Lage gewesen, einen derartig hohen Anspruch einzulösen. Sie war eine Jugendorganisation, und wollte sie als solche erfolgreich sein bzw. bleiben, mußte sie sich im wesentlichen auf ihre eigenen Probleme konzentrieren. Zum anderen beruhte die Anziehungskraft der HJ - wie auch der Jugendbewegungen vor ihr - gerade darauf, daß sie weder Elternhaus noch Schule war, was in Schirachs Rede ja auch unfreiwillig deutlich wurde, wenn er auf das unterschiedliche Verhalten der Jungen in Schule und HJ-Heim hinweist. Vermutlich hätte sich auf die Dauer auch in den Adolf-Hitler-Schulen das übliche "Pennäler-Verhalten" eingestellt, wenn dieser Schultyp
243
sich erst einmal bürokratisch auf Dauer gestellt hätte. Die Erziehungsutopie von der "Einheit der Erziehung" ignorierte den arbeitsteiligen Charakter der damaligen Gesellschaft. Verstand man in diesem arbeitsteiligen Rahmen die Schule primär als Stätte des Unterrichts - wofür auch Baeumler plädierte -, dann war auch das "Schulleben" auf diese Aufgabe auszurichten, und ein demgegenüber gleichberechtigter oder gar übergeordneter pädagogischer Anspruch, wie ihn die HJ vertrat, hätte diese Aufgabe nur beeinträchtigen können. In den ersten Jahren hat es derartige Konflikte auch wiederholt gegeben, aber im wesentlichen hatte sich dabei die Schule gegen die HJ durchgesetzt. Als nun am Ende der 30er Jahre die Schulleistungen gesunken waren, während gleichzeitig der Bedarf an qualifiziertem Nachwuchs zunahm, hatte Schirachs Anspruch auf die Schule keine Chance mehr, zumal seiner HJ und ihrer schul- und lehrerfeindlichen Agitation öffentlich eine Mitschuld an dieser Entwicklung angelastet wurde.
Während
Baeumler zu
Recht zwischen den Erziehungsfunktionen von Familie, Schule und HJ
strikt
unterschied, weil sie nicht auseinander ableitbar seien, plädierte
Schirach im Gegenteil für eine Art von HJ-Pädagogisierung der
Schule. Dabei übersah er, was Baeumler ausdrücklich betonte,
daß weder dem Schüler noch dem Lehrer damit gedient ist,
wenn
die Lehrer sich als "Freunde" oder "Kameraden" der Schüler
verstehen
und damit die nötige Distanz aufheben, die nicht nur darin
begründet
liegt, daß die Lehrer "das Pensum schon hinter sich haben", wie
Baeumler
es ausdrückte, sondern daß der Lehrer auch über die
Vergabe
von Berechtigungen entscheidet, auf die der Schüler angewiesen
ist.
Der Lehrer tritt also dem Schüler nicht nur als Person
gegenüber,
sondern auch als Repräsentant einer im Prinzip unpersönlichen
Institution, die als solche Forderungen an den Schüler stellt.
Die HJ
im Kontext
der Jugendgeschichte
Bisher habe ich das HJ-Konzept im einzelnen einer kritischen Würdigung zu unterziehen versucht. Dieses Kapitel soll nun der Frage nachgehen, wie die HJ im Zusammenhang
244
der Jugendgeschichte unseres Jahrhunderts zu sehen ist. Die Historiker diskutieren diese Frage u.a. unter dem Gesichtspunkt der Kontinuität bzw. der Diskontinuität. War die HJ im wesentlichen eine plausible Weiterentwicklung von Strömungen und Tendenzen, die längst vorher eingesetzt hatten, die sich in ihr nur fortsetzten bis auf unsere Tage? Oder bedeutet sie einen Bruch innerhalb einer solchen Kontinuität, so daß diese erst nach 1945 wieder fortgesetzt werden konnte? Die Beantwortung dieser Frage ist auch für die politisch-moralische Beurteilung jener Zeit von großer Bedeutung. Die Problematik der Mitschuld der Deutschen an der politischen Kriminalität des Nazi-Regimes stellt sich anders dar, wenn wir die NS-Herrschaft als einen Bruch mit der damaligen deutschen Tradition, vielleicht sogar als einen Überfall auf politsch Ahnungslose ansehen, als wenn wir von der Vermutung einer Kontinuität ausgehen, also davon, daß die NS-Zeit ihre plausible Vorgeschichte hatte und in gewisser Weise Vorgeschichte für die Entwicklung nach 1945 gewesen ist.
Ich will dieses Problem hier nicht im allgemeinen aufgreifen, sondern bezogen auf unser Thema, die Organisation der Jugend. Schon an mehreren Stellen war deutlich geworden, daß die HJ nicht einfach "vom Himmel gefallen" ist, sondern das allermeiste, was für sie charakteristisch war, gar nicht selbst erfunden, sondern vorgefunden hatte.
Das hängt mit der Tatsache zusammen, daß gegen Ende des vorigen Jahrhunderts "Jugend" als eine eigenständige soziale Gruppe ins Bewußtsein der Öffentlichkeit trat - ähnlich wie "die" Arbeiter oder "die" Frauen. Das 19. Jahrhundert kannte nur Kinder und Erwachsene. Die pädagogischen Bemühungen waren auf die Kinder konzentriert, vor allem auf die der unteren Schichten, der Proletarier. Die des Bürgertums oder gar des Adels schienen keiner besonderen öffentlichen Aufmerksamkeit zu bedürfen, für ihr Aufwachsen waren ihre Familien zuständig. Die Proletarierkinder aber hatten einen solchen familären Rückhalt kaum, deshalb fielen sie auf. Sie gingen nicht oder sehr unregelmäßig zur Schule, weil sie so früh, wie es ihre körperliche Verfassung zuließ, zum Lebensunterhalt beitragen mußten. Für diese Kinder die längst eingeführte Schulpflicht auch praktisch durchzusetzen und die Kinderarbeit abzuschaffen, war ein wesentliches sozialpolitisches und schulpädagogisches Ziel dieser Zeit.
245
"Die Jugendlichen" traten erst gegen Ende des Jahrhunderts ins öffentliche Bewußtsein. Die sich vergrößernden Industriestädte hatten eine zunehmende Zahl jugendlicher Arbeiter angezogen, die mit ihren Eltern oder allein in speziellen Wohngebieten wohnten. Die jugendlichen Arbeiter wurden dadurch öffentlich auffällig, daß sie über eigenes Geld verfügten, das sie in ihrer Freizeit ausgeben konnten, und daß sie in ihren Wohnvierteln charakteristische Formen subkulturellen Verhaltens entwickelten, die das Bürgertum als bedrohlich empfand, das durch die immer größer und mächtiger werdende Arbeiterbewegung (Gewerkschaften auf der einen Seite, SPD auf der anderen) sich ohnehin an die Wand gedrückt fühlte; denn immerhin forderte diese Bewegung eine revolutionäre Umgestaltung der "kapitalistischen" in eine "sozialistische" Gesellschaft. Die relativ unkontrollierte Freizeit dieser jungen Arbeiter in den Griff zu bekommen, wurde bis zum Ersten Weltkrieg ein vorherrschendes pädagogisches Thema. Dabei wurden gleichsam "Zuckerbrot" und "Peitsche" kombiniert: die "Peitsche" war die Einführung der modernen Fürsorgeerziehung in Heimen, die seit 1900 in Preußen verhängt werden konnte, auch wenn der Jugendliche gar keine Straftat begangen hatte, aber zu "verwahrlosen" drohte. Das "Zuckerbrot" war die Einführung der "Jugendpflege" vor dem Ersten Weltkrieg, also der Jugendarbeit im heutigen Sinne. Unsere moderne Jugendarbeit geht also zurück auf Versuche des Staates, die Freizeit der Arbeiterjugendlichen "sinnvoll" zu gestalten, sie von der Straße zu holen, vor "Verwahrlosung" zu bewahren und vor allem auch von der revolutionären Arbeiterbewegung fernzuhalten.
Bis zum Ersten Weltkrieg hatte sich die Arbeiterschaft - und das galt auch für die jugendlichen Arbeiter - ausdifferenziert. Einem Großteil von angelernten, kaum ausgebildeten Arbeitern stand eine zunehmende Zahl qualifizierter und somit auch selbstbewußter Facharbeiter gegenüber, die für ihre Betriebe wichtig geworden waren. Diese Gruppe der jungen, aufstiegsorientierten Facharbeiter war es, die schon vor dem Ersten Weltkrieg die Arbeiterjugendbewegung gründete und - wenn auch nur in Minderheiten - bis 1933 in verschiedenen Jugendorganisationen der SPD und der Gewerkschaften zu finden war.
Diese Jugendbewegung war von ihrem Ursprung her eine Organisation zur Durchsetzung wirtschaftlicher und Bildungs-
246
interessen junger Arbeiter und Lehrlinge. Da sie einerseits möglichst viele ihresgleichen für eine starke Organisation gewinnen, andererseits aber auch die Öffentlichkeit auf ihre Forderungen aufmerksam machen wollte, erfanden ihre Mitglieder bestimmte Formen der öffentlichen Selbstdarstellung, nämlich Kundgebungen wie die schon erwähnten Jugendtage". Diese Formen der öffentlichen Präsentation hatte die Arbeiterjugend natürlich von der Arbeiterbewegung der Erwachsenen übernommen. Massenaufmärsche und Massendemonstrationen beruhten auf der Erfahrung, daß nur so die Öffentlichkeit auf die eigenen Probleme und Forderungen aufmerksam gemacht und daß zugleich das kollektive Selbstbewußtsein in den eigenen Reihen gefestigt und gesteigert werden konnte. Neu war also nicht die Massenkundgebung selbst, sondern daß auch eine Jugendorganisation sich ihrer bediente, und Schirach übernahm diese Form der Selbstdarstellung zum ersten Mal bei dem schon erwähnten "Jugendtag von Potsdam" im Oktober 1932.
Nicht minder bedeutsam für unser Thema war aber die Entstehung der bürgerlichen Jugendbewegung zu Beginn unseres Jahrhunderts. Der "Wandervogel" - offiziell 1901 gegründet -entwickelte und praktizierte ein eigenständiges "Jugendleben", wie es die HJ - zumindest im Hinblick auf die äußeren Formen - dann aufgriff. Während bis dahin die Überzeugung herrschte, daß "Erziehung" nur dort stattfinden könne, wo Erwachsene auf Kinder und Jugendliche einwirken könnten, und daß deren Aufwachsen möglichst umfassend von Erwachsenen beobachtet und kontrolliert werden müsse - deshalb auch das Unbehagen über die relativ unkontrollierte Freizeit der Arbeiterjugend! -, erhoben nun junge Menschen aus bürgerlichen Familien den Anspruch, zumindest bis zu einem bestimmten Ausmaße sich selbst erziehen zu können und sogar zu müssen. Sie taten dies, indem sie sich in Gleichaltrigen-Gruppen zusammenfanden, in Distanz zur großstädtischen Zivilisation traten und statt dessen auf Wanderungen und Fahrten die Natur in Gestalt von Wäldern, Wiesen, Seen und Bergen entdeckten, indem sie in Distanz zur offiziellen Mode sich bequem kleideten, eigene Lieder und einen eigenen Jargon entwickelten; bei den Liedern handelte es sich im wesentlichen um alte, weitgehend unbekannt gewordene Volkslieder, die Hans Breuer, einer der Wandervogel-Führer, als Liederbuch unter dem Titel "Zupfgeigen-
247
hansl" schon vor dem Ersten Weltkrieg herausgab. Dieses Buch wurde ein Bestseller und bis 1933 über eine Million Mal verkauft.
Heute nennen wir eine solche Gruppierung wie den Wandervogel eine "Subkultur" oder "Teilkultur", deren vielfältige Erscheinungsformen sind uns inzwischen selbstverständlich geworden. Damals handelten die jugendlichen Gruppen aus ihrem spontanen Erleben heraus, nicht um eine neue pädagogische Theorie zu verwirklichen, die Einflüsse von Erwachsenen suchten sie möglichst fernzuhalten; gleichwohl fühlten sie sich ein wenig elitär, weil sie auch lebensreformerische Forderungen wie Alkohol- und Nikotinabstinenz zu realisieren trachteten. Sie konnten jedoch nicht wissen, daß sie mit ihren relativ harmlosen Freizeit-Erfindungen eine Entwicklung einleiteten - bzw. ihr Ausdruck gaben -, die die Stellung der Jugendlichen in der Gesellschaft nachhaltig verändern sollte. Diese Veränderungen sollen nun knapp skizziert werden, wobei die besondere Rolle der HJ in diesem historischen Prozeß im Blick bleiben soll; sie lassen sich mit den Begriffen "Vergesellschaftung", "Pluralisierung" und "lndividualisierung" darstellen.
Vergesellschaftung der Jugendphase
"Die Jugend" als besondere soziale Gruppe entsteht also um die Jahrhundertwende. Vorher gab es natürlich auch schon jugendliche Menschen, aber sie wurden nicht als besondere soziale Gruppe klassifiziert. Das konnte vielmehr erst geschehen, als man "den" Jugendlichen gemeinsame Merkmale zuschrieb, die sie von anderen sozialen Gruppen unterscheidbar machte. Man kann diese Merkmale unter dem Stichwort der "Pädagogisierung" zusammenfassen. Das Jugendalter wird nun definiert als eine eigentümliche Lebensphase, die in besonderer Weise produktiv und für die weitere Lebensgeschichte von spezifischer Bedeutung ist, andererseits aber auch als eine Phase, die besonders gefährdet ist. Die Gefährdung wurde vor allem in der unkontrollierten Freizeit der Arbeiterjugend gesehen, die produktive Seite in den Selbsterziehungsversuchen der bürgerlichen Jugendbewegung. Die pädagogische Definition des Jugendalters enthielt also von vornherein zwei Seiten: das Bemühen um eine
248
dem Alter angemessene Förderung, aber auch um eine besondere soziale Kontrolle. Solange sich die Jugendlichen in den von Erwachsenen geprägten sozialen Feldern bewegten - in der Familie, am Arbeitsplatz, in der Schule, beim Militär -, konnte diese besondere Kontrolle als entbehrlich erscheinen. In der Freizeit jedoch waren die Jugendlichen einer solchen Kontrolle nur noch begrenzt unterworfen. Hier entstanden vielmehr Spielräume der Selbstbestimmung unter Gleichaltrigen.
Ausgangspunkt der damals zum öffentlichen Thema werdenden "Jugendfrage" war also die Freizeit. Als im Jahre 1891 der arbeitsfreie Sonntag eingeführt wurde, gab es in bürgerlichen Kreisen - unter Professoren, Pfarrern, Lehrern, Ärzten, Unternehmern - eine Diskussion darüber, ob die erwachsenen Arbeiter diese freie Zeit nicht zu ihrem Schaden, nämlich zur Trunksucht oder zur politischen Rebellion nutzen würden, und es gab alle möglichen Programme, wie man sie dazu bewegen könne, ihre Freizeit auch "sinnvoll" zu verbringen - nämlich im Sinne bürgerlich-kultureller Leitvorstellungen. Diese Sorge galt natürlich erst recht den Jugendlichen. Freizeit war nicht nur einfach ein Stück Zeit, mit der man tun konnte, was man wollte. Sie wurde schnell auch zu einem eigentümlichen Raum, in dem sich die Regeln des Marktes durchsetzten - gegen die Regeln des Militärs, der Schule oder der Fabrik. Wie bescheiden zunächst auch die finanziellen Möglichkeiten für die meisten Menschen sein mochten, sie erlebten ihre Freizeit als Zeit persönlicher Freiheit, in der man wählen konnte zwischen verschiedenen Möglichkeiten und Angeboten. Wählen konnte man aber nicht nur zwischen Konsumgütern, sondern auch zwischen politischen und weltanschaulichen Positionen, und für diese konnte man nun auch geworben werden. Der Zugriff auf die Freizeit der anderen - auch und gerade der Jugendlichen - wurde schon vor dem Ersten Weltkrieg und erst recht danach zu einem Hauptthema der Öffentlichkeitsarbeit aller möglichen Verbände und Organisationen. Die Freizeit der anderen rief nicht nur ökonomische, sondern auch weltanschauliche und politische Interessen auf den Plan, und die Monopolisierung der Jugendarbeit durch die HJ war eine Kombination von Freizeitkontrolle, Ausschalten anderer Wettbewerber und des Versuches, die Freizeitaktivitäten im gewünschten Sinne "sinnvoll" zu kanalisieren - alles Absichten, die schon vor dem Ersten Weltkrieg erkennbar sind. Rück-
249
blickend muß man sagen, daß die zunehmende Freizeit in Verbindung mit steigendem Wohlstand und mit der Massenproduktion technisch hochwertiger Gebrauchsgüter - vom Auto bis zum Fernseher - den Charakter einer kulturellen Revolution gehabt hat, die unsere menschlichen Beziehungen, unsere Einstellungen und Verhaltensweisen, unsere Normen und Werte entscheidend verändert hat.
Die neue Aufmerksamkeit für das Jugendalter um die Jahrhundertwende zeigte sich in verschiedenen Formen. Die sogenannte "Jugendgerichtsbewegung" wollte den jugendlichen Straftäter anders behandeln als den erwachsenen, nämlich "erzieherisch". Diese Bestrebungen fanden Ausdruck im Jugendgerichtsgesetz (JGG) von 1923, das in wesentlichen Punkten bis 1991 galt und dann durch das "Kinder- und Jugendhilfegesetz" (KJHG) abgelöst wurde. In den schon erwähnten Fürsorgeerziehungs-Anstalten versuchte man, sogenannte "verwahrloste" Jugendliche - die fast ausschließlich aus der Arbeiterschaft kamen - nach den Prinzipien bürgerlicher Wohlanständigkeit umzuerziehen. Die Reformpädagogik richtete ihre Aufmerksamkeit auf die besonderen Bedürfnisse, Probleme und Schwierigkeiten jugendlicher Menschen, und die Wissenschaft wollte auch nicht zurückstehen und leistete ihren Beitrag zum Thema in Gestalt einer zunächst vor allem psychologisch orientierten Jugendkunde.
Überwölbt wurden alle diese Einzelbestrebungen durch eine Art von öffentlicher Philosophie, den sogenannten "Jugendkult". Er entstand um die Jahrhundertwende vor allem in Kreisen des protestantischen Bildungsbürgertums. Das Jugendalter wurde gepriesen als Garant einer besseren Zukunft. Während die Erwachsenen zu sehr verstrickt seien in vordergründigem Materialismus, in wirtschaftlichen, finanziellen und politischen Sonderinteressen, seien Jugendliche von solchen "Verunreinigungen" des Charakters noch befreit; deshalb könnten sie sich große und edle Ziele setzen, Ideen und Haltungen entwickeln, die als sittliche Erneuerung später dem ganzen Volk zugute kommen könnten. Kein geringerer als Nietzsche gehörte zu den Propagandisten einer solchen Kulturkritik, die die bürgerliche Welt verdammten, zugleich aber ihre Hoffnungen auf eine bessere Zukunft auf die Jugend projizierten.
250
Hintergrund dieses Jugendkultes waren die besonders vom Bildungsbürgertum als unangenehm und bedrohlich empfundenen sozialen und kulturellen Veränderungen, die seit 1870 wegen der rapiden Industrialisierung entstanden waren; sie brachten den gesellschaftlichen Status aller Schichten der Bevölkerung in Bewegung, was - wovon noch die Rede sein wird -zur massenhaften Gefährdung von Identität führte. So verlor das humanistisch orientierte Bildungsbürgertum mehr und mehr seine Position als moralischer "Sinn-Lieferant" und wurde überrundet durch ein neues Wirtschaftsbürgertum, das sich auch an den Hochschulen nicht mehr an den humanistischen Idealen orientierte, sondern an der modernen Technik und an den damit gegebenen kapitalistischen Erfolgschancen - ganz zu schweigen von der als bedrohlich empfundenen, immer größer und mächtiger werdenden Organisation der Arbeiterbewegung.
Im Sog dieser kulturkritischen Strömung etablierten sich spezifische Konzepte der Jugenderziehung, z.B. in Gestalt der "Landerziehungsheime". Fernab von der städtischen Zivilisation und den von ihr ausgehenden "Gefährdungen" sollten junge Menschen sich geistig und sittlich bilden können. Gustav Wyneken wollte gar in seinem Landerziehungsheim die "schädlichen" Einflüsse der Erwachsenen weitgehend ausschalten und setzte auf eine eigentümliche "Jugendkultur", gemäß der seine Schüler in Gemeinschaft miteinander, mit ihren Lehrern und in Auseinandersetzung mit den großen geistigen Ideen ihre Bildung in die eigenen Hände und Köpfe nehmen sollten.
Nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg bekam dieser Jugendkult neue Impulse. Nun setzten sich auch politische Hoffnungen auf die "junge Generation", daß sie nämlich das deutsche Volk wieder zu neuem Ansehen führen werde. Der Höhepunkt dieses Jugendkultes verschmolz mit dem Aufstieg der Hitlerbewegung, und ohne diese jugendzentrierte Grundstimmung ist der Enthusiasmus, der zunächst von der HJ ausging und ihr zugleich entgegenkam, nicht zu verstehen.
Der Jugendkult ging von Erwachsenen aus, und er bezweckte nicht etwa revolutionäre Neuerungen, sondern im Gegenteil die im wörtlichen Sinne "Wieder-Herstellung" alter Verhältnisse. Das Bildungsbürgertum wünschte sich die Wiederge-
251
burt seiner alten humanistischen Werte und damit natürlich des Ansehens derer, die diese Werte öffentlich verkündeten. Nach 1918 erwartete das Bürgertum von der Jugend nicht etwa die unbefangene Gestaltung der neuen demokratischen Möglichkeiten, sondern im Gegenteil die Wiederherstellung jenes Deutschlands, wie es vor der militärischen Niederlage war. Die HJ dagegen verstand sich als revolutionäre Jugendbewegung, die zwar auch das Ansehen des deutschen Volkes wiederherstellen wollte, aber eben nicht im Sinne der alten humanistischen Werte oder jenes alten Deutschlands der Klassengegensätze und der Adelsprivilegien, sondern mit einem neuen, in die Zukunft weisenden Konzept - das allerdings wie auch bei Krieck letztlich unklar blieb.
Nur am Rande sei vermerkt, daß der Jugendkult den Erziehungsberufen eine neue Bedeutung gab. Insofern waren seine Erfinder zugleich auch seine Nutznießer. War der Lehrer z.B. früher eher so etwas wie ein wenig angesehener "Steiß-Trommler", der das ungebärdige Jungvolk in die Fußstapfen der Väter zu treiben hatte, so arbeitete er nun an der großen Aufgabe der Zukunft des ganzen Volkes. Die hohe Aufmerksamkeit, die den jungen Menschen entgegengebracht wurde, ließ auch diejenigen im neuen Glanze erstrahlen, die von berufswegen mit ihnen zu tun hatten.
Aber in unserem Zusammenhang ist etwas anderes wichtiger. Wir sehen um die Jahrhundertwende das Jugendalter als eine besondere, pädagogisch definierte soziale Größe entstehen, und wir sehen heute sein Verschwinden. Diesen Prozeß möchte ich die Vergesellschaftung des Jugendalters nennen, und er bedarf einer Erklärung.
In dem Maße, wie die Jugend ins Blickfeld der Öffentlichkeit trat, wurde sie dem Zugriff von Erwachsenen und ihrer Organisationen ausgesetzt. Die andere Seite der Fürsorge für die Jugend war ein ständiger "Kampf um die Jugend". Schon der Wandervogel vor dem Ersten Weltkrieg war solchen politischen, antisemitischen, pädagogischen oder lebensreformerischen Ansinnen ausgesetzt, und ein Hauptzweck der staatlich subventionierten Jugendpflege damals war, die Arbeiterjugendlichen von den Organisationen der Arbeiterbewegung fernzuhalten. In der Weimarer Zeit gab es kaum einen Erwachsenenverband, der sich nicht eine Jugendabteilung zu halten versuchte. Die möglichst vollständige Mobilisierung
252
der jungen Generation für eigene Zwecke war keine Erfindung der HJ, sondern längst vorher angelegt. Die HJ trieb diese Entwicklung jedoch durch Massenmobilisierung und durch weitgehende Monopolisierung auf den Höhepunkt, danach war eine Steigerung nicht mehr möglich. Nach 1945 war der Jugendkult wegen seiner Inanspruchnahme durch die HJ verbraucht, erhalten blieb jedoch zunächst noch die Pädagogisierung des Jugendalters, d.h. die öffentlich anerkannte und legitimierte Definition "der'' Jugend als einer Lebensphase, die besonderer pädagogischer Aufmerksamkeit und Kontrolle bedürfe. Schon in den 50er Jahren vermischten sich die Verhaltensstile von jungen Arbeitern und Bürgerkindern weitgehend, wie der Soziologe H. Schelsky in seinem 1957 erschienenen Buch "Die skeptische Generation" feststellte. Was die HJ pädagogisch zu organisieren und zu erzwingen versuchte, die "Volksgemeinschaft" innerhalb der jungen Generation im ganzen, setzte sich also in den 50er Jahren in anderer Weise von selbst durch - nicht zuletzt durch die industrielle Massenproduktion von auf die junge Generation zugeschnittener U-Musik und einschlägiger Moden. Schelsky hatte in dem genannten Buch aber noch eine andere wichtige Feststellung getroffen: daß nämlich das Jugendalter als besondere soziale Gruppe im Verschwinden begriffen sei und daß es künftig nur noch den Status der Kindheit und des Erwachsenen geben werde. In den 60er und 70er Jahren vollzog sich dieser Prozß dann schnell. Die Jugendlichen eroberten sich die wichtigsten Erwachsenenprivilegien - Freizeitautonomie und das Recht auf Sexualität -, die pädagogische Definition des Jugendalters mußte Zug um Zug aufgegeben werden. Es war ein Sieg des Marktes, vor allem des Freizeitmarktes über die traditionelle Pädagogik. Die Jugendlichen sind heute kaum noch ein Objekt von "Erziehung" im überlieferten Sinne - nicht einmal mehr in den Schulen -, sie gelten als junge Erwachsene, die zwar noch ihrem Alter entsprechende spezifische Probleme haben, aber nicht mehr in erster Linie pädagogisch definiert werden. Man könnte sagen, daß sich das Jugendalter von der Erziehung emanzipiert hat. Wie jeder Fortschritt - wenn man ihn denn dafür hält - hat aber auch dieser seine Schattenseiten. Verschwunden ist nämlich auch das öffentliche Interesse an der Jugend. Galt z.B. noch nach dem Zweiten Weltkrieg Arbeitslosigkeit von Jugendlichen unter allen Erwachsenen als eine pädagogische Katastrophe, die mit allen verfügbaren Mitteln
253
und so schnell wie möglich beseitigt werden müsse, so ist sie heute eher ein statistisches Problem, - jedenfalls keines, daß die Pädagogen oder gar die Politiker aus ihren Sesseln reißt. Noch bis in die 60er Jahre galt die Altersstufe der Jugend als Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Davon ist längst keine Rede mehr.
Welche Rolle spielte die HJ in diesem historischen Prozeß von der Entstehung des Jugendalters bis zu seinem Verschwinden?
Die Emanzipation der Jugend von ihren traditionellen Erziehungsmächten und damit ihre Vergesellschaftung stellt sich uns heute dar als ein Prozeß, der über Jahrzehnte im Rahmen einer pädagogischen Begleitung ablief, die nun überflüssig geworden ist, weil die Sache zu ihrem historischen Ende gekommen ist. Diese pädagogische Begleitung hatte immer die doppelte Bedeutung von verständnissuchender Ermutigung einerseits und Kontrolle andererseits. Hätte es diese Begleitung in Gestalt der Jugendbewegungen, der Jugendpflege, der Jugendverbände einschließlich der HJ nicht gegeben, so wäre die Emanzipation sehr abrupt und zu einem Zeitpunkt - vor dem Ersten Weltkrieg - erfolgt, wo weder die Erwachsenen noch die Jugendlichen noch die mit Jugend befaßten Institutionen darauf vorbereitet gewesen wären. Über mehrere Generationen hinweg konnten so Erfahrungen gesammelt werden, konnte in den Gleichaltrigengruppen experimentiert werden.
Die HJ ist in diesem historischen Kontext zu sehen, sie trieb den öffentlichen Zugriff der Erwachsenen auf die junge Generation durch Monopolisierung und Verpflichtung auf die Spitze. Auch die Doppelbödigkeit von Fürsorge einerseits und sozialer Kontrolle andererseits behielt sie bei, wobei der Akzent in besonderer Weise auf der Kontrolle lag.
Das Konzept des "Jugend-Staates" war jedoch nicht zukunftsträchtig, sondern eine rückwärtsgewandte romantische Vision, eine soziale Fiktion wie die Idee der Volksgemeinschaft, deren Ableger sie ja auch nur war. Jedenfalls hatte sie nicht die Perspektive des Endes der Jugendphase im Blick, sondern im Gegenteil ihre Dauerstellung.
254
Pluralisierung
Moderne demokratische Industriegesellschaften sind pluralistisch verfaßt. Das gilt nicht nur für die politische Ebene, für politische Parteien, die sich in Parlamenten zusammenfinden, oder für vielfältige Interessengruppen, die sich in einem System von Vereinen und Verbänden ordnen. Vielmehr gilt der Pluralismus auch für das kulturelle Alltagsleben im weitesten Sinne. Nicht nur Interessen, sondern auch Werte und Normen, nach denen die Menschen ihr Leben ausrichten, dürfen verschieden, also pluralistisch sein. Dies ist uns heute selbstverständlich geworden. Aber es hat Jahrzehnte gedauert, bis der kulturelle Pluralismus sich durchsetzen konnte, der parlamentarische hat sich sehr viel früher etabliert. Insbesondere die christlichen Kirchen, und hier besonders die katholische, hielten zäh an ihrer historisch gewonnenen kulturellen Hegemonie fest, z.B. an Konfessionsschulen und überhaupt an moralischen Alltagsnormen, die religiös fundiert waren und deshalb eigentlich nur für die jeweiligen Glaubensanhänger verbindlich sein konnten, gleichwohl aber z.B. per Gesetz für alle Mitglieder der Gesellschaft zur Geltung gebracht wurden. Die gegenwärtige Diskussion um den § 218 ist noch ein Nachklang davon.
Als die Nazis und damit auch die HJ nach 1933 diesen Pluralismus eindämmten und eine Alltagskultur des "gesunden Volksempfindens" propagierten, was ein Verbot der für "undeutsch" gehaltenen Werte und Strömungen einschloß - erinnert sei u.a. an die Bücherverbrennung -, da fand dies breite Zustimmung in der Bevölkerung. Tatsächlich stand die Liste dessen, was nun erlaubt bzw. verboten sein sollte, dem recht nahe, was die Kirchen und andere konservative Mächte auch vorher schon gefordert hatten.
Insbesondere in Fragen der Erziehung war Pluralismus bis in die 60er Jahre verpönt. Man ging davon aus, daß Kinder und Jugendliche erst einmal in einem normativ geschlossenen System heranwachsen müßten, bevor sie dann als Herangewachsene mit anderen normativen Lebensstilen konfrontiert werden dürften. Man nannte diese Systeme "Grundrichtungen der Erziehung". Schon in der Weimarer Zeit, erst recht aber nach 1945 erwies sich jedoch die Erwartung, man könne ernsthaft inmitten einer normativ pluralistischen Gesellschaft ein davon unberührtes normativ einigermaßen ein-
255
deutiges Aufwachsen arrangieren, als Illusion. Die Massenmedien, insbesondere das Fernsehen, die allen alles mitteilen, eben auch die von den eigenen Normen abweichenden Lebensstile, unterhöhlten solche pädagogischen Absichten von Jahr zu Jahr mehr. Im selben Maße wurde ein dem sich entgegen stemmender "Jugendschutz" etwa beim Fernsehen zur Farce. Man könnte diesen Prozeß u.a. dadurch beschreiben, daß man überprüft, was zur "Jugendschutz-Zeit", also vor 21 Uhr, im Fernsehen in den vergangenen Jahrzehnten gesendet werden durfte.
Pluralität - das wurde schon erwähnt - wird vor allem in der Freizeit erfahrbar. Erst als die Arbeiter mehr Freizeit erhielten, als sie zur bloßen Rekreation ihrer Kräfte benötigten, konnten sie auch in die Lage geraten, andere politische Positionen, Meinungen, Lebensstile und Werte zur Kenntnis zu nehmen.
Ähnlich erging es den Jugendlichen, die nun in ihrer Freizeit in die Öffentlichkeit traten und dort dem Wettbewerb auch normativ unterschiedlicher Lebensstile und Lebensperspektiven ausgesetzt wurden. Da Jugendliche anders als Erwachsene im allgemeinen weltanschaulich noch wenig festgelegt sind, erschienen ihnen solchen Lebensstile als jeweils individuell wählbar. Das katholisch erzogene Mädchen konnte Mitglied des kommunistischen Jugendverbandes werden, ein evangelisch erzogener Junge konnte zum Katholizismus übertreten usw. Oder um ein Beispiel aus der Gegenwart zu nehmen: Beide - das katholische Mädchen wie der evangelische Junge - könnten nolens volens in die Drogenszene geraten, die ja auch ein Teil des - wenn auch illegalen - Freizeitmarktes ist.
Damals wie heute waren und sind solche Karrieren nicht die Regel. Aber sie deuten die Gefährdung an, die jedenfalls nach Meinung der Erwachsenen von der normativen Pluralität von Lebensstilen und Lebensentwürfen ausgeht; sie liegt nämlich in der Wählbarkeit und damit in der Möglichkeit, das eigene soziale Herkunftsmilieu, die bisher in der Erziehung erworbenen politischen, weltanschaulichen und religiösen Einstellungen zugunsten anderer auf legale Weise aufzugeben. Da kann es nicht verwundern, daß der pluralistische Charakter der Gesellschaft, der nun auch das Jugendalter erfaßt hatte, von vielen Erwachsenen und ihren Organisationen nicht gerade mit Freude begrüßt wurde.
256
Vom Standpunkt des Jugendlichen aus gesehen forderte der Pluralismus der Werte eine individuelle Lebensplanung heraus, im Rahmen dieser Angebote - wozu nicht zuletzt die berufliche Perspektive gehörte - eine subjektiv plausible Lebensvision zu riskieren und danach zu leben. Das Herkunftsmilieu garantierte weder mehr noch bestimmte es ohne weiteres die Zukunft. Das galt durchweg für die bürgerliche Jugend, für die proletarische zunächst nur mit Einschränkungen, weil für diese teils aus ökonomischen, teils aus bildungspolitischen Gründen derartige Wahlmöglichkeiten begrenzt waren. Erst als bildungspolitisch die "Chancengleichheit" durchgesetzt war, konnten sich solche Wahlmöglichkeiten auch in großem Stile für diese Jugendlichen eröffnen. Dieser Zustand ist heute im wesentlichen erreicht, jedenfalls kann kaum noch ein Arbeiterkind behaupten, es habe aus finanziellen Gründen nicht das Gymnasium besuchen können. Innerhalb der Emanzipation der Jugend läßt sich also eine spezifische Teilemanzipation erkennen, nämlich die der Arbeiterjugend; sie mußte erst einmal auf das Optionsniveau der bürgerlichen Jugend gehoben werden. Und in diesem Prozeß hat die HJ zweifellos eine fortschrittliche Rolle gespielt, indem sie in großer Zahl auch Mädchen und Jungen aus der Arbeiterschaft und aus der Landbevölkerung in ihr "Jugendleben" einbezog.
Im Hinblick auf die mit der normativen Pluralisierung auftretenden Probleme war die HJ jedoch rückständig bzw. unmodern. Die Neigung zur Gruppenbildung mit Gleichaltrigen, die mit dem Wandervogel begann, resultierte aus den mit den neuen Wahlmöglichkeiten entstandenen Orientierungsproblemen. Man suchte sich solche Gleichaltrigen aus, bei denen man Solidarität fand, weil sie die gleichen Probleme hatten und zu einer ähnlichen Lösung dieser Probleme tendierten.
Überblickt man die Jugendszene in der Weimarer Zeit, dann erkennt man eine bunte Vielfalt von kirchlichen, politischen, bündischen, gewerkschaftlichen Jugendverbänden, in denen Jugendliche nach ihrer Wahl mitwirkten. Diese Vielfalt entsprach der pluralistischen kulturellen Gesamtsituation, so wie ein Markt sich eben auf Bedürfnisse von Menschen einzustellen pflegt. Und wer als junger Mensch glaubte, ohne solche "pädagogische Begleitung" zurechtzukommen, konnte sich auch fernhalten, denn die Teilnahme an diesen Angeboten war damals wie heute freiwillig.
257
Gemessen nun an der bereits vor 1933 erreichten, der pluralistischen Ausgangslage entsprechenden Ausdifferenzierung der Jugendszene brachte die HJ eine enorme Verarmung hervor. Der Versuch, die moderne Pluralität weitgehend abzuschaffen, war von vornherein zum Scheitern verurteilt, weil sie für eine moderne, arbeitsteilige und dadurch hochentwickelte Gesellschaft konstitutiv ist. Die Disfunktionalität dieses Versuches wäre auch in der NS-Zeit deutlicher geworden, wenn der Krieg mit seinen eigenen Gesetzen und Regeln dieses Problem nicht wie so viele andere verdeckt hätte.
Als geradezu pädagogisch monströs muß aber in diesem Zusammenhang der Versuch erscheinen, die mit der öffentlichen Mobilisierung der Jugend notwendig mitgegebenen Wahlmöglichkeiten mit einer einzigen Jugendorganisation begleiten zu wollen, die zudem im wesentlichen auf militärähnlichen Ritualen beruhte. Dieses Manko wurde auch schon bald erkennbar, und Schirach versuchte mit der "musischen Wende" darauf zu reagieren. Aber was dabei zutage trat, war allemal ärmlich im Vergleich zu dem, was vor 1933 bereits vorlag. Nicht einmal die Kirchen durften einen eigenen Beitrag zur Jugendarbeit mehr leisten. Schirach hatte die Pluralität, den "Markt" der Lebensstile abgeschafft zugunsten einer eindimensionalen "Jugendwelt", in der das Nachdenken über alternative Lebensentwürfe kaum noch Platz hatte. Man könnte fast sagen, Schirach habe mit der Pluralität auch die gerade erst entstandene "Kulturpubertät" wieder abgeschafft, also jene jugendliche Lebensphase, die u.a. durch das Durchspielen alternativer Lebensentwürfe geprägt ist und durch die Notwendigkeit, sich für einen dieser Entwürfe dann auch zu entscheiden. Aber richtiger wäre wohl zu sagen, die HJ habe sich für die Pluralität und die daraus resultierenden Probleme gar nicht interessiert, weil ihr ursprüngliches Ziel die politische Mobilisierung der Jugend für die Hitlerbewegung war und weil sie dieses Image, als das Ziel der Machtergreifung erreicht war, nicht wieder los wurde.
Individualisierung
Das Aufwachsen unter den Bedingungen normativer Pluralität macht individuelle Entscheidungsfähigkeit und entsprechende Verantwortungsbereitschaft nicht nur möglich, sondern auch nötig.
258
Pädagogisch gesehen muß diese Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit gelernt werden, und das ist nur in dem Maße möglich, wie im Laufe des Kindes- und des Jugendalters die erzieherische Stellvertretung durch die zuständigen Erwachsenen zurücktritt. Dies aber war ein schwieriger geschichtlicher Prozeß. Zäh hielten Elternhaus und Schule noch bis in unsere unmittelbare Gegenwart hinein an ihren Erziehungsansprüchen fest, aber seit dem Wandervogel wurden die außerschulischen Gruppierungen der Gleichaltrigen Übungsfelder für individuell verantwortliches Verhalten. Die Attacken der HJ gegen die Schule müssen auch in diesem Zusammenhang gesehen werden, nämlich als Widerstand gegen das von der Schule, vor allem vom Gymnasium verlangte Unterwerfungsverhalten, das selbständiges Denken und Handeln schwer aufkommen ließ.
Es wäre einseitig zu behaupten, die HJ habe generell individuelles Verhalten verhindert. Zwar hat sie durch die Zerstörung der Pluralität normative Alternativen für jugendliche Lebensentwürfe erheblich reduziert, aber innerhalb ihrer Angebote gab es durchaus Möglichkeiten, individuelles Verhalten und vor allem persönliche Verantwortung zu fördern. Das galt zunächst einmal für die zahlreichen jugendlichen Führer vor Ort, die für ihre Gefolgschaft verantwortlich sein sollten. Gewiß geschah dies nur in einem durch die Rituale des "Dienstes" begrenzten Rahmen, aber eine solche Beschränkung war auch nötig, wenn Überforderung vermieden werden sollte. In welchem Umfange kann man einen 13jährigen für kaum Jüngere verantwortlich machen? Ausdrücklich der individuellen persönlichen Entwicklung sollten die Angebote von "Glaube und Schönheit" sowie für die männlichen Jugendlichen die sachorientierten Angebote der Flieger-, Motor- usw. HJ dienen. Im Vergleich zu den anderen damaligen Sozialisationsinstanzen Familie, Schule, Arbeitsplatz und vor allem auch der Kirchen war die HJ erheblich fortschrittlicher im Hinblick auf die Förderung individueller Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit. Das zeigte sich nicht zuletzt im Kriege, wo diese Fähigkeiten vielen Jungen und Mädchen abverlangt wurden (das Beispiel KLV wurde schon erwähnt).
Zusammenfassend läßt sich sagen: Sieht man die HJ im historischen Prozeß der Emanzipation des Jugendalters, dann zeigt sie in eigentümlicher Mischung fortschrittliche und
259
rückschrittliche Momente. Rückschrittlich unter dem Maßstab dieses Prozesses war sie vor allem im Hinblick auf die weitgehende Ausschaltung der Pluralität. An deren Stelle versuchte sie ein pädagogisches Milieu zu arrangieren, das von allen als "erziehungsfeindlich" definierten Einflüssen freibleiben sollte - auch von Streichers "Stürmer".
In den Kriegsjahren verfaßte die Reichsjugendführung eine Denkschrift über jugendgefährdende Einflüsse z.B. von Filmen und Illustrierten, die angesichts dessen, was der Krieg sonst für Kinder und Jugendliche mit sich brachte, reichlich betulich wirkt.
Fortschrittlich dagegen wirkte die HJ im Hinblick auf die Mobilisierung auch solcher Teile der Jugend - der Mädchen, der jungen Arbeiter und Arbeiterinnen, der Landjugend -, die bisher kaum eine Chance hatten, am "Jugendleben" teilzunehmen, und erlaubte somit auch für diese Gruppen eine relative Emanzipation von Elternhaus und Schule, und fortschrittlich war sie sicherlich auch im Hinblick auf die im Vergleich zu den anderen Erziehungsinstanzen durchaus sichtbare persönliche Entscheidungs- und Verantwortungsfähigkeit für nicht wenige Jugendliche.
Allerdings blieb dies alles beschränkt auf die eigene Gruppe. Dem einzelnen galt sie nur, insofern er als nützliches und notwendiges Glied der "Volksgemeinschaft" gelten konnte. Wer einer solchen Erwartung nicht gerecht wurde, z.B. weil er behindert war, der traf auch nicht auf das fürsorgerische Interesse der HJ. Die damals pathetisch beschworene "Volksgemeinschaft" hatte also nicht nur ihre rassistischen Grenzen, insofern z.B. für Juden darin kein Platz war, ihre Solidarität mit den schwächeren Volksgenossen war ebenfalls nicht sonderlich entwickelt, sofern es sich nicht um schuldlos Arbeitslose oder um Kriegsverletzte handelte. Die in der HJ geprägte Sozialvorstellung bestand nicht nur in der schon erwähnten Reduktion aller denkbaren Sozialformen auf das militärische Modell. Hinzu kam vielmehr die Vorstellung von der biologischen Determiniertheit nicht nur der physischen und psychischen Konstitution, sondern auch der sozialen Zugehörigkeit. Diese Vorstellung schloß im Grunde eine substantielle soziale Verantwortung aus. Der Tatsache etwa, daß der eine Jude und der andere "arischer" Deutscher war, ließ sich nur durch "Ausgliederung" begegnen, nicht
260
etwa durch gemeinsames soziales Handeln produktiv gestalten. Deshalb gab es in einem strengen Sinne des Wortes auch kein solidarisches Handeln. Solidarität setzt voraus, daß die "Schwäche" des anderen, die es zu mildern gilt, als das jedem Mitglied der Solidargemeinschaft jederzeit mögliche eigene Schicksal angesehen werden kann. Dies wiederum setzt in irgendeiner Weise ein Verständnis des Menschen als "Selbstzweck" voraus. Biologistisches Denken jedoch kann weder moralisch noch praktisch eine solche Position einnehmen; gegenüber der "Natürlichkeit" der sozialen Gegebenheiten gibt es vernünftigerweise nur Unterwerfung, kein auf Änderung und Milderung zielendes Handeln. Selbst die Wohlfahrtsaktivitäten der HJ beruhten nicht auf einer regulativen Idee sozialer Verantwortung; denn derjenige, der heute noch eine Spende in die Sammelbüchse gegeben hatte, konnte morgen von der Gestapo abgeholt werden, ohne daß dies der Idee der "Volksgemeinschaft" irgendwie Abbruch getan hätte. Sozialpolitischer Aktionismus und Enthusiasmus führen also keineswegs per se schon zu einem substantiellen Konzept von sozialer Verantwortung, auf das man sich verlassen könnte.
261